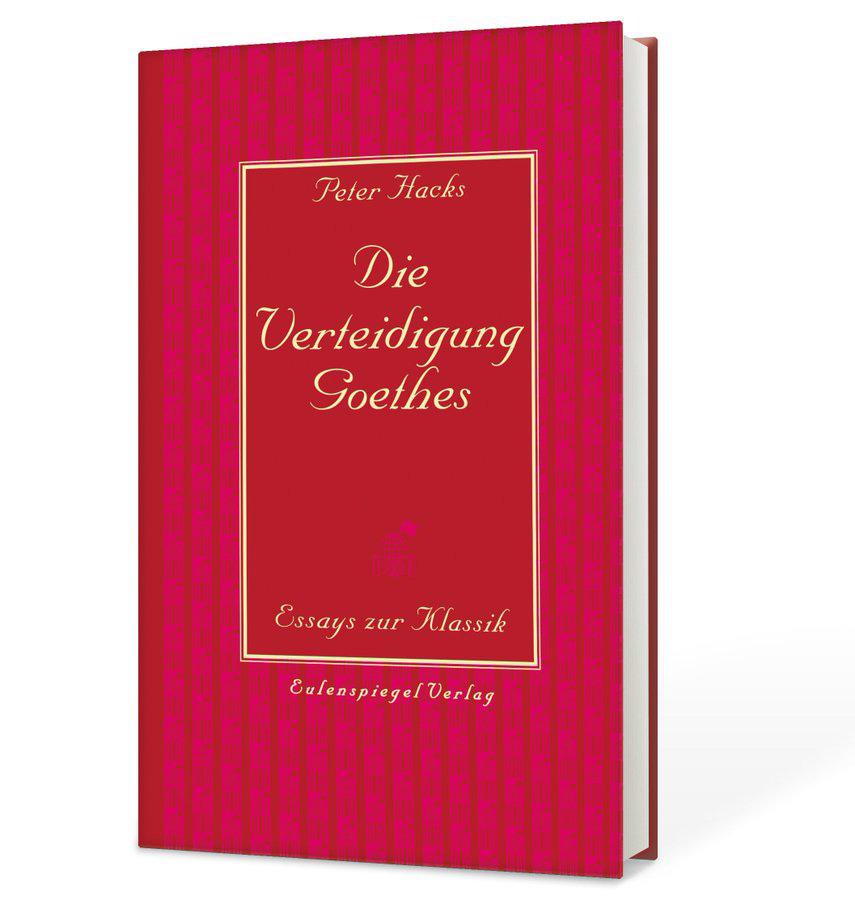Der vor zehn Jahren verstorbene Schriftsteller, Liedermacher und Linksanwalt Franz Josef Degenhardt wäre am 3. Dezember 90 Jahre alt geworden. Politisch verstand er sich als Kommunist. Aber seine Annäherung an den Kommunismus, 1978 auch formell als Eintritt in die DKP vollzogen, führte über den Ausschluss aus der Sozialdemokratie sieben Jahre zuvor.
Gut zwei Jahre, nachdem Degenhardt sich gegen eine Hochschulkarriere und für APO und freiberufliche Liedermacherei entschieden hatte, kam es zu einer einschneidenden Episode in seiner politischen Biographie. 1971 wurde er aus der SPD, der er seit 1961 angehört hatte, ausgeschlossen. Anlass hierfür waren vier Konzerte, bei denen er vor der schleswig-holsteinischen Landtagswahl zur Wahl der DKP aufgerufen hatte.
Degenhardts Unterstützung stand im Zusammenhang mit der „Drei-Säulen-Theorie“ von Arbeitermacht. Diese drei Säulen umfassten: 1. Die Gewerkschaften und Arbeiterparteien im kapitalistischen Westen, 2. den (real-)sozialistischen Staatenblock im Osten (einschließlich der DDR) und 3. die antiimperialistischen nationalen Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Die Gewerkschaften (und insbesondere ihr linker Flügel, an dem sich die Traditionalisten engagierten) waren als Interessenvertretung der Arbeiterklasse im Westen entscheidend. Der Realsozialismus war für Linke im Westen einerseits von Bedeutung, weil er, wie Dietmar Dath es später einmal formulierte, die Garantie dafür war, „dass meine Regierung sich ihren eigenen Linken gegenüber nicht allzu schlecht benimmt: Man schlägt die Gattin nicht vor den Augen der feministischen Nachbarin.“ Solange der Kapitalismus in der BRD gezwungen war, mit der DDR zu konkurrieren, war sie objektiv eine Stütze der Klassenkämpfe im Westen. Degenhardt sollte dies nach dem Zusammenbruch in seinem Lied „Die Party ist vorbei“ von 1994 auf die Formulierung bringen: „Hand aufs Herz / Sie haben doch geglaubt, das ging die ganze Zeit so fort / die EWIGE TARIFRUNDE zu Ihren Gunsten / Sie haben ziemlich hoch gepokert / ‘ne Menge abgezockt / die gute alte Systemkonkurrenz / die haben Sie ganz schön ausgenutzt / die DDR saß ja immer MIT AM TISCH / bei jeder Pokerrunde / aber / DIE PARTY IST VORBEI.“ Andererseits war der Realsozialismus von Bedeutung, weil er die antiimperialistischen Befreiungskämpfe in der Dritten Welt (Vietnam, Chile, Angola, Nicaragua, Südafrika et cetera) unterstützte und damit dazu beitrug, die imperialistische Ausbeutung zu bekämpfen.
Die DKP bekam ihre Bedeutung im Hinblick auf die Strategie der Arbeiterbewegung im Norden. Degenhardts Beweggründe resultierten aus der Einschätzung, dass – wie er in einem Interview im Deutschlandfunk erklärte – die DKP der „einzige Garant für eine fortschrittliche Politik“ sei, da sich die „Führungsspitze (der SPD) immer mehr zur besseren Vertreterin des Kapitals“ mache. Die Unterstützung der DKP zielte nicht auf die fremde, sondern auf die eigene Partei, die SPD.
Die dahinterstehende Logik war einfach: Mit der APO war eine „neue Linke“ entstanden, die sich im Widerstand gegen die postfaschistische (Eliten-)Kontinuität, die Große Koalition, den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze und den fordistischen Kapitalismus mit den Mitteln des wiederentdeckten Marxismus zu einer radikalen „Systemkritik“ hinaufgeschwungen hatte. Die Verve der weitgehend spontan(eistisch)-en APO könne indes nur durch langfristige Organisationen erhalten werden – in der SPD und in der durch den Zustrom junger Arbeiter und Intellektueller aufsteigenden DKP. Dabei war die Funktion der DKP nicht zuletzt die Stärkung der Linken innerhalb der SPD im Kampf gegen den Anpassungskurs der regierenden Parteiführung. Oder wie der Marburger Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth diesen Sachverhalt ausdrückte: „Gäbe es keine legale DKP, könnte sich auch in der SPD keine marxistische Opposition konstituieren.“
Die DKP hatte sich 1968 aus dem Umfeld der illegalisierten KPD, der DFU und der APO gegründet, nachdem auf Betreiben von Gustav Heinemann und Willy Brandt die Wiederzulassung einer kommunistischen Partei beschlossen worden war. Dabei hatte man sich gegen eine Legalisierung der KPD entschlossen und für die Zulassung einer neu zu gründenden Partei.
Hintergrund dieser Entscheidung war die wachsende Kritik aus dem Ausland, dass die neofaschistische und von Nazi-Altkadern 1964 gegründete NPD legal in der BRD operieren konnte und in Folge ihrer Erstarkung in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre in sieben Landtage einzuziehen vermochte, während es in Deutschland kein Pendant zu den in allen westeuropäischen Ländern gängigen, starken KPen gab. Die DKP-Zulassung war darüber hinaus auch ein Zeichen der neuen Entspannungspolitik mit der Sowjetunion, die selbst wiederum ein Ausdruck ihrer wachsenden Macht in der Welt war.
Die SPD-Führung musste den Balanceakt meistern, die außenpolitischen Vorteile der DKP-Zulassung einzuheimsen und sie zugleich innenpolitisch klein zu halten. Dabei war die scharfe Abgrenzung von dieser „So-wjetpartei“ auch ein Mittel, unter den neuen Bedingungen der SPD/FDP-Koalition seit 1969 den eigenen staatstragenden Charakter zu unterstreichen. Das Mittel zur Eindämmung war der antikommunistische „Unvereinbarkeitsbeschluss“ durch den Parteivorstand vom 14. November 1970.
Wie der Historiker Thomas Klein in seiner Arbeit über die Sozialistische Einheitspartei Westberlins schreibt, hatte dieser Beschluss „eine beträchtliche Reichweite“. Denn er „lehnte nicht nur jede ‚Aktionsgemeinschaft mit Kommunisten‘ ab, sondern verlangte zur Durchsetzung dieser Abgrenzungspolitik auch Parteiordnungsverfahren (…)“. In einem solchen warf man Degenhardt nun einen „schwerwiegenden Verstoß gegen die Grundsätze der SPD“ vor. Es ist davon auszugehen, dass die SPD-Führung hier eine günstige Gelegenheit sah, einen Querulanten loszuwerden und ein Exempel an einer der bedeutendsten Führungsfiguren der APO zu statuieren. Denn spätestens seit 1968 war klargeworden, dass Degenhardt nicht nur den Anpassungskurs unter den Bedingungen des Kalten Krieges nicht (mehr) mittrug, sondern sich dezidiert als Revolutionär beziehungsweise Antikapitalist in der SPD begriff – eine Tatsache, die er in seinem Lied „Verteidigung eines alten Sozialdemokraten vor dem Fabriktor“ auf den Essener Songtagen 1968 offen kundgetan hatte. Nicht zuletzt seine Unterstützung der „Aktion Roter Punkt“ echauffierte die Parteispitze. Dabei handelte es sich um einen annähernd bundesweiten und sich über mehrere Jahre erstreckenden Kampf gegen Fahrpreiserhöhungen im ÖPNV, die selbst Folge der sich abzeichnenden „Fiskalkrise des Staates“ (James O’Connor) waren. Getragen wurde die Aktion von einem breiten Bündnis, regional oft von DKP, SDAJ und MSB Spartakus.
Auch aus diesem Grund hatte Degenhardt schon vor seinem Ausschluss zu jener durchaus großen Gruppe von Künstlerinnen und Intellektuellen gehört, die sich von der DKP angezogen fühlten und in ihrem kulturpolitischen Umfeld betätigten. So war er beispielsweise 1970 zusammen mit Martin Walser auf dem „Ersten Kulturpolitischen Forum“ der DKP in Nürnberg aufgetreten, mit 500 Teilnehmern.
Degenhardts Wahlaufruf war nun eine günstige Gelegenheit, den einen Störenfried loszuwerden, um damit Tausende zu disziplinieren. Nachdem das Parteiordnungsverfahren angestrengt worden war, wehrte sich Degenhardt mit allen Mitteln. In einem „FAZ“-Interview vom 23. Juli 1971 verteidigte er sich gegen den Vorwurf der Illoyalität noch recht ungeschickt mit der trotzigen Aussage, er empfinde „Solidarität mit den rechten Parteiführern vom Schlage Schmidt, Schiller und (Georg) Leber als Zumutung“.
Strategisch klüger war es schon, die existierenden Spannungen zwischen linker Basis und regierender Parteiführung zu seinen Gunsten zu wenden. So wandte sich Degenhardt in einem Offenen Brief an die Jusos mit dem Ruf nach einer Aktionseinheit.
Vor der Schiedskommission argumentierte Degenhardt ähnlich: Seine Handlungen seien nicht zum Schaden, sondern zum Nutzen der SPD gedacht. Seinen Ausschluss vermochte er dennoch und trotz unzähliger Solidaritätsbekundungen nicht zu verhindern. Der „heiligen Inquisition der SPD“, bei der „(m)eist die Linken verbannt (wurden), weil sie den Weg der Partei in die Mitte störten“, wie es die „Süddeutsche“ fast 40 Jahre später ausdrückte, entging er nicht. Am 4. August 1971 endete Degenhardts Mitgliedschaft in der SPD. Am selben Tag setzte man auch seinen Liedermacherkollegen (und späteren Parteigenossen) Kittner vor die Tür.
Degenhardts Einspruch blieb folgenlos.
Nach einer Dekade Mitgliedschaft in der SPD war Degenhardt nun endgültig parteilos. Dem scharfen Vorgehen der Spitze der regierenden Partei gegen die Linksentwicklung im Innern (und namentlich bei den Jusos) folgte wenige Monate später mit den gegen die DKP zielenden antidemokratischen „Berufsverboten“ („Radikalenerlass“, verabschiedet von den Ministerpräsidenten der Länder gegen „Radikale im Öffentlichen Dienst“ am 28. Januar 1972) eine in Europa einzigartige, weitere Unterdrückungsmaßnahme, die Tausende zu Opfern des Kalten Kriegs im Westen machte, die „keine Gewähr dafür bieten, jederzeit voll einzutreten für den nationalen Staat beziehungsweise die freiheitlich-demokratische Grundordnung“. Dabei bestand ihre besondere Wirkung in der Disziplinierung von weiteren Abertausenden über den ganzen Zeitraum ihres Bestehens von 1972 bis 1976 hinweg, in dem es zur Überprüfung von 1,4 Millionen Personen kam.
Gegen die Berufsverbote schrieb Degenhardt selbst das Lied „Belehrung nach Punkten“, in dem er das Gesetz in „eine lange Tradition“ stellte, „ausgehend von den Karlsbader Beschlüssen 1819 (…) über die preußische Notverordnung von 1849 (und) die Sozialistengesetze von 1878 (…) bis zu den Berufsverboten von 1933“. Ihm selbst konnte der Radikalenerlass nichts anhaben, denn er war ja jetzt Freiberufler.

An dem Vorwurf der mangelnden Rechtmäßigkeit des Verfahrens hielt Degenhardt bis zuletzt fest. Zwei Jahre nach seinem Ausschluss urteilte er (damit auch die Verteidigungsstrategie im Berufungsverfahren wiederholend): Beim „Rausschmiss aus der SPD (wurde) ganz formal argumentiert: wenn ein Parteimitglied zur Wahl einer anderen Partei aufruft, dann gehört er ausgeschlossen. Aber das ist ja gar nicht so sicher. Die SPD hatte (im hessischen Landtagswahlkampf; IS) ja aufgerufen, fast öffentlich, die Zweitstimme der FDP zu geben, einer anderen Partei. Und die Leute, die das taten, wurden nicht nur nicht aus der Partei ausgeschlossen, sondern sie wurden sogar noch belobigt. Nun wollte ich doch einmal, als ein alter Anhänger eines großen Volksfrontbündnisses, sagen: da kann man ja auch einmal eine Arbeiterpartei zur Wahl stellen. Und siehe da: Ich wurde rausgeworfen. (Mein allgemeiner Aufruf) war so, dass ich sagte, für eine Partei der Werktätigen wie die SPD müsste als Koalitionspartner die kommunistische Partei in Frage kommen, wir müssen die kommunistische Partei deshalb stärken; damit auch stärken (wir) den linken Flügel der SPD.“
Mit den Auswirkungen des Rauswurfs auf ihn selbst setzte sich Degenhardt in dem Lied „40“ auseinander, das wohl im Dezember 1971 geschrieben und im Jahr danach aufgenommen wurde. Dieses Lied ist von daher interessant, weil es eine Art Halbzeitbilanz seines bisherigen Lebens zieht und das Gewesene resümiert. Der Ausschluss steht dabei auch stellvertretend für einen Point of no-return, stilistisch umgesetzt durch die Struktur des Liedes, deren Strophen in Moll und (damit) im alten melancholischen Duktus seiner Frühphase vorgetragen werden. Dabei heißt es in der ersten Strophe: „Nun bin ich vierzig Jahre alt / Und hab mir oft den Mund verbrannt / Und wurde noch dafür bezahlt / Und das war meistens allerhand. / Und rausgeschmissen hat man mich / Aus Schule, Kirche, SPD. / Ich hab gelacht und jämmerlich / Geflucht, denn manchmal tat das weh.“ Danach reißt Degenhardt allerdings das Steuer herum und lässt einen Refrain in Dur folgen, in dem es dann betont-kämpferisch und die alte Melancholie der Frühphase zurücklassend weitergeht: „Aber klagen will ich nicht, / Aber klagen will ich nicht. / Nein, den Gefallen tu‘ ich mir nicht gern. / Das wollen wir, das müssen wir, / Das werden wir schon ändern.“ 1978 trat Degenhardt der DKP formell bei.
Und doch änderte der Parteiausschluss und der DKP-Beitritt nichts daran, dass Degenhardt analog zum Volksfrontgedanken den Kontakt zu seinen alten Freunden bei der SPD-Linken weiter aufrechterhielt, zu denen auch der Politiker und Kabarettist Jochen Steffen (1922 bis 1987) gehörte. Es ist sogar noch eine Episode bezeugt, dass er noch 2001, das heißt lange nach der neoliberalen Wende der Dritt-Wegs-SPD, zusammen mit seinem Sohn Kai und nebst Hannes Wader auf dem 70. Geburtstag des ehemaligen SPD-Stamokaplers Egon Kuhn auftrat, womit er pikanterweise auch einen Mann zwang, sich seine kommunistischen Lieder anzuhören und sich seiner zu erinnern, der einer derjenigen Parteikarrieristen war, die von den Ausschlussverfahren gegen Parteilinke maßgeblich profitiert hatten: Bundeskanzler Gerhard Schröder.


![UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis] UZ Probe-Abo [6 Wochen Gratis]](https://www.unsere-zeit.de/wp-content/uploads/2021/04/Banner_800x90_Probeabo_Rahmen.jpg)