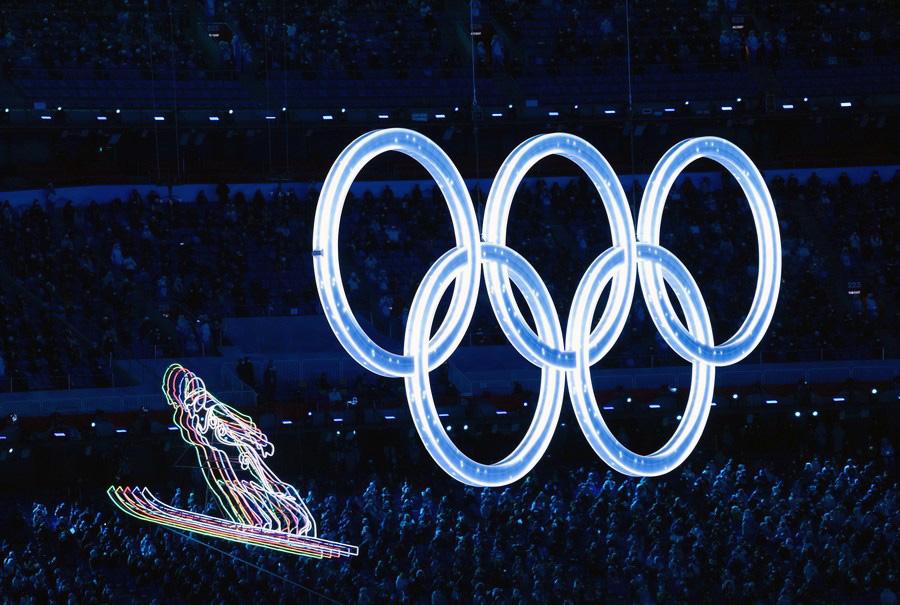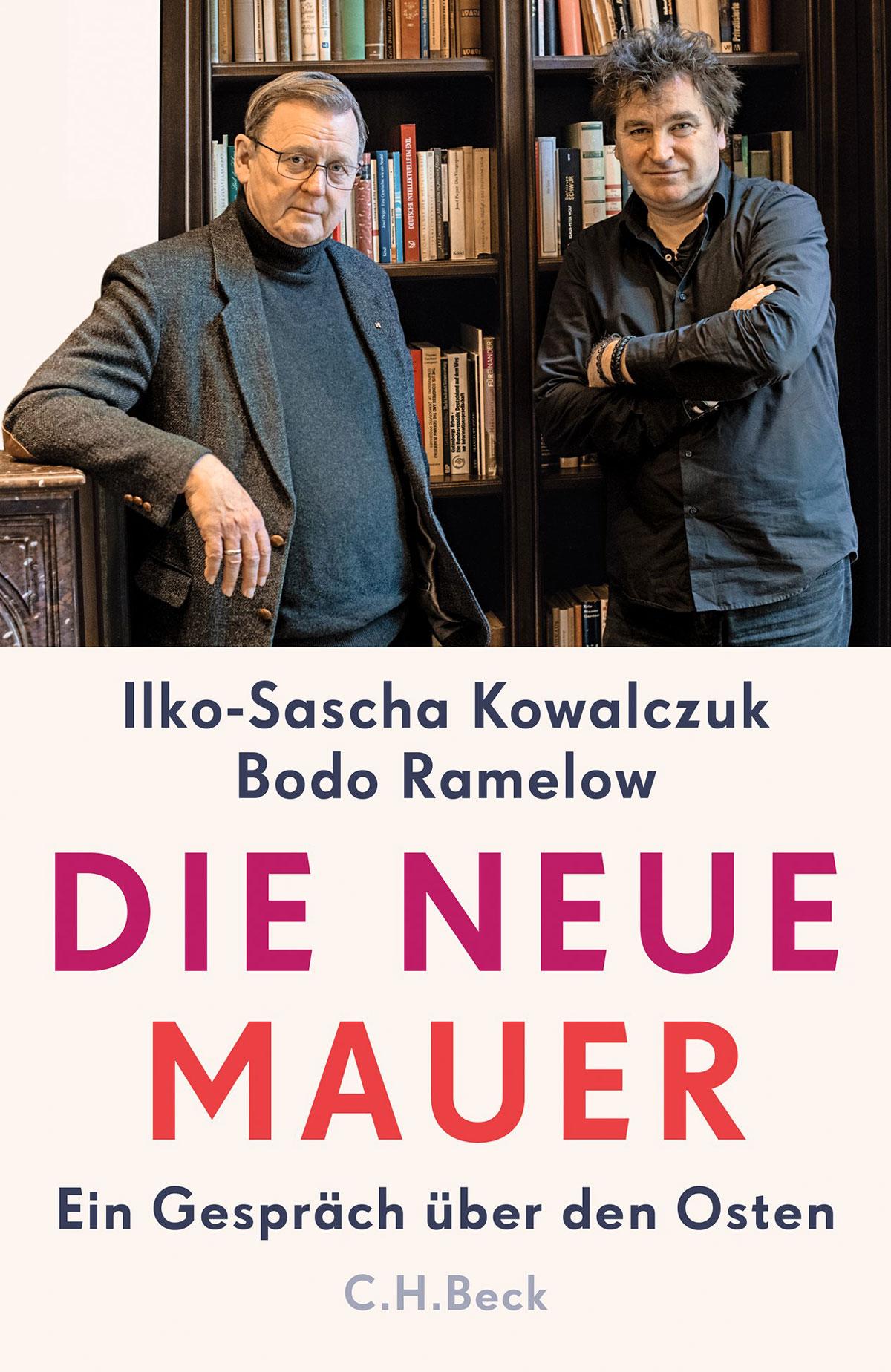Deptford im Frühjahr 1740: Auf der Werft liegt die „HMS Wager“, nicht gerade der Stolz der britischen Marine, eher ein „37,50 Meter langer Schandfleck der Meere“. Monatelang haben die Zimmerleute daran gearbeitet, den ehemaligen Ostindien-Frachter in ein Kriegsschiff zu verwandeln. Denn für die „Wager“ gibt es große Pläne. Möglichst bald soll der „Bastard der Flotte“ in See stechen, um den verhassten Spaniern einen empfindlichen Schlag zu versetzen.
Zusammen mit vier anderen Schiffen soll die „Wager“ Kurs auf Brasilien nehmen, die südamerikanische Küste hinuntersegeln und den Kontinent am gefürchteten Kap Hoorn umrunden, um einen Überraschungsangriff auf die spanischen Kolonien zu starten und vor der Küste Chiles eine (so hofft man) unbegleitete und mit Schätzen überladene Galeone abzufangen. Dafür muss das kleine Geschwader lediglich den Kontakt zur übermächtigen spanischen Flotte vermeiden. Was soll schief gehen?
Schon Titel und Untertitel von David Granns Buch „Der Untergang der Wager. Eine wahre Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei“ verraten, dass eine ganze Menge schiefgehen wird. Noch bevor die Schiffe auslaufen können, befällt das Fleckfieber die Mannschaften. Unzählige Matrosen müssen an Land gebracht oder ausgetauscht werden. Ein schwieriges Unterfangen. Denn obwohl das britische Empire die spanische Krone vollmundig in einen Krieg um die Vorherrschaft über die amerikanischen Kolonien und den damit verbundenen Welthandel verwickelt hat, ist die Royal Navy schlecht vorbereitet. Eine Wehrpflicht gibt es nicht, ausgebildete Marinematrosen sind Mangelware. Also machen Schlägertrupps die Häfen unsicher, sammeln alle ein, die für Seeleute gehalten werden, und schleppen sie auf die schwimmenden Festungen.
„Wer es einrichten kann, ins Gefängnis zu kommen, wird nicht Seemann, denn auf einem Schiff ist es genau wie im Gefängnis, nur dass man Gefahr läuft zu ertrinken“, zitiert Grann den zeitgenössischen Schriftsteller Samuel Johnson. Nicht nur Seuchen, Spanier und Stürme machen der Crew zu schaffen, auch das strenge Regiment des britischen Militärs, das allgegenwärtige Ungeziefer und die extrem engen Verhältnisse der „Welt aus Holz“ werden zur unerträglichen Belastungsprobe.
Grann beschreibt nicht nur das Leben auf den Schiffen detailreich und wortgewandt, er liefert auch geschickt eingeflochtene Hintergrundinformationen über die Seefahrt des 18. Jahrhunderts. So erfahren die Leserinnen und Leser einiges über die Berufswelt der Seeleute, warum sprichwörtlich schon mal „ein Auge zugedrückt“ wird und mit welchen Herausforderungen ein Navigator zu kämpfen hat, der seine Position ohne verlässliche Uhren bestimmen soll.
Größter Trumpf des Buches sind jedoch die zahlreichen Zitate aus den Aufzeichnungen der beteiligten Offiziere. So lernen wir den adligen Fähnrich John Byron kennen, der es dank unvorteilhafter Erbfolge nicht zum Lord geschafft hat, aber eines Tages einen berühmten Enkel mit diesem Titel haben wird. Byron heuert mit gerade einmal 16 Jahren an und schlägt die prestigeträchtige Offizierslaufbahn ein, bevor ihn die „Wager“ mit der teerverschmierten Realität des Seemannslebens vertraut macht. Von anderem Schlag ist John Bulkeley, der als Stückmeister der „Wager“ für die Instandhaltung der Kanonen verantwortlich ist und über jahrelange Erfahrung auf See verfügt. Und auch David Cheap, der die Reise als Oberleutnant antritt, dann aber als Kapitän auf der „Wager“ landet, kommt zu Wort.
Alle drei schreiben aus der Sicht der britischen Kolonialherren, die in den Krieg ziehen, um die „Zivilisation“ zu verbreiten. Doch ihre Mission scheitert, bevor sie auch nur einen Schuss abgeben. Die von Krankheiten dezimierte Mannschaft hat den unberechenbaren Wellen und Stürmen vor Kap Hoorn nichts entgegenzusetzen. Die stark beschädigte „Wager“ muss eine Bucht vor der Küste Patagoniens ansteuern, wo sie auf Grund läuft.
Nach der Strandung wird die weltumspannende Abenteuererzählung zum Kammerspiel. Denn der Raum auf Wager-Island, wie die unglücklichen Matrosen ihre neue unwirtliche Heimat taufen, ist begrenzt. Entschlossene Charaktere treffen auf das, was Hunger, Krankheit und Verzweiflung aus Menschen machen. In ihrer wachsenden Not verabschieden sich die „Ehrenmänner“ vom geschönten Selbstbild. Das Elend verdrängt Menschlichkeit, Kameradschaft und Disziplin. Bald schon spalten sich Fraktionen ab, es kommt zu Meutereien – nicht immer ist absehbar, wer auf wen losgehen wird. Klar ist nur, dass alle Überlebenden vor dem Kriegsgericht landen werden – sollten die wahnwitzigen Rückreisepläne der unterschiedlichen Grüppchen gelingen.
David Grann fängt dieses Durcheinander gekonnt ein, stellt die unterschiedlichen Sichtweisen gegenüber, folgt den Spuren seiner Protagonisten. So entsteht eine mitreißende Mischung aus Abenteuerroman und Sachbuch, garniert mit zahlreichen Literatur- und Quellenhinweisen. Grann arbeitet die Geschichte der „Wager“ kritisch auf, ohne sich politisch allzu weit aus dem Fenster zu lehnen. Wenn vielleicht auch unabsichtlich, fallen die Parallelen zur Gegenwart auf – von der Zwangsrekrutierung der unglückseligen Seesoldaten über die Entmenschlichung der Kolonisierten bis zur hochmoralischen Begründung eines Krieges, der nur einer kleinen Elite von Überseehändlern dient.
Vor allem räumt „Der Untergang der Wager“ aber mit Überheblichkeit auf. Nicht nur die Matrosen müssen lernen, dass ihnen ihr Herrenmenschentum mehr schadet als nützt, wenn sie halbverhungert auf einen hilfsbereiten Nomadenstamm treffen, die indigenen Einwohner Patagoniens dann aber mit ihrem arroganten Gezänk vergraulen. Auch den Lesern bleibt die Besserwisserei im Halse stecken. Zwar möchte man schreien, weil die akut von Skorbut bedrohte, aber ahnungslose Besatzung die vitaminreichen Zitrusfrüchte Brasiliens ignoriert. Doch spätestens wenn man verfolgt, wie die völlig erschöpften Matrosen einen heillos überladenen Kahn ohne Karte und mit gebrochenem Ruder durch die Magellanstraße navigieren, ahnt man, dass der eigene Wissensvorsprung Grenzen hat.
David Grann
Der Untergang der Wager: Eine wahre Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei
Penguin Verlag, 432 Seiten, 17 Euro