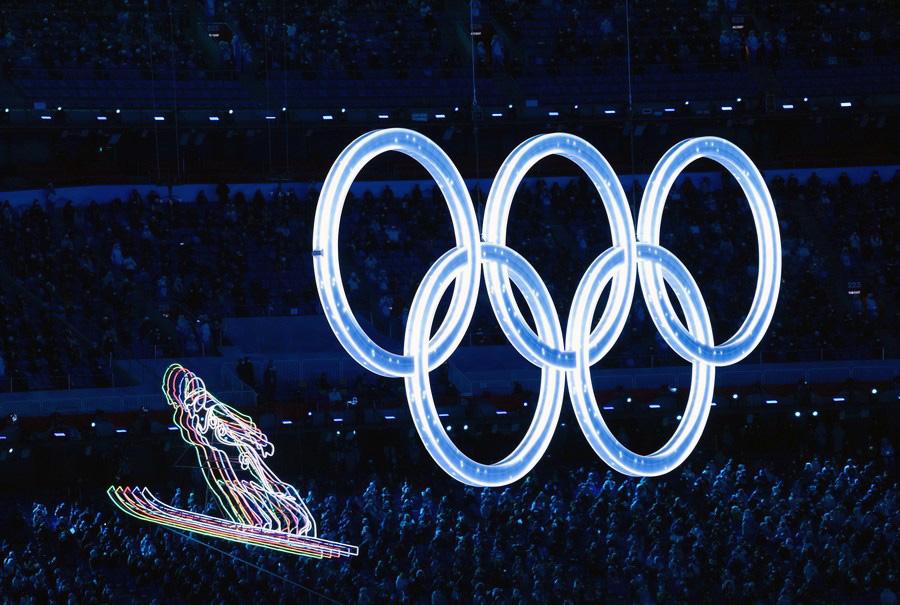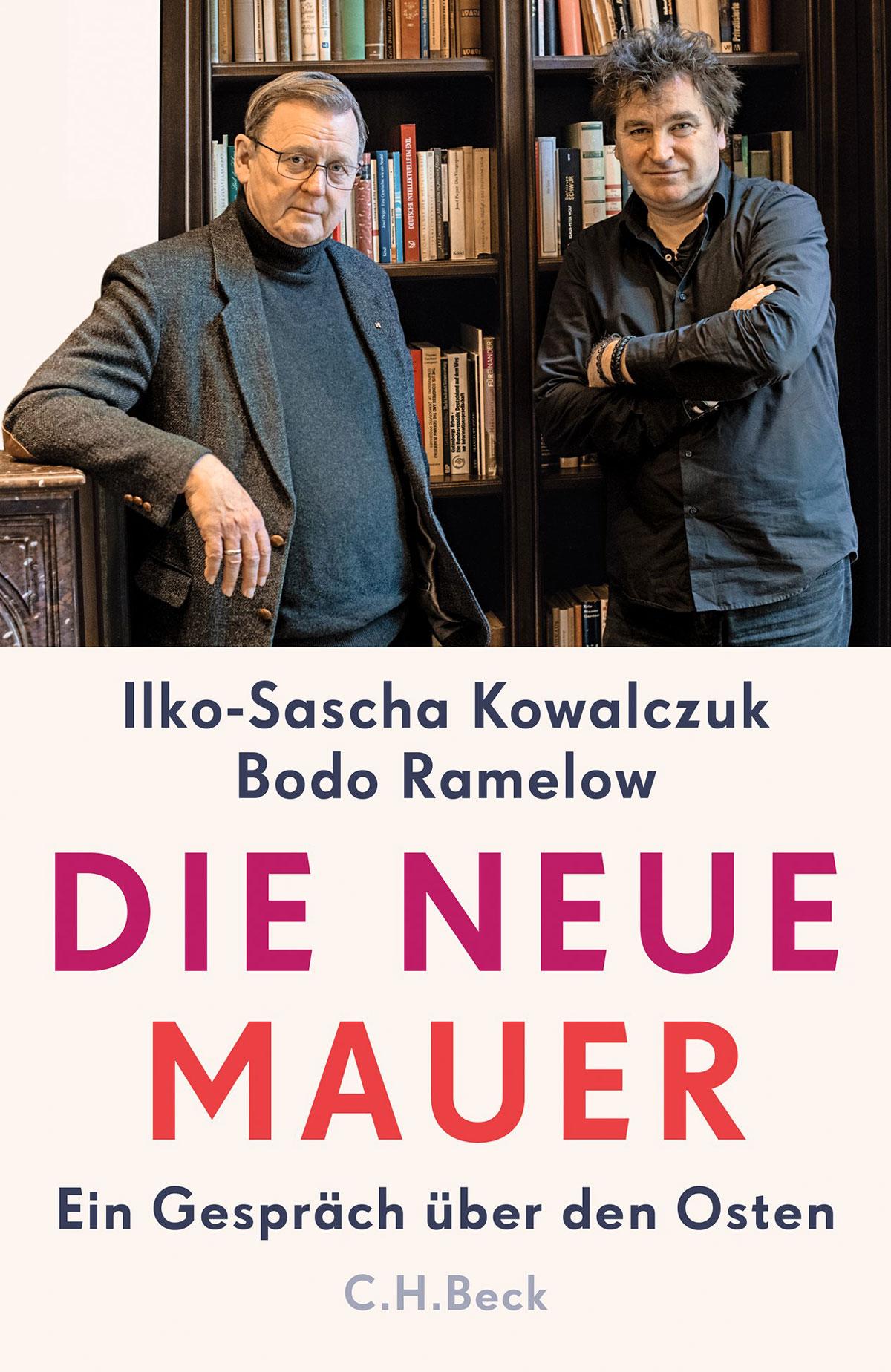Ueckermünde liegt kurz vor der polnischen Grenze und am Stettiner Haff. Es verdankt seinen Namen der Uecker. Allerdings heißt das keine hundert Kilometer lange Flüsschen nur in Mecklenburg-Vorpommern so. Jenem Teil in Brandenburg, wo das Gewässer in der Uckermark seinen Ausgang nimmt, fehlt das E auf der Landkarte, also Ucker. Dort siedelten einst die Ukrer, ein slawischer Volksstamm, auf dessen frühere Anwesenheit ein braunes Schild an der A 20 verweist: Ukranenland. Das stand übrigens schon vorm Ukraine-Krieg dort, hat also nichts damit zu tun – dies nur als Hinweis für die Durchreisenden nach Lübeck.
Die Schreibweise ist nicht das einzige Kuriosum der einstigen DDR-Kreisstadt. Ein anderes bietet das Ortsschild. „Seebad Stadt Ueckermünde“ steht dort, obwohl das Haff nicht die Ostsee ist. Aber vor hundert Jahren gründeten Anwohner einen „gemeinnützigen Badeverein“ zur Aufwertung der Stadt, und schon 2013 führte deren Engagement zum Erfolg. Inzwischen sind Tourismus und Kurbetrieb der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Region, nachdem reihenweise die meisten Betriebe nach 1990 schlossen – Gießereien, Fischereibetriebe, die letzte von einst fünfzig Ziegeleien machte 1997 dicht. Der Umstand, dass mit Millionen aus dem Topf der Städtebauförderung die im April 1945 kampflos an die Rote Armee übergebene Kleinstadt wahrlich ansehenswert restauriert wurde, kann kaum den wirtschaftlichen Niedergang überdecken. Ein Viertel der zu DDR-Zeiten hier lebenden rund zwölftausend Menschen ist weg, weg wie etliche Wohnbauten aus jener Zeit, weil man sie nicht mehr brauchte.
Zwei Türme recken sich in den Stadthimmel: der aktuell eingerüstete Kirchturm von St. Marien und der wuchtige Schlossturm. Das Schloss der Pommernherzöge selbst kam bis auf Reste vor einigen hundert Jahren abhanden, weil man Baumaterial für niedergebrannte Häuser brauchte. Im wuchtigen Turm gibt es das Haffmuseum, das ein engagierter Mann führt. Michael Baudner ist gelernter Maschinenbauer, also nicht unbedingt vom Fach, aber voller Leidenschaft sowohl für sein Museum als auch für die Region. Und randvoll mit Sorge um die Zukunft der Einrichtung, denn auch über dieser schwebt der Rotstift als Damoklesschwert. Und außerdem will der parteilose Bürgermeister im kommenden Jahr nicht mehr antreten, in diesen Zeiten Kommunalpolitiker zu sein ist der Gesundheit wenig zuträglich. Neben der AfD ist keine etablierte Partei im Stadtparlament mehr vertreten, es gibt dort nur noch Bürgerbünde und Bündnisse.
Unweit des Schlosses in der Schul-straße hatte Klaus Parche seine Galerie. Der Maler und Grafiker aus Leipzig lebte und arbeitete seit 1981 in der Region, im Juli 2024 ist er wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag verstorben. Der gebürtige Leipziger hatte in der DDR einen Maschinenschlosserlehre absolviert, später an der Fachschule für angewandte Kunst in Leipzig studiert und als angestellter Gebrauchsgrafiker für die Deutsche Werbe- und Anzeigengesellschaft (DEWAG), einem Parteibetrieb, in der Messestadt gearbeitet. Nachdem er Mitglied des Verbandes Bildender Künstler der DDR geworden war und von seiner Kunst leben konnte, zog er in den äußersten Nordosten des Landes, wo schon im Dorfnamen die Abgeschiedenheit sichtbar wurde: Hintersee. Die NVA-Soldaten, die im nahegelegenen Eggesin dienten, sprachen vom „Land der drei Meere“: Waldmeer, Sandmeer, gar nichts mehr.
Parche war zu DDR-Zeiten nie sonderlich politisch aktiv gewesen. Er wurde es durch die Umstände. Erst der wirtschaftliche Niedergang nach der Einheit, dann der Krieg im Kosovo mit deutscher Beteiligung, die Gemetzel im Irak, in Afghanistan, im Nahen Osten … Er begann eigene Kriegserfahrungen zu verarbeiten, die er als Kind gemacht hatte. Er ritzte seinen Hass auf den Imperialismus, auf Kriegsgewinnler und Menschenschlächter in Kupferplatten. Sehr parteilich und plakativ, er war schließlich studierter Gebrauchsgrafiker. Aber in einer Zeit der Täuschung und Verschleierung ist eine klare Ansage nötig. Deshalb arbeitete er jahrelang auch für den „RotFuchs“, die Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke.
Das Haffmuseum hat von Parches Lebensgefährtin Marika Hanske den Nachlass übernommen. Baudner ist dabei, die Bilder und Druckgrafiken zu sichten und zu inventarisieren. Einen Teil zeigt er bereits in einer Sonderausstellung, die bis zum September im Turm zu sehen ist. Wie die meisten bildenden Künstler hat auch Parche nie Buch geführt, wem er Bilder verkauft oder geschenkt hat, und nicht jedes Werk hat er auch signiert. Insofern hat Baudner noch eine Menge Arbeit vor sich. Ein Antikapitalismus-Gemälde, das im Greifen-Gymnasium Ueckermünde hing, konnte inzwischen jedoch Parche eindeutig zugeschrieben werden. Er schenkte es der Schule, als diese von einem Schüler namens Philipp Amthor besucht wurde.
Klaus Parche
Malerei und Druckgrafik
Sonderausstellung im Haffmuseum in Ueckermünde, Am Rathaus 3
Geöffnet täglich (außer Montag) von 10 bis 17 Uhr