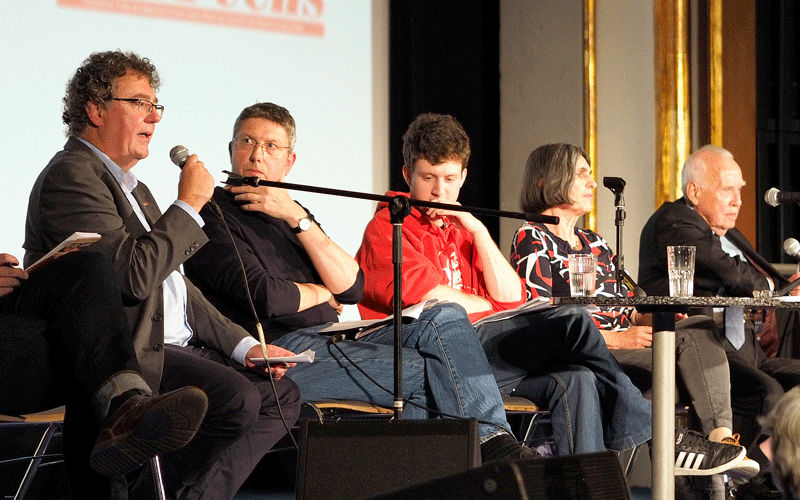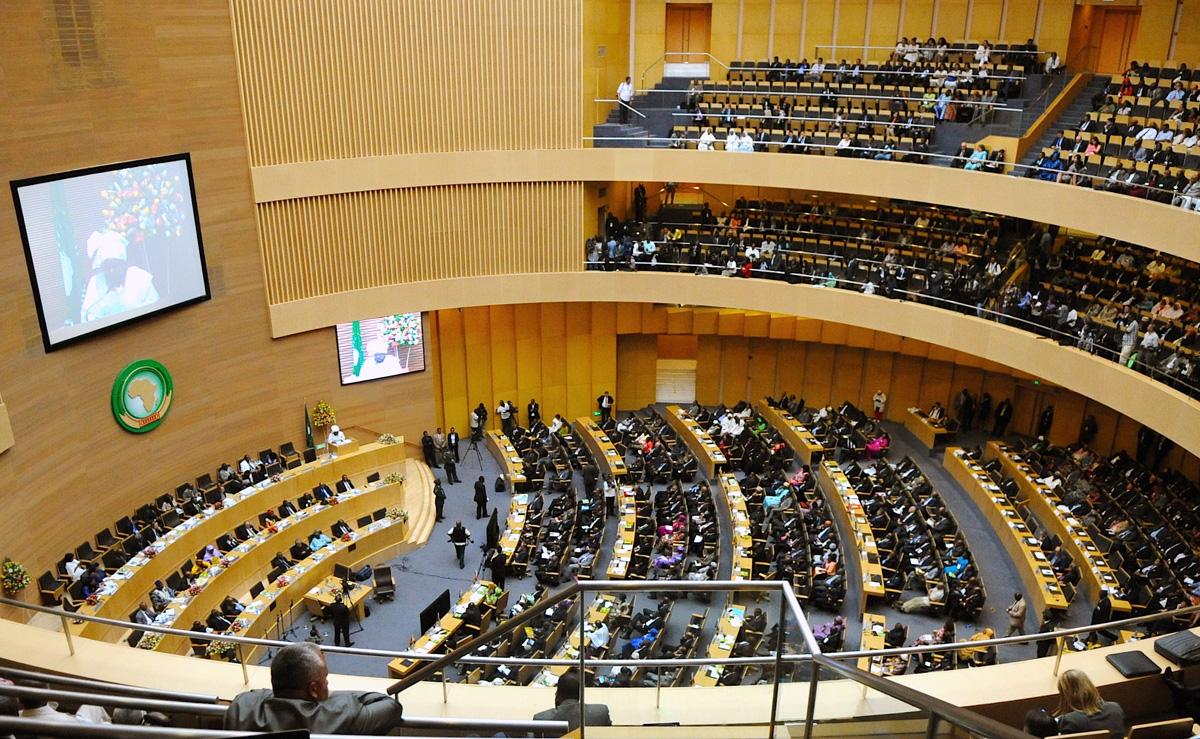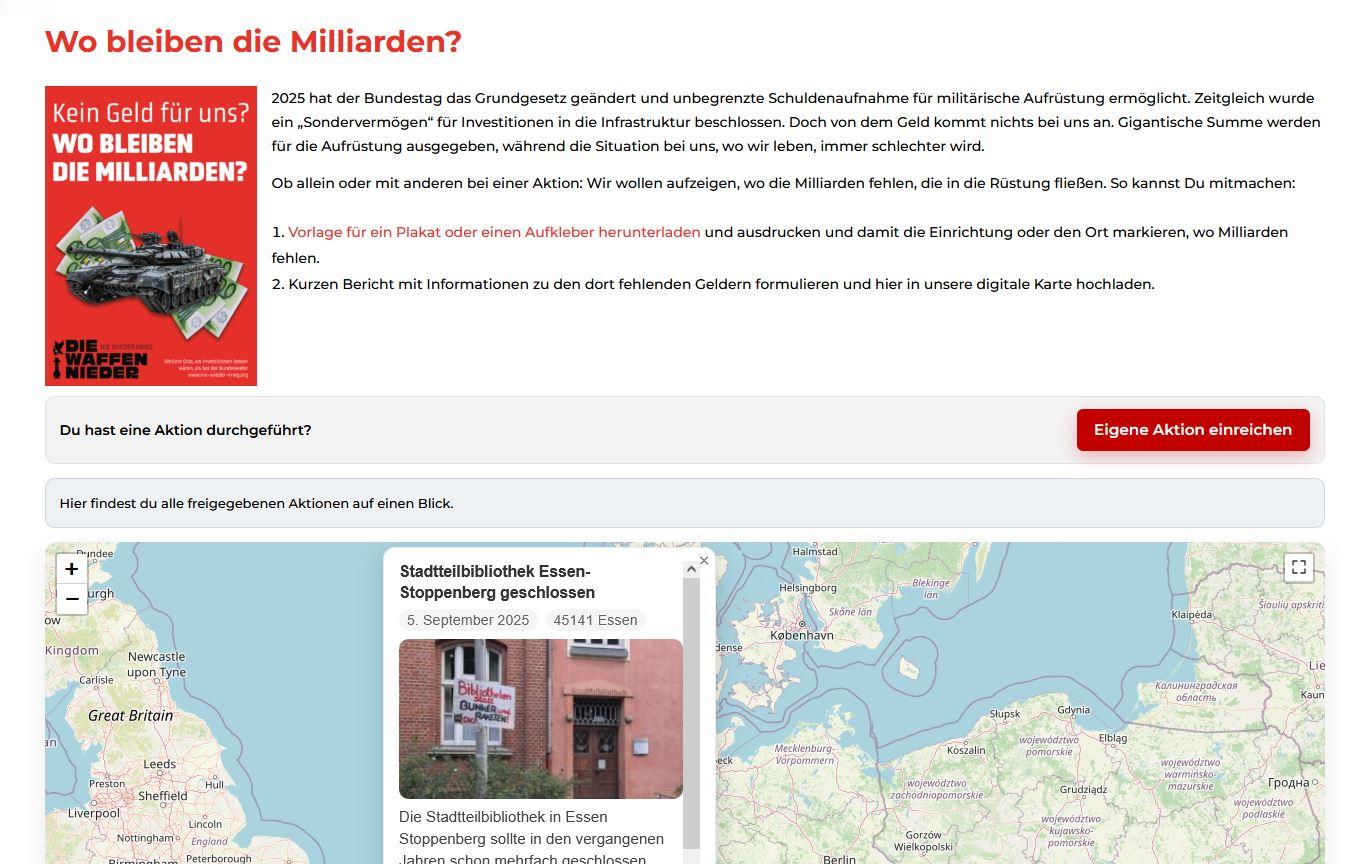Der Kurs der Kommunistischen Partei Chinas unter der Führung von Xi Jinping ist allgemein bekannt als „Sozialismus chinesischer Prägung“, häufig verbunden mit dem Begriff der „sozialistischen Marktwirtschaft“. Hierbei geht es darum, Innovations- und Fortschrittsimpulse für die chinesische Ökonomie durch die großzügige Zulassung sowohl chinesischer als auch ausländischer privater Unternehmertätigkeit zu gewinnen. An der zentralen, führenden Stellung des Gemeineigentums und einer makroökonomischen Planung wird allerdings festgehalten. Die Erfolge dieser Orientierung können sich sehen lassen: Lebten 1990 noch 61 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, so lag die Quote 2016 bei 4 Prozent (Quelle: faz.net).
Dennoch ist die Wirtschaftspolitik der KPCh gerade in Deutschland stark umstritten. In weiten Teilen der Linken hierzulande gehört es zum guten Ton, die Entwicklung in China mit dem Schlagwort „kapitalistische Restauration“ abzuqualifizieren. Viel weiter geht die Diskussion oft nicht. Eine tiefer gehende Beschäftigung mit den nationalen Besonderheiten Chinas und mit der Landesgeschichte scheint so manchem überflüssig.
Nun könnte man einwenden, wie es denn möglich ist, dass China im Bereich der Armutsbekämpfung die genannten großartigen und von den zuständigen Gremien der UNO als vorbildlich gelobten Fortschritte erzielt, wenn es sich bei der chinesische Ökonomie doch schlicht um „Kapitalismus“ handelt. Andere (zweifellos kapitalistische) Entwicklungsländer bleiben hinter dieser Entwicklung zurück. Sollte dies nicht zu denken geben? Der Gedanke liegt nahe, dass China doch „irgendetwas anders macht“. Offenbar wird die Bedeutung der nach wie vor gegebenen staatlichen Wirtschaftslenkung in China von vielen westlichen Beobachtern unterschätzt. Es ist schwer vorstellbar, dass die erzielten sozialen Erfolge unter den Bedingungen eines gänzlich freien Marktes zu realisieren gewesen wären. Der internationale Vergleich ist hier sehr aussagekräftig.
Die Volksrepublik China steht vor Aufgaben, die in der Menschheitsgeschichte ihresgleichen suchen. Insoweit kann sie nicht auf in der Vergangenheit bereits erprobte Rezepte zurückgreifen. Ganz ohne Vorbild ist der Kurs der KPCh dennoch nicht. Es ist bereits gelegentlich in vergleichender Weise auf die Neue Ökonomische Politik (NÖP) hingewiesen worden, die ab 1921 unter Lenins Führung in der Sowjetunion praktiziert wurde. Auch hier ging es um die kontrollierte Zulassung von privatem Kapital, um eine Initialzündung für eine veraltete und zerstörte Volkswirtschaft zu gewinnen.
Aber auch die Theorieentwicklung innerhalb der KPCh bot in ihren frühen Jahren Anknüpfungspunkte für die heutige Orientierung, die allerdings in der deutschen China-Diskussion wenig Beachtung finden.
Es ist in diesem Zusammenhang interessant, die Arbeit von Mao Tse Tung „Über die Neue Demokratie“ aus dem Jahre 1940 zu studieren. Mao geht hier davon aus, dass China noch in so starkem Maße kolonial und feudal geprägt ist, dass ein unmittelbarer Übergang zum Sozialismus nicht vorstellbar ist. Er wendet sich ausführlich den nationalen Besonderheiten seines Heimatlandes zu und weist bezüglich der revolutionären Perspektive „linke Phrasendrescherei“ in scharfen Worten zurück. Mao zufolge muss die chinesische Revolution zunächst eine demokratische und dann eine sozialistische Phase durchlaufen. Im unterentwickelten China war bislang keine starke Bourgeoisie aufgetreten, die, ähnlich wie in Europa, die Aufgaben einer bürgerlich-demokratischen Revolution hätte lösen können. Diese „liegengebliebenen“ Aufgaben müssen nun in anderer Weise bewältigt werden. 1940 sieht Mao die Zeit gekommen für die Errichtung einer „Neuen Demokratie“, in der die Arbeiterklasse und die Kommunistische Partei die führende Rolle spielen, aber beruhend auf einem Bündnis aus den vier revolutionären Klassen Arbeiter, Bauern, Kleinbürgertum und „nationaler Bourgeoisie“. Der Begriff einer „nationalen Bourgeoisie“ wird eventuell Irritation hervorrufen. Dazu muss erklärt werden, dass Mao im kolonial bzw. halbkolonial unterdrückten China die Bourgeoisie gespalten sieht in einen nationalen Flügel, welcher die Befreiung des Landes von äußerer Unterdrückung wünscht und in die Kompradoren-Bourgeoisie, welche ideologisch und existentiell mit den imperialistischen Großmächten verbunden ist und somit notwendigerweise als Feind der nationalen Befreiung auftreten muss. Die nationale Bourgeoisie ist hinsichtlich des Verhältnisses zu den ausländischen Unterdrückern grundsätzlich revolutionär. Warum spricht Mao aber von „Neuer Demokratie“? Er legt Wert auf den Unterschied zu demokratischen Revolutionen „alten Typs“, deren Ergebnis lediglich die Machtkonsolidierung der bürgerlichen Klasse war. Die neu-demokratische Revolution dagegen ist Bestandteil eines progressiven Prozesses, welcher im weiteren Verlauf zur sozialistischen Revolution führt. Interessant sind Maos Ausführungen zur Wirtschaft unter neu-demokratischen Bedingungen. Die großen Monopole sind in öffentliches Eigentum zu überführen. Eine allgemeine Enteignung der Kapitalisten ist aber nicht vorgesehen. Vielmehr soll verhindert werden, dass Kapitalisten „die Lebenshaltung der Nation kontrollieren“. Es empfiehlt sich, den Text zur Neuen Demokratie zusammen mit Maos Arbeiten „Zur Frage der Nationalen Bourgeoisie“ (1948) und „Über die demokratische Diktatur des Volks“ (1949) zu lesen, wo er seine Konzeption des zu errichtenden Staates weiter ausführt.
1949 wurde die Volksrepublik China gegründet. Die Flagge des Staates zeigt bis heute einen großen, die führende Partei darstellenden Stern und rechts davon die vier genannten revolutionären Klassen. Allerdings kündigte sich mit dem Jahr 1952 eine neue Orientierung an hin zur beschleunigten Entwicklung einer sozialistischen Ökonomie. Es wurden Modernisierungsvorstellungen vorherrschend, die dem Entwicklungsstand des Landes nicht angemessen waren und in Gestalt des „Großen Sprungs nach vorn“ verheerende Ergebnisse zeitigten. 1940 hatte Mao für die Phase der Neuen Demokratie noch eine „ziemlich lange Zeit“ vorhergesagt. Betrachtet man die Entwicklung ab 1952, so entsteht der Eindruck einer voluntaristisch inspirierten Verkürzung notwendiger Entwicklungsstufen, die letztlich das zurück wirft, was sie voranbringen soll. Übrigens hat man dem Autor der „Neuen Demokratie“ nach der Veröffentlichung des Werkes weder Revisionismus noch Verrat am Sozialismus vorgeworfen. Denn er hatte sich nicht als pedantischer Dogmatiker gezeigt, sondern als Theoretiker, der den Marxismus-Leninismus auf die Verhältnisse Chinas anwendet. Durch die Reformpolitik der KPCh ab 1978 haben Mao Tse Tungs frühe Überlegungen neue Aktualität gewonnen.
Erik Höhne