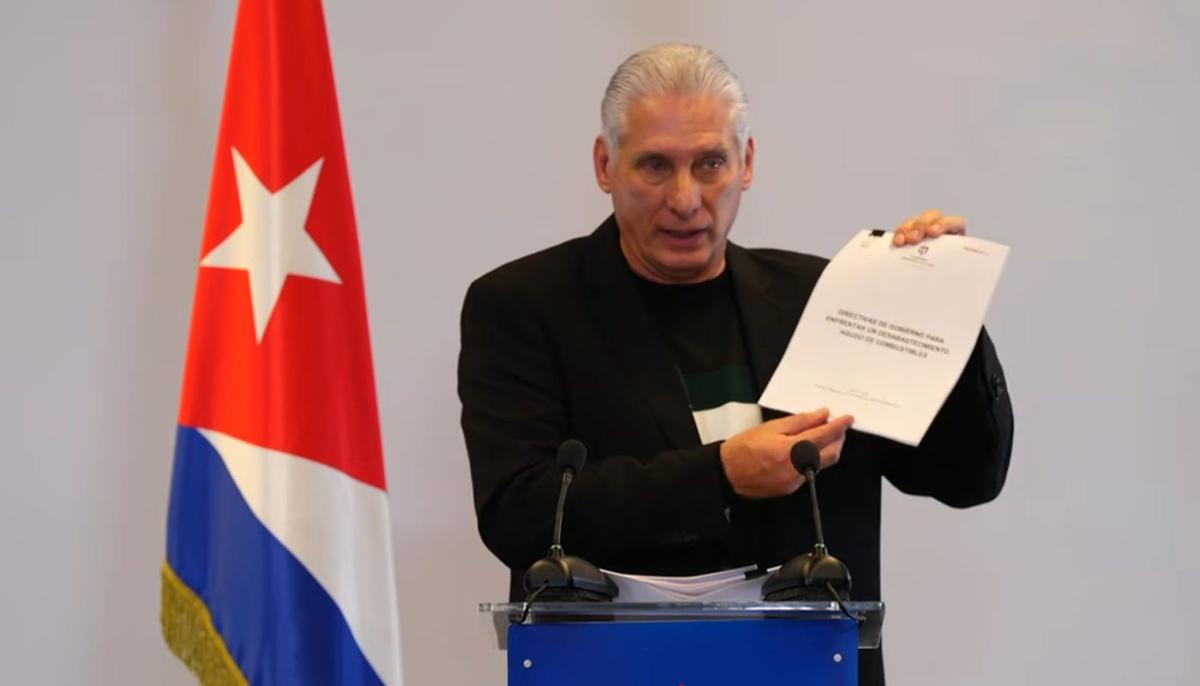Die Fédération Internationale des Résistants (FIR) erinnert an die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki heute vor 50 Jahren:
In Zeiten, in denen nicht nur in Europa die Fähigkeit zur Diplomatie und zur nicht-militärischen Konfliktlösung scheinbar verloren gegangen ist, erinnert die FIR als Botschafterin des Friedens der Vereinten Nationen daran, dass selbst in der Phase des Kalten Krieges und der Block-Konfrontation Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen und politischer Zielvorstellungen im Sinne der gemeinsamen Sicherheitsinteressen und einer gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit Verträge abschließen konnten.
Der Weg zu dieser Vereinbarung war vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sich in den Machtzentren der Welt die Erkenntnis durchsetzte, dass nur mit der Anerkennung des Status quo ein Weg aus Blockkonfrontation und Hochrüstung möglich wird. Während in der alten BRD noch bis Anfang der 1970er Jahre von einflussreichen revanchistischen Kräften Gebietsforderungen im Osten – als Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs – erhoben wurden, setzte sich bei den Regierungen der westlichen Staaten die Erkenntnis durch, dass mit militärischen Machtmitteln die sozialistische Staatengemeinschaft nicht zu überwinden sei. Man setzte, aus Eigeninteresse an preiswerten Rohstoffen und Energieträgern, auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und „Wandel durch Annäherung“, wie das politische Konzept in der BRD genannt wurde.
Für die osteuropäischen Staaten, insbesondere die DDR, die VR Polen und die CSSR, ging es um eine vertragliche Bestätigung der seit der Potsdamer Konferenz bestehenden staatlichen Grenzen und um eine Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der jeweiligen Staaten.
Da solche Interessen international, zwischenstaatlich und innenpolitisch in den jeweiligen Staaten recht kompliziert durchzusetzen waren, bedurfte es knapp zweijähriger Verhandlungen in Genf, vom 18. September 1973 bis 21. Juli 1975, bevor das Dokument, das als KSZE-Schlussakte bezeichnet wird, am 1. August 1975 in Helsinki unterschrieben werden konnte. Die unterzeichnenden Staaten verpflichteten sich in dieser Erklärung zur Unverletzlichkeit der Grenzen, zur friedlichen Regelung von Streitfällen, zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten sowie zur Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Außerdem wurde eine Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Umwelt vereinbart. In Folgekonferenzen sollte die Umsetzung der KSZE-Schlussakte überprüft werden.
Während die osteuropäischen Staaten insbesondere die Vereinbarungen zur territorialen Regelung als Erfolg feierten, betonten die westlichen Staaten, dass sie im „Korb 3“ Aussagen zur Achtung der Menschenrechte, der Glaubens-, Informations- und Meinungsfreiheit durchsetzen konnten. Diese Aussagen wurden in den folgenden Jahren immer wieder als Hebel in der ideologischen Auseinandersetzung zwischen Ost und West eingesetzt.
Auch vertrauensbildende Maßnahmen wurden in die Schlussakte aufgenommen. Hierzu gehörte die Ankündigung von Manövern ab 25.000 Soldaten mindestens 21 Tage im Voraus und die Einladung von Beobachtern zu solchen Manövern. Nicht Gegenstand der KSZE-Verhandlungen waren konkrete Abrüstungsvereinbarungen.
Was heute längst in Vergessenheit geraten ist, war der Vorschlag, zu Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum – analog zu dem Motto: „Die Ostsee muss ein Meer des Friedens sein!“ – eine weitere Konferenz einzuberufen, zu der die nicht-europäischen Mittelmeeranrainer Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten und Israel eingeladen werden sollten. Interessanterweise wurden Libyen und Libanon nicht in der Liste genannt. Zu dieser Konferenz kam es jedoch nicht.
Völkerrechtlich ist die KSZE-Schlussakte im eigentlichen Sinne kein Vertrag, sondern eine Selbstverpflichtung aller beteiligten Staaten. Daher gab es bei Verstößen gegen die in der Schlussakte formulierten Regelungen keine Sanktionsmechanismen. Stattdessen sollten Folgekonferenzen in Belgrad, Madrid, Stockholm – wo es unter anderem um konkrete Abrüstungsmaßnahmen gehen sollte –, Wien, Paris und Helsinki Fortschritte in der gemeinsamen Arbeit besprechen. Erst auf der Tagung 1994 in Budapest entschieden sich die Unterzeichner respektive deren Nachfolgestaaten, eine dauerhafte Beratungsplattform, nämlich die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit Sitz in Wien einzurichten, in deren Rahmen Konflikte und Streitigkeiten verhandelt werden sollten.
Es ist ein erschreckendes Zeichen für diplomatischen Unwillen der Mehrheit der daran beteiligten Staaten, dass ein solches Instrument zur Behandlung von zwischenstaatlichen Konflikten seit Beginn des Ukraine-Krieges bewusst nicht genutzt wird. Dass es auch anders geht, zeigte die Tagung der Interparlamentarischen Union (IPU) in Genf, an der eine russische Abordnung vertreten war. Zwar versuchten Vertreter von EU-Staaten, einen Eklat zu provozieren, aber das russische Angebot zum Dialog wurde dennoch von verschiedenen Staaten angenommen.