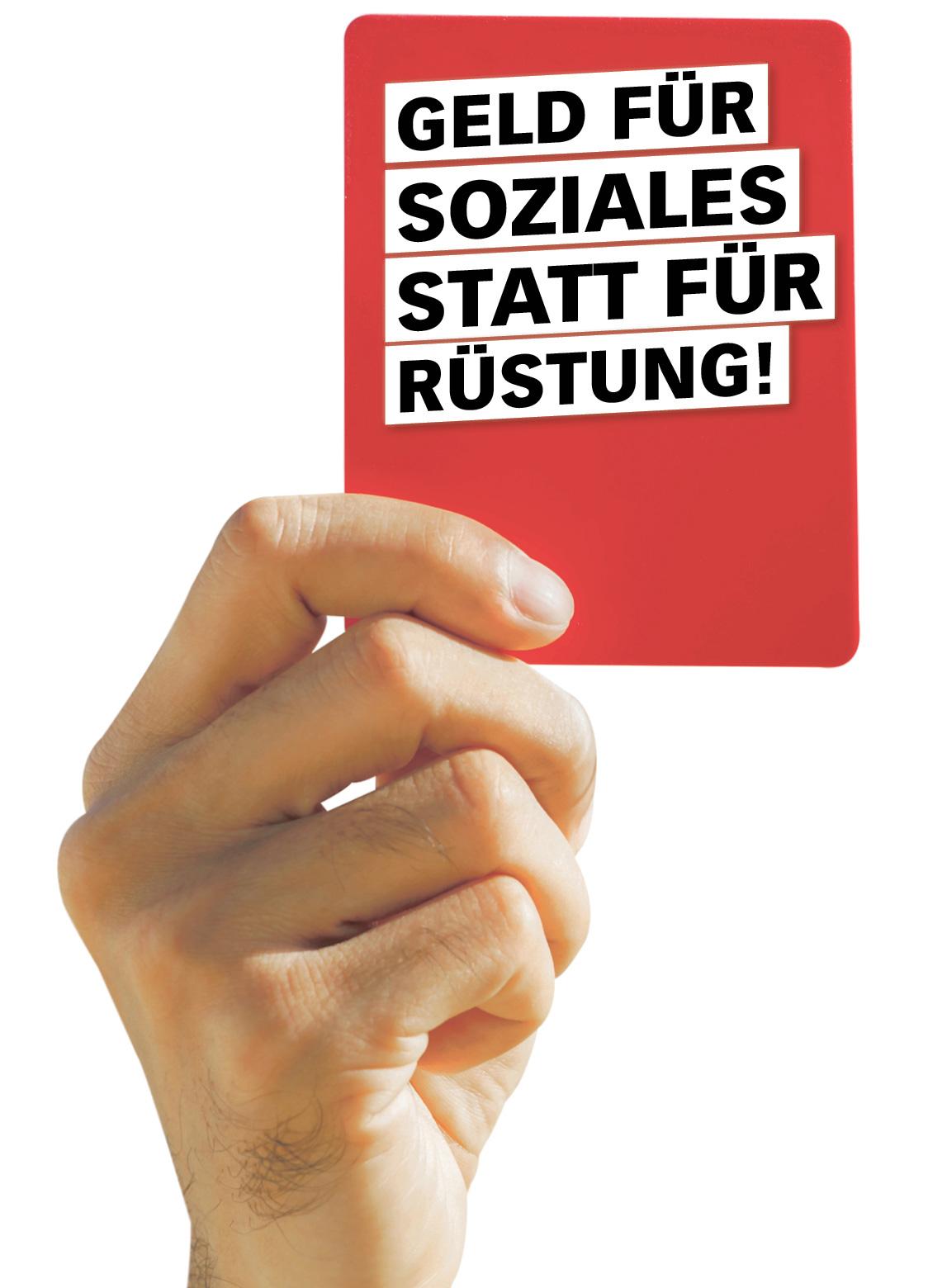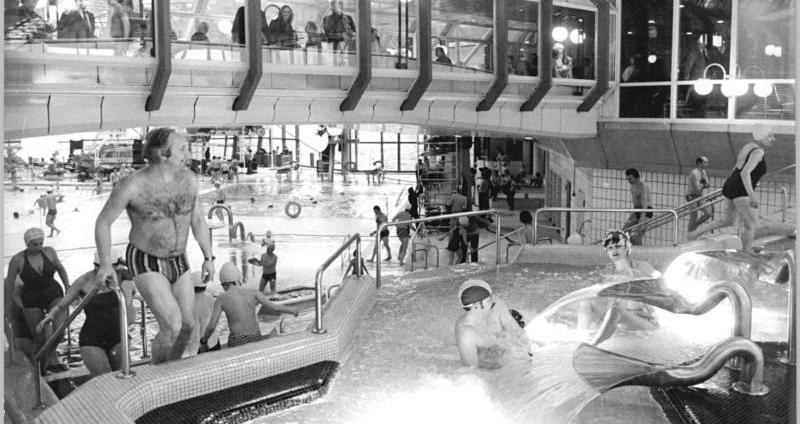Kulturpolitik ist, wenn der Bürgermeister seine Amtskette auf schicken Empfängen spazierenführt, Künstlerhände schüttelt oder Ausstellungen eröffnet. Selbst in der Provinz weht noch ein Hauch von Weltgewandtheit, wenn Preisträgerinnen empfangen und Kunstwerke enthüllt werden, deren schöpferische Kraft sich den Betrachtern dieser (und möglicherweise auch der künftigen) Generation verschließt. Ein Händedruck kostet nichts und macht sich gut in der Lokalzeitung.
Solche Spektakel erfreuen sich bundesweit immer noch großer Beliebtheit, während den kommunalen Kulturetats langsam aber sicher die Luft abgelassen wird. Denn Kultur gehört in das Feld der sogenannten „freiwilligen Aufgaben“, also in den Bereich, den Städte und Gemeinden zuerst zusammenstreichen, wenn Einsparungen gefordert werden. Das war auch schon vor der großen Krise so, in die die Kriegs- und Krisenpolitik die kommunalen Finanzen gestürzt hat. Jahrzehntelang inszenierten sich ausgerechnet neoliberale Ideologen gerne als Vertreter des „kleinen Mannes“, indem sie Kunst und Kultur als überflüssigen Luxus für den elitären Dünkel brandmarkten – und Kürzungen im vermeintlichen Sinne „der Masse“ forderten. Nun, da der Rotstift endgültig das Regiment übernommen hat, wird klar: Der Dünkel hält sich, während zuerst die Kultur zerschlagen wird, von der der Großteil der Bevölkerung profitiert.
Bibliothekensterben
Das zeigt sich besonders deutlich am Beispiel der öffentlichen Bibliotheken. Seit den Corona-Jahren steigen die Benutzerzahlen kontinuierlich. Allein im vergangenen Jahr kamen nach Angaben des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) rund 110 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Büchereien. 270 Millionen Medien wurden ausgeliehen – sechs Millionen mehr als im Vorjahr. Trotz des großen Erfolges war im gleichen Zeitraum jede dritte Bibliothek von Sparmaßnahmen betroffen. Jede fünfte Bücherei musste ihre Ausgaben um mindestens 10 Prozent kürzen. Das Budget für den Medienbestand ist insgesamt geschrumpft, Angebote wurden heruntergefahren. Fast jede zweite Bibliothek (48 Prozent) benötigt zusätzliche Mittel für die Infrastruktur und kann notwendige bauliche Maßnahme nicht stemmen.
Damit setzt sich ein langanhaltender Trend fort. Im Jahr 2013 gab es in Deutschland noch 9.455 öffentliche Bibliotheken. Im Jahr 2023 waren es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nur noch 8.152. Innerhalb von zehn Jahren wurden also 1.303 Bibliotheken geschlossen – 130 pro Jahr. Besonders oft betroffen sind kleinere Einrichtungen und Stadtteilbibliotheken, die ihre Dienstleistungen wohnortnah anbieten. Nicht selten gehen dem endgültigen Ende dabei längere „vorübergehende“ Schließzeiten voraus. Schon ein Blick auf die Kulturausgaben reicht, um das Problem zu erkennen. In Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern betragen die Aufwendungen für Kultur durchschnittlich gerade einmal 24,98 Euro pro Einwohner – zu wenig, um auch nur ein gebundenes Buch pro Person zu erwerben.
Gerade im ländlichen Raum könnten Bibliotheken „aufgrund von Personalmangel häufig keine durchgehenden Öffnungszeiten mehr anbieten. Schließzeiten von mehreren Tagen unter der Woche sind keine Seltenheit“, so Matthias Neis, Bereichsleiter für Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft bei der Gewerkschaft ver.di, gegenüber UZ. Die Bibliotheken seien „ein wichtiger Eckpfeiler der kommunalen Infrastruktur und ein absolutes Erfolgsmodell“, sagt der Gewerkschafter, zugleich stünden sie jedoch „immer wieder unter enormen Spardruck“. „Trotz wachsender Aufgaben und steigenden Nutzungszahlen gibt es zu wenig Stellen an vielen öffentlichen Bibliotheken“. Und die Stellen, die es gibt, könnten häufig nicht besetzt werden, „auch, weil die Arbeit unter diesen Bedingungen einfach nicht attraktiv genug ist“, so Neis. Seine Forderung: „Die Bibliotheken müssen – ihrer Bedeutung entsprechend – deutlich besser ausgestattet werden.“
Die derzeitige Entwicklung weist jedoch in eine andere Richtung. Und sie trifft auch richtig große Einrichtungen wie die Berliner Zentral- und Landesbibliothek (ZLB). 1,5 Millionen Besuche verzeichnen die Standorte der ZLB im Jahr und über 20 Millionen Medien werden entliehen. Im Zuge des Berliner Kahlschlags bei den Kulturausgaben soll die Institution allein im laufenden Jahr rund 2,2 Millionen Euro einsparen. In den kommenden fünf Jahren wird jede zehnte Stelle gestrichen. Auch bei kostenlosen Angeboten, bei den Beratungs- und Servicezeiten und bei Veranstaltungen wird der Rotstift angesetzt. In einer Pressemitteilung sprach die Bibliothek im Juni von einem „harten Einschnitt“ und warnte: „Weitere Kürzungen wird die ZLB nicht verkraften können.“ Solche Warnungen verhallen regelmäßig – nicht nur in Berlin.
Sonntagsarbeit statt Unterstützung
Auf Hilfe von der Bundesregierung brauchen Länder und Kommunen nicht zu hoffen. Anstatt dem Bibliothekensterben (zumindest in Worten) entgegenzuwirken, ist die schwarz-rote Koalition drauf und dran, den ohnehin schon angegriffenen Arbeitsplatz Bibliothek weiter zu demontieren. „Öffentlichen Bibliotheken ermöglichen wir die Sonntagsöffnung“, haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Die kaputtgesparte Bibliothekslandschaft soll also ihr Angebot ausweiten, ohne dass ein Wort zur Finanzierung verloren wird. Meinen die das ernst? UZ wollte es genauer wissen und hat bei Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nachgefragt.
„Dem Koalitionsvertrag entsprechend werden wir öffentlichen Bibliotheken die Sonntagsöffnung ermöglichen. Details zur Umsetzung, (sic) stehen noch nicht fest“, so die Antwort einer Sprecherin des Kulturstaatsministers. Fest steht allerdings, dass die Bundesregierung für die Sonntagsöffnung am Arbeitsrecht drehen will und damit die Bibliothekenmisere weiter auf den Rücken der Beschäftigten verlagert: „Das Vorhaben hat die Schaffung einer arbeitsrechtlichen Grundlage für die Beschäftigung von Bibliothekspersonal an Sonn- und Feiertagen zum Gegenstand. Eine Bereitstellung von finanziellen Mitteln des Bundes ist derzeit nicht vorgesehen.“ Darüber hinaus hat man mit den Bibliotheken nicht viel am Hut. Auf die Frage, welche Maßnahmen der Kulturstaatsminister ergreifen will, um Standortschließungen und weiteren Kürzungen entgegenzuwirken, wird der schwarze Peter weitergegeben: „Diese Frage richtet sich in erster Linie an die Länder und Kommunen als Träger der öffentlichen Bibliotheken in Deutschland. Die derzeit schwierigen Rahmenbedingungen betreffen sowohl die Haushaltssituation des Bundes als auch die der Länder.“
Eine klare Haltung zum Thema Sonntagsöffnungen hat ver.di-Bereichsleiter Matthias Neis. Wenn künftig auch sonntags der normale Betrieb angeboten werden soll, bedeute das, „dass die Bibliotheksbeschäftigten den letzten Wochentag verlieren, der für sie regelmäßig frei ist, denn auch der Samstag gehört zu den normalen Öffnungszeiten.“ Neis hält das in der Abwägung zwischen den Interessen der Nutzer und der Beschäftigten „nicht für angemessen, denn die Zahlen zeigen ganz deutlich, dass der Großteil der Bibliotheksnutzung noch immer in der Ausleihe von Medien besteht, die zudem zu einem nennenswerten Anteil inzwischen auch digital erfolgt. Dafür braucht es keine Sonntagsarbeit.“ Der Gewerkschafter fordert, zunächst einmal sicherzustellen, „dass Bibliotheken flächendeckend verlässliche und nutzerfreundliche Öffnungszeiten unter der Woche gewährleisten können. Das ist leider nicht der Fall. Es ist deshalb zu erwarten, dass ohnehin nur wohlhabende Kommunen die zusätzlichen Kosten eines Sonntagsbetriebs ihrer Bibliotheken in Kauf nehmen würden. Gerade da, wo die öffentliche Infrastruktur schwach ist, wird das nicht passieren. Damit klafft die Bibliotheksversorgung nochmals weiter auseinander.“
Die Debatte um die Sonntagsarbeit hält Neis für ein Ablenkungsmanöver. Statt eine flächendeckende Finanzierung sicherzustellen und klare gesetzliche Vorgaben zur Ausstattung der Bibliotheken zu machen, „treiben Teile der Politik die Diskussion um die Sonntagsarbeit voran, die auf Kosten der Beschäftigten ginge, aber keines der grundlegenden Probleme lösen würde“.
Nichts als die Wahrheit
Bibliotheken sind nicht nur vom finanziellen Kahlschlag bedroht, sondern auch ein Kampffeld des reaktionär-militaristischen Staatsumbaus geworden. Anfang Juli untersagte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (OVG NRW) der Stadtbücherei Münster, Bücher mit Warnhinweisen zu versehen. Die Bibliothek hatte zuvor „Einordnungshinweise“ an zwei Büchern angebracht. Der Text lautete: „Dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Dieses Exemplar wird aufgrund der Zensur-, Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt.“ Eines der Bücher war „Putin: Herr des Geschehens?“ des ehemaligen Schweizer Geheimdienstlers Jacques Baud. Gegen das Vorgehen geklagt hatte der rechte Autor Gerhard Wisnewski, dessen Buch „2024 – das andere Jahrbuch: verheimlicht, vertuscht, vergessen“, ebenfalls mit einer Warnung versehen worden war.
Das Oberverwaltungsgericht bezeichnete die Warnhinweise als „abwertend und anprangernd“ und erklärte: „Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass sich mündige Staatsbürger in öffentlichen Bibliotheken mit Informationen versorgen, um sich – ohne insoweit gelenkt zu werden – eine eigene Meinung zu bilden.“
Der Journalist Norbert Häring, der den gesamten Fall aufgearbeitet und begleitet hat, machte auf seinem Blog darauf aufmerksam, dass diese Position noch vor wenigen Jahren auch Konsens der Bibliotheken-Verbände gewesen sei. So hieß es in einem Positionspapier von „Bibliothek und Information Deutschland“ (BID) im Jahr 2016 noch: „Die Kernaufgabe von Bibliotheken besteht darin, freien Zugang zu Informationen – ein breites Spektrum an Wissen, Ideen, medialen Inhalten und Meinungen – anzubieten, auch wenn diese für einzelne Personen oder gesellschaftliche Gruppen inakzeptabel erscheinen.“ Zudem warnte der BID davor, „dass zunehmend einzelne Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vertreter von Politik und Verwaltung versuchen, Einfluss auf das Medienangebot von Bibliotheken zu nehmen, indem sie das Entfernen von Titeln aus dem Bestand oder Verbote aussprechen, für die keine rechtliche Grundlage besteht. Die bibliothekarischen Verbände zeigen sich besorgt über diese Entwicklung, die zur Einschränkung der Informations- und Meinungsfreiheit führen kann.“
Die aktuellen Reaktionen der Verbände auf das Urteil des OVG NRW lassen erkennen, dass sich diese Einschätzung gewandelt hat. So kritisierte der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) das Urteil unter anderem mit dem Verweis darauf, dass die Bundesregierung „mit ihrem Koalitionsvertrag die Bekämpfung von Desinformation direkt adressiert“ habe. Auch das Kulturgesetzbuch NRW fordere implizit, „in einer auch von Fake-News und Desinformation geprägten Wirklichkeit die Fähigkeit, Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und zu untersuchen“.
Ganz ähnlich äußerte sich Heike Pflugner, Vorsitzende des Verbands der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen, gegenüber dem SWR: „Bibliotheken stehen dafür, dass das, was wir anbieten, verlässliche Quellen sind. Dass das, was bei uns drinsteht, auch richtig ist.“ Wie Bibliothekare bei tausenden von Büchern entscheiden sollen, in welchen die „Wahrheit“ steht, wurde nicht ausgeführt. Und auch der Berufsverband Information Bibliothek (BIB) reagierte mit einem Hinweis auf die vermeintlichen Aufgaben von Bibliotheken in der politischen Erziehung und verwies nicht nur auf die „Bekämpfung von Desinformation“ als Ziel der Bundesregierung, sondern auch auf den Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, in dem es heißt: „Demokratisches Bewusstsein und Handeln müssen erlernt und jeden Tag aufs Neue gelebt und verteidigt werden. Demokratie ist für uns mehr als formale demokratische Verfahren. Demokratie ist Haltung.“
Wer entscheidet, wie diese demokratische „Haltung“ genau aussieht, wird wohl weiterhin Streitgegenstand bleiben.
Weiterführende Informationen zu dem Fall gibt es im Blog von Norbert Häring.