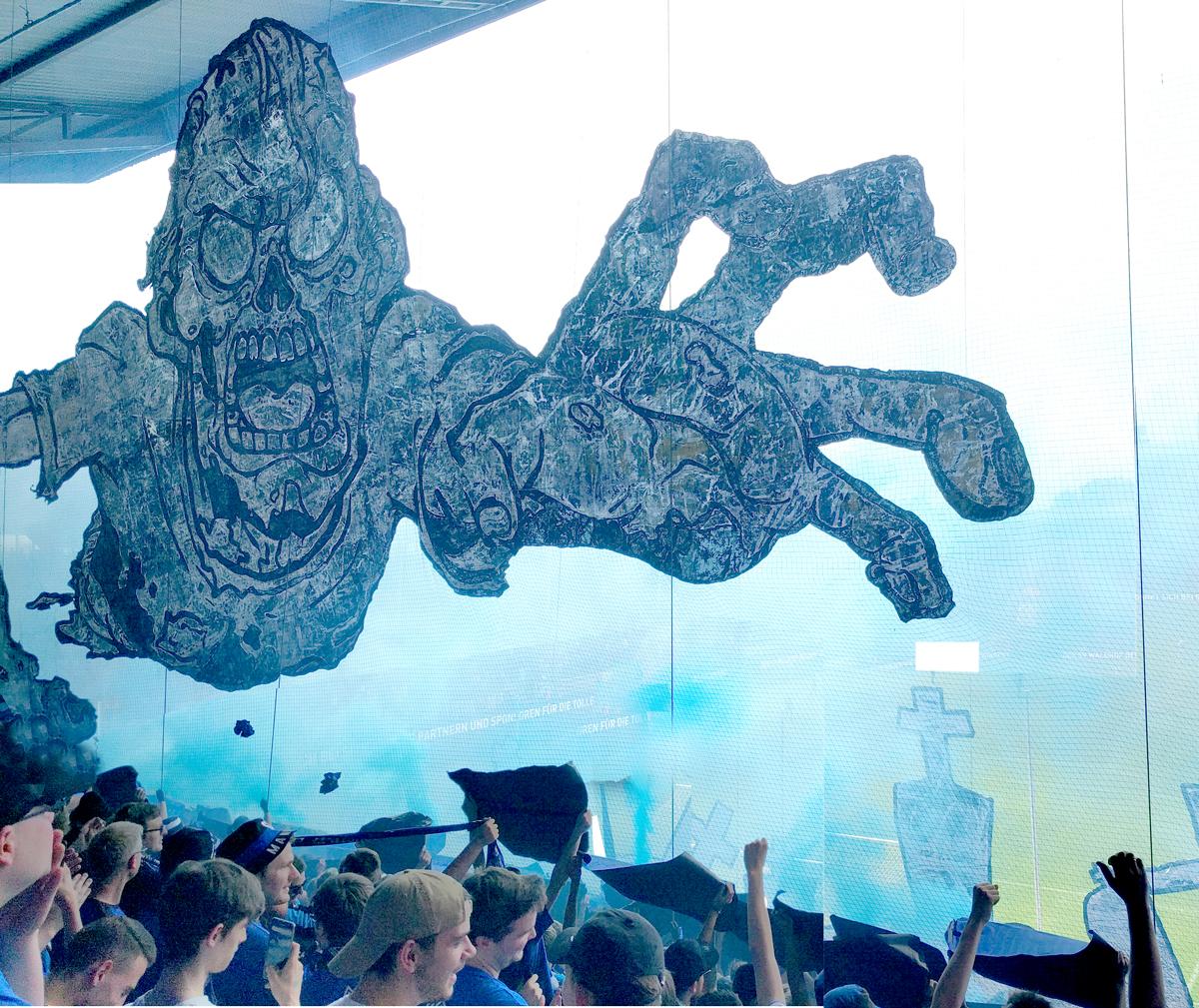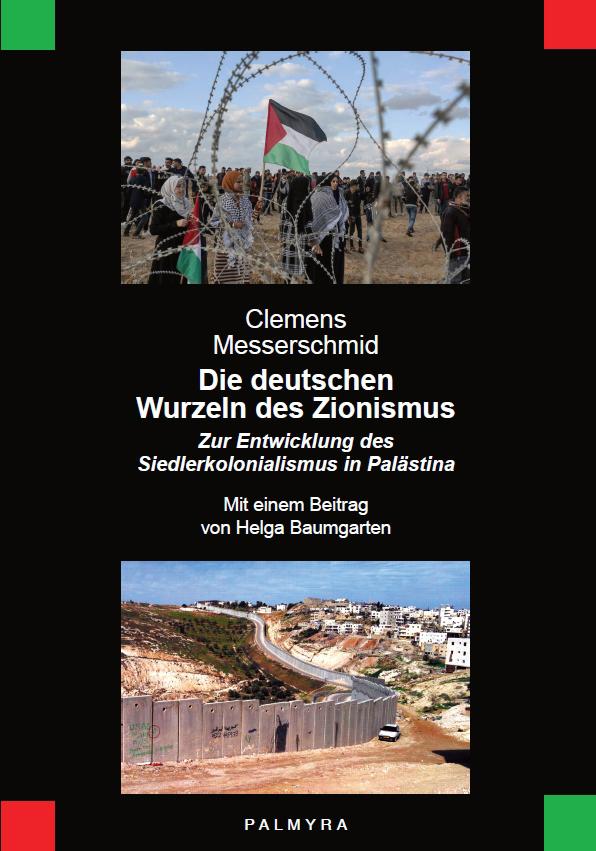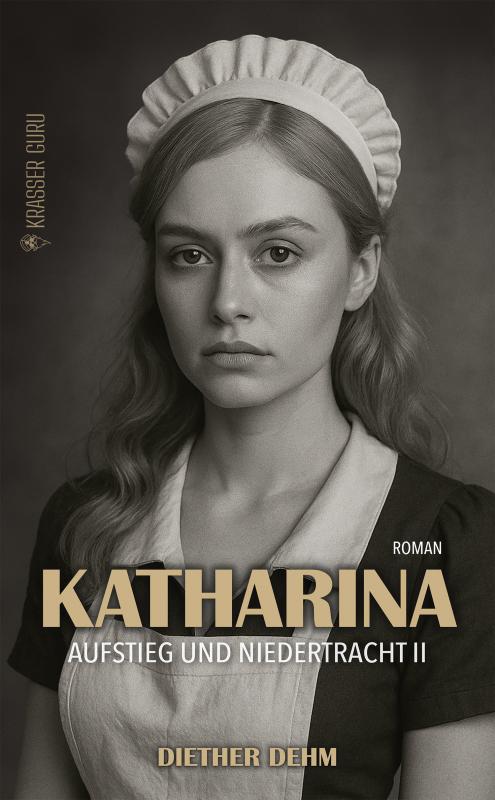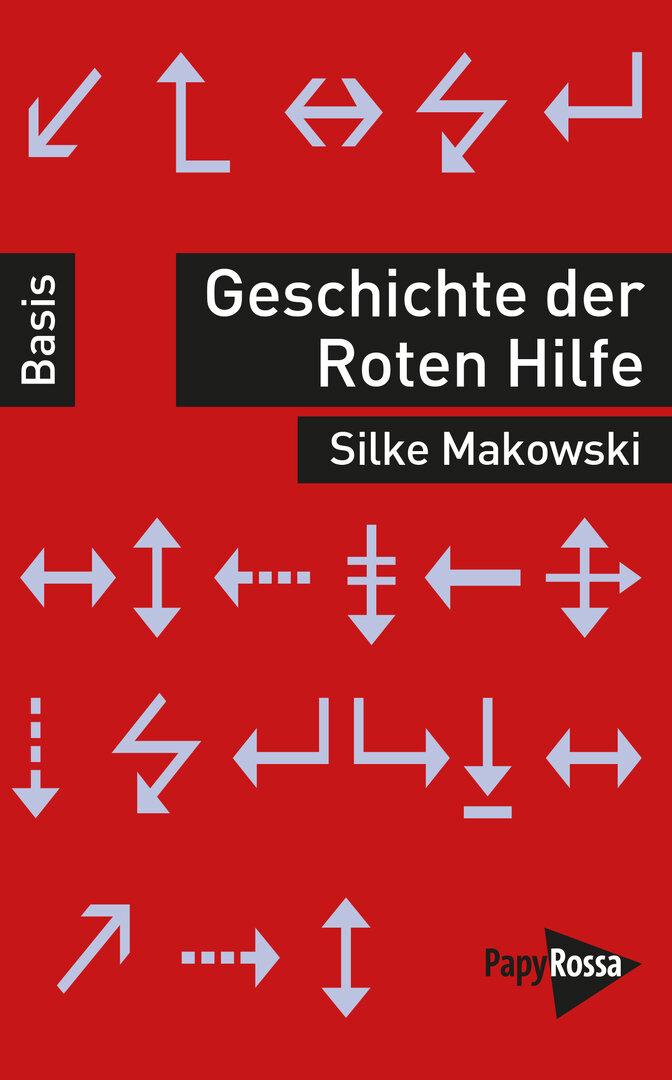Als wir auf die Friedrichstraße traten, hielt uns ein Mann eine riesige gelb-blaue Fahne vor die Nase. „Na, haben Sie Ihre russischen Freunde zur Umkehr bewegen können?“ Er grinste. Vermutlich nahm er seine dämliche Frage selbst nicht ernst. Wir kamen von einer Veranstaltung der Botschaft Boliviens, mit der das südamerikanische Land seinen 200. Geburtstag gefeiert hatte. Russen hatten wir dort keine getroffen. Im gut gefüllten Saal nicht und auch danach nicht im riesigen Foyer, mit eintausendsiebenhundert Quadratmetern vermutlich eines der größten in Berlin.
Früher saß dort Lenin aus Marmor auf einer Bank vor dem Treppenaufgang. Er wurde nach 1990 verbannt. Wie die Marmorbüste vor der russischen Botschaft Unter den Linden. Doch im Unterschied zu jener – sie steht jetzt im Ehrenhof und kann bei Empfängen besucht werden – weiß man nichts über den Verbleib des sitzenden Revolutionsführers aus diesem Foyer. Er war eines Tages einfach weg und grüßte nicht mehr wie gewohnt, wenn man durchs Portal schritt.
Am längsten hielt sich noch Lenins Konterfei aus Bronze an der Außenfassade des Schwimmbads der russischen Botschaft in der Behrenstraße: Es wurde erst 2011 demontiert. Zwanzig Jahre, nachdem die Exorzisten sein neunzehn Meter hohes Standbild vom Leninplatz geschleift hatten.
Verstoß gegen Sanktionen?
Das Haus der Sowjetischen Wissenschaft und Kultur also, nun nur noch Russisches Haus in Berlin. Relikt aus besseren Zeiten und Stachel im Fleische der Russlandhasser, die es aus eben jenem Grunde weghaben wollen. Angeblich verstoße der Weiterbetrieb gegen EU-Sanktionen, tönt es aus dem Schützengraben der Kalten Krieger. Das Haus werde von einer Agentur betrieben, die auf dem Index stehe, mithin stellten – Achtung: Beamtendeutsch – „Verstöße gegen sanktionsrechtliche Bereitstellungs- und Verfügungsverbote“ so etwas wie „Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten“ dar. Was heißt das? „Insbesondere dürfen eingefrorene Sachen nicht veräußert, vermietet, belastet oder anderweitig als Einkommensquelle genutzt werden“, so eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums.
Nun, ich vermute, dass Boliviens Botschaft keine eingefrorene oder gar große Einkommensquelle darstellte. Das Land, obgleich reich an Bodenschätzen, ist das ärmste in Lateinamerika. Auf dem Empfang zum Jahrestag gab es nur Wasser, keinen Wein, was angesichts der Tatsache, dass zwei Drittel der zehn Millionen Einwohner Boliviens in bitterer Armut leben, vernünftig und durchaus angemessen war.

Auch unser Verlag zahlte keine Miete, als wir vor einigen Jahren im großen Saal das Buch „Wir und die Russen“ von Egon Krenz vorstellten. Der letzte Staats- und Parteichef der DDR rief von der Bühne dort einen Satz ins Auditorium, der selbst die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ überzeugte, weshalb ihr 23-Sekunden-Trailer mit Krenz noch immer im Internet läuft. Krenz bekräftigt darin, dass es keinen einzigen Grund gibt, AfD zu wählen. Macht sich das Blatt jetzt mitschuldig?
Betrieben wird das Haus von der im Außenministerium der Russischen Föderation angesiedelten Agentur Rossotrudnitschestwo, die sich um die im Ausland lebenden Russen und die internationale kulturelle und humanitäre Zusammenarbeit kümmert. Sie existiert seit 1925. Es gibt auf sieben Etagen Filme und Konzerte, Ausstellungen und Sprachkurse, Empfänge und Seminare, einen Buchladen und eine Stolowaja, wo man Borschtsch und Blini verzehren kann.
Volker Beck weit vorne
Namentlich die Grünen zogen und ziehen gegen den Betreiber und das Russische Haus zu Felde. „Es kann nicht sein, dass eine Propagandazentrale Russlands in Berlin mitten im Krieg weiter aktiv ist“, erklärte Ex-MdB Volker Beck. Und erstattete Strafanzeige gegen das Bezirksamt von Berlin-Mitte, auf dessen Territorium sich das Hassobjekt befindet. Angeblich habe es seine Pflicht zur Durchsetzung der EU-Sanktionen verletzt. Beck richtete an die seinerzeitige Außenministerin Baerbock die Bitte, die Verantwortlichen des Russischen Hauses allesamt zu „unerwünschten Personen“ zu erklären, um sie auszuweisen. Es gehe nicht an, dass hier unter dem Deckmantel des Diplomatenstatus Straftaten verübt würden, giftete er.
Das schien selbst dem Auswärtigen Amt zu blöd. Aber das Russische Haus steht dennoch unter ständigem Beschuss. Auch von ukrainischen Aktivisten, die einen Anspruch auf die Immobilie erheben. Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion habe sich das Haus unter den Nagel gerissen, während die Ukraine kein Kulturinstitut in Berlin besitze. „Die ukrainische Gemeinschaft in Berlin ist gezwungen, Büroräume anzumieten und Geld für die Durchführung bestimmter kultureller Projekte aufzubringen“, klagte der ukrainische Kulturverein „Vitsche“, der sich zufällig Anfang 2022 gegründet hatte.
Mithin: Es gibt verschieden motivierte Begehrlichkeiten, die aber alle ein Ziel haben – das Anwesen in der Friedrichstraße 176–179, das größte Kulturzentrum Russlands in der EU, zu beseitigen. Vermutlich fürchtet das politische Berlin, dass im Gegenzug die drei Goethe-Institute in Russland geschlossen werden könnten, weshalb dieser Schritt unterblieb. Bislang.
Wie auf gepackten Koffern
Der Betrieb im Haus läuft erkennbar auf Sparflamme. Als säße man auf gepackten Koffern. Die fast 30.000 Quadratmeter Nutzfläche mit den beiden Konzert- und Kinosälen, vier Konferenzräumen, dem Musiksalon, der Sauna et cetera werden nur selten noch genutzt, viele Mieter sind ausgezogen, die Läden zur Friedrichstraße leer. Mit Zukunftsängsten kann man nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Kulturtempel totmachen.
Ein solches Ende hatten sich die Erbauer 1984 auch nicht gedacht. Die dreieinhalb Kilometer lange Friedrichstraße wurde damals durch die Grenze geteilt. Der Abschnitt zwischen dem Boulevard Unter den Linden und dem Ausländer-übergang Checkpoint Charlie sollte nach dem Willen der DDR wiederbelebt werden. Eines der ersten neuen Bauwerke der „Aufbauleitung Sondervorhaben der Hauptstadt Berlin“ unter Erhardt Gißke, die hier fertiggestellt wurden, war eben dieses. Mit Granit aus der Lausitz und Kalkstein aus Bulgarien für die Fassade. Sagen wir mal so: architektonisch interessant. Ein Funktionsbau. Den seinerzeit in der Sowjetunion errichteten repräsentativen Bauwerken nicht unähnlich, obgleich es ein deutscher Architekt entworfen hatte. Dieser Karl-Ernst Swora entwarf auch das Bettenhochhaus der Charité und das Haus des Berliner Verlages am Alexanderplatz, wo ich ein Jahrzehnt lang in der achten Etage arbeitete, sowie das Wohn- und Geschäftshaus Quartier 401 (Spreeterrassen) an der Weidendammer Brücke, wo ich inzwischen seit 35 Jahren lebe. Noch mit einem Mietvertrag aus DDR-Tagen. Der schützt mich vor exorbitanten Mietsprüngen.
Wie alles anfing …
Von hier sind es nur wenige hundert Meter bis zum Russischen Haus. Gelegentlich lädt mich Frau K. aus Kiew ein. Ihre Glinka-Gesellschaft Berlin e. V. ist dort Mieter in der dritten Etage. Der Verein veranstaltet unter anderem Konzerte im Haus, zum Beispiel unlängst am 9. Mai. Im Hintergrund auf der Bühne liefen unterdessen Fotos von meinem Sohn und mir aus unserem Bildband „Denkmale der Befreiung“ (edition ost). Frau K. und ihr Verein verkaufen keine Tickets. Weil: Auch die Glinka-Gesellschaft möchte nicht gegen „sanktionsrechtliche Bereitstellungs- und Verfügungsverbote“ verstoßen. Denn Musik, selbst wenn sie von Michail Iwanowitsch Glinka (1804 – 1857) stammt, ist in den Ohren der Russophobiker reine Putin-Propaganda und Teil der hybriden Kriegführung Moskaus. Glinka war schließlich der Schöpfer einer eigenständigen klassischen Musik Russlands.
Die Glinkastraße verläuft parallel zur Friedrichstraße und nimmt ihren Ausgang an der Russischen Botschaft. Den vor fünf Jahren gemachten Vorschlag, die aus vermeintlich antirassistischen Gründen umzubenennende U-Bahn-Station „Mohrenstraße“ auf Glinka zu taufen, konterte die „Bild“ am 7. Juli 2020 mit der Schlagzeile: „Berliner U-Bahnhof soll nach Antisemiten benannt werden.“
Womit eine neue Front eröffnet wurde.