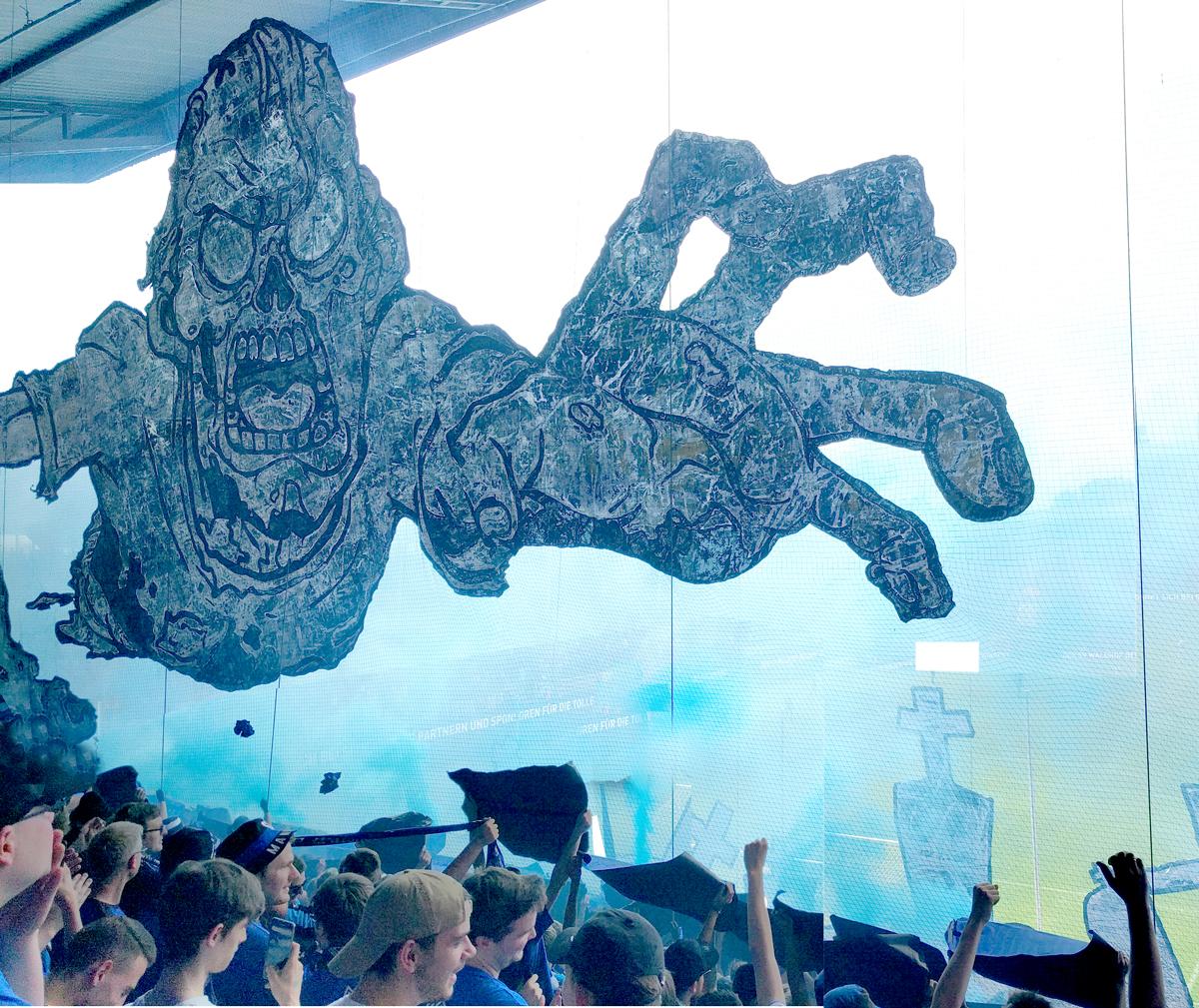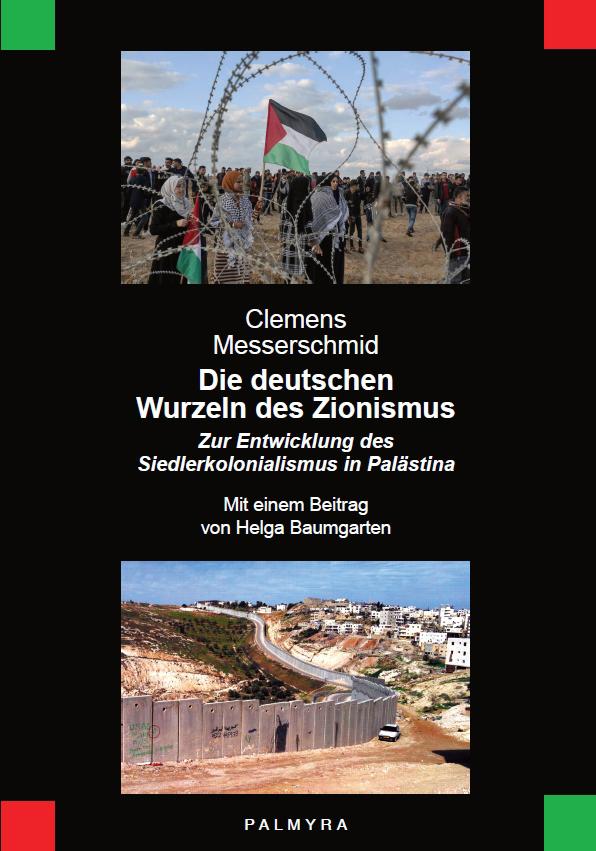In der DDR lebten drei prominente Nordamerikaner aus Überzeugung. Und sie machten keinen Hehl daraus. Da war der Musiker Perry Friedman (1935 – 1995), der mit dem Banjo an der Wiege der FDJ-Singebewegung stand. Da war Dean Reed (1938 – 1986), der politisch engagierte Schauspieler und Sänger. Und da war Victor Grossman, der Publizist und Kommunist. Er war der älteste von ihnen und ist nun, wenige Monate vor seinem 98. Geburtstag, in Berlin gestorben. Nach ihnen.
Anfang der fünfziger Jahre desertierte Stephen Wechsler aus der US-Army. Der GI schwamm bei Linz über die Donau hinüber in Österreichs sowjetische Besatzungszone. Die Russen sperrten ihn erst einmal zwei Wochen in einen Keller, obgleich er erklärte, dass er Nachfahre von Juden aus dem sowjetischen Odessa und dem Baltikum sei und seit 1945 Mitglied der Kommunistischen Partei der USA. Schließlich schoben sie den jungen Mann in die DDR ab und dachten sich einen Tarnnamen für ihn aus. „Ein sowjetischer Offizier schlug mir den Namen Victor Grossman vor. Ich war nicht begeistert, aber ich hatte keinen besseren. Meine wahre Identität haben nicht einmal die DDR-Behörden erfahren, denen ich nach zwei Monaten übergeben wurde“, so erinnerte er sich.
Der Tarnname sollte seine Familie in den USA schützen. Wechsler war 1942 der Young Communist League beigetreten und 1945 der Kommunistischen Partei der USA (CPUSA). Von 1945 bis 1949 studierte er an der Harvard University Ökonomie und Gewerkschaftsgeschichte und schloss 1949 mit dem Diplom ab. Anschließend arbeitete er auf Wunsch seiner Partei als Industriearbeiter, weil es zu wenig Kommunisten unter den Arbeitern gab.
In der DDR kam Grossman zunächst nach Bautzen. Im äußersten Zipfel des Landes und unweit der Grenze zu Polen und der Tschechoslowakei wurden die Deserteure aus westlichen Armeen konzentriert. „Zunächst trug ich Holzbohlen in einer Fabrik, wurde dann Kulturleiter für Deserteure, ich lernte Dreher, und kam dann nach Leipzig, wo ich Journalismus studierte, heiratete meine liebe Renate und wurde Vater vom ersten meiner zwei Söhne“, schrieb Grossman in seinem Lebenslauf. „Ich bin der Einzige, der sowohl an der Harvard- als auch an der Karl-Marx-Universität studiert hat.“ Vermutlich hatte er auch damit recht.
Grossman arbeitete danach für Zeitungen und für den Rundfunk, schrieb Bücher. Er litt an den Schwächen der DDR, obwohl oder gerade weil er diesen Staat zeitlebens für das bessere Deutschland hielt: „Wie oft raufte ich mir die dünner werdenden Haare bei Fehlentscheidungen, unnötigen Härten und langweiligen Reden in der Tagespresse oder der ‚Aktuellen Kamera‘“, konstatierte er einmal betrübt.
Mitte der siebziger Jahre bekam er Post – die USA hatten die DDR anerkannt und in Berlin eine Botschaft. „Obwohl mein richtiger Name nur den Sowjets und meiner Frau bekannt war, hatte die Botschaft einen Brief an meinen Verlag geschrieben, auf dem beide Namen angegeben waren. Ich sollte mich zur Klärung einer Staatsbürgerschaftsfrage in der Botschaft einfinden.“ In der Botschaft in der Neustädtischen Kirchstraße versuchte man ihn – unverändert Staatsbürger der USA und keineswegs der DDR – zur Rückkehr in das Mutterland zu bewegen, er habe als Deserteur nichts zu befürchten. „Das habe ich natürlich bezweifelt.“ Zu Recht. Im Frühjahr 1989 veröffentlichte Grossman im Bulletin der Harvard-Absolventen seine Lebensgeschichte, die ihm viele Einladungen in die USA eintrug. „Ich fragte damals noch einmal in der US-Botschaft nach, ob ich jetzt unbeschadet in die USA reisen könne. Die Konsulin meinte nur: ‚Die Army hat ein langes Gedächtnis. Ich würde es nicht wagen.‘“
Das hatte sie in der Tat. Als Grossman 1994 nach New York flog, wurde er noch im Flughafen von Armeepolizei in Empfang genommen und drei Stunden in einer Kaserne vernommen. Man interessierte sich vornehmlich für andere Deserteure und sein Leben in der DDR. Dann wurde der 66-Jährige offiziell aus der Army entlassen: „43 Jahre nach Dienstantritt“, wie Grossman befriedigt feststellte. Andere Deserteure kamen nicht so glimpflich davon.
Auch Grossman verfügte über ein Langzeitgedächtnis. Von Finten und Face-Liftings des Imperialismus ließ er sich zu keiner Zeit täuschen oder gar in die Irre führen. Er publizierte regelmäßig auf seiner eigenen Homepage „Victor Grossman’s Berlin Bulletin“ seine „Gedanken eines Amerikaners zur Politik in Deutschland“. Das tat er in seiner Muttersprache, also auf Englisch. Nr. 235 war sein letzter Kommentar, dem er den Seufzer voranstellte: „Wieder einmal zu lang!“ Darin freute er sich, dass in über 2.100 US-Städten und Gemeinden mehr als fünf Millionen Menschen an Trumps Geburtstag „No Kings Day“ gefordert hatten. „Die Motivation war unterschiedlich, aber die Protestkundgebungen waren größer als zu Zeiten des Vietnamkriegs oder der Bürgerrechtsbewegung!“
Wieder und wieder polemisierte Grossman gegen die aggressive Politik Deutschlands. „Ich höre zu viele Echos aus der Vergangenheit“, schreibt er wütend, aber begründet. „Eine eindeutig orchestrierte Medienkampagne beharrt darauf: ‚Putin bedroht Deutschland, wir brauchen eine mächtige Kriegsmaschine! Dringend!‘ Die verfassungsmäßigen Haushaltsobergrenzen für Schulden wurden abgeschafft; für Waffen gibt es keine Grenzen!“ Russland werde aber „nicht im Traum daran denken, Deutschland anzugreifen“, notierte er. „Diese Bedrohung war schon immer ein Mythos.“
Victor Grossman wirkte mitunter wie ein Exot. Er hatte zwar seine Vergangenheit hinter sich gelassen, als er die Donau 1952 durchquerte, aber nicht seine Herkunft. Er verkörperte bis zum Ende das, was man in der DDR einst „das bessere Amerika“ nannte – ein wacher, kritischer, rebellischer Geist mit einem deutlichen Akzent in Denken und Sprache, der sich auch in siebzig Jahren nicht verlor. Bisweilen ein wenig skurril, ein wenig verschroben gar – aber immer freundlich, offen, ehrlich, liebenswürdig. Diese Wärme und seine Worte werden uns künftig fehlen.