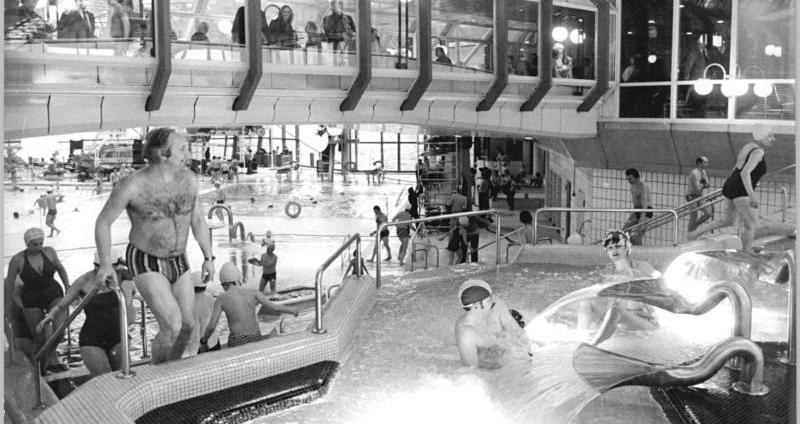Anfang April hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden eine Entscheidung getroffen, die massive Auswirkungen auf die Daseinsvorsorge in der gesamten Bundesrepublik haben könnte: Der Verbrauch von Trinkwasser darf besteuert werden.
Im November 2023 hatte die Wiesbadener Rathaus-Kooperation von SPD, Grünen, Linkspartei und Volt einen Antrag mit dem sperrigen Titel „Einführung eines Nachhaltigkeitsbeitrages Wassersparen und Klimaschutz“ in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Die Idee: Jeder Kubikmeter Wasser sollte mit einer Steuer von 90 Cent belegt werden. Bei einem ohnehin schon horrenden Wasserpreis von 3,42 Euro pro Kubikmeter entspräche dies einem Aufschlag von 26 Prozent. 16 Millionen Euro im Jahr wollten die Koalitionäre dadurch einnehmen. Zum Vergleich: Bundesweit liegt der Durchschnittspreis für Trinkwasser bei rund 2 Euro pro Kubikmeter.
Im Antrag hieß es, dass die Haushaltsverhandlungen „von einem hohen Konsolidierungsdruck geprägt“ seien, vor allem durch „eine sprunghaft gestiegene Inflation, einen außergewöhnlich hohen Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes“, ein gestiegenes Zinsniveau und Beschaffungsengpässe. Deshalb sollte ein „vernünftiger Mix aus Leistungseinschränkungen“ und „Einnahmeverbesserungen“ ersonnen werden, ohne den Wirtschaftsstandort „über Gebühr zu belasten“.
Einen Monat später wurde die „Satzung über die Erhebung einer Steuer auf den Trinkwasserverbrauch im Gebiet der Landeshauptstadt Wiesbaden“ beschlossen. Ausgerechnet dem CDU-geführten Innenministerium ging das aber zu weit. Es beanstandete den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung und warf der Stadt Wiesbaden vor, die kartellrechtlichen Vorgaben für die Preisgestaltung von Trinkwasser zu umgehen. Außerdem sei die Besteuerung des lebensnotwendigen Wassers nicht mit den Menschenrechten vereinbar.
Das Verwaltungsgericht Wiesbaden sah das anders. Dass lebensnotwendige Güter wie Trinkwasser nicht besteuert werden dürfen, sei kein geltender Rechtsgrundsatz, hieß es in der Pressemitteilung des Gerichts. Zudem sei es rechtlich unproblematisch, dass „eine Steuer einkommensschwache Haushalte oberhalb der Transfergrenze stärker treffe als andere“. Das sei schließlich auch bei „jeder anderen Besteuerung der Fall“.
Die Wiesbadener SPD zeigte sich mit dem Urteil zufrieden. Die Entscheidung stelle „für alle Kommunen in Deutschland ein wichtiges Signal dar“. Auch Ingo von Seemen, Fraktionsgeschäftsführer der „Linken“, sprach gegenüber UZ von einem zumindest juristischen Erfolg. Schließlich habe sich das von der „Linken“-Rechtsdezernentin Milena Löbcke geführte Rechtsamt „massiven Angriffen der CDU ausgesetzt“ gesehen, die „durch das Urteil als haltlos entlarvt wurden“. Bei der Erarbeitung einer neuen Satzung wolle sich „Die Linke“ für eine Sozialklausel einsetzen, die es beim ersten Beschluss nicht gegeben hatte. „Es steht außer Frage, dass Wasser ein Menschenrecht ist und ein Grundbedarf an Wasser steuerfrei sein sollte“, so von Seemen. „Kinderreiche Familien und Menschen mit geringem Einkommen“ sollten daher entlastet werden. Grundsätzlich steht die Fraktion aber zu dem Beschluss: „Wir blicken mit Sorge auf den Klimawandel und mit ihm zusammenhängende Dürren. Daher sind lenkende Maßnahmen, die zum Wassersparen animieren, wichtig.“
Davon abgesehen, dass die Steuer den Verbrauch des knappen Gutes zu einem Privileg für Reiche macht, wird diese „Lenkungswirkung“ von Fachleuten bestritten. „Wenn Verbraucher tatsächlich auf Preisanreize reagieren würden, hätte man bei der Höhe des Wasserverbrauchspreises in Wiesbaden eigentlich geringere Verbräuche erwarten dürfen“, schreibt der Umweltökonom Siegfried Gendries auf seinem Blog „lebensraumwasser.com“. Er rechnet vor, dass eine vierköpfige Familie mit Wiesbadener Durchschnittsverbrauch (der mit 141 Litern pro Kopf am Tag leicht über dem Bundesdurchschnitt liegt) inklusive Steuer auf eine Frischwasserrechnung von insgesamt 915 Euro im Jahr käme. Zusammen mit den Abwasserkosten würde beinahe die 1.500-Euro-Marke erreicht.
Eine Berufung gegen das Urteil ist aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung des Verfahrens zugelassen. Kommt die Stadt auch in zweiter Instanz mit der Wassersteuer durch, könnten andere Kommunen dem Wiesbadener Beispiel folgen. Das würde die Finanzierung der Daseinsvorsorge auf den Kopf stellen. Denn der Besteuerung eines lebensnotwendigen Gutes kann im Gegensatz zu anderen örtlichen Steuern (zum Beispiel Hundesteuer) nicht ausgewichen werden. Zugleich steigt der Druck auf die Gemeinden, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.
Während unbegrenzte Summen für Krieg und Aufrüstung zur Verfügung stehen, bluten die Städte und Gemeinden weiter aus. Wurde die Schaumweinsteuer im Jahr 1902 noch offiziell zur Finanzierung der Kaiserlichen Marine beschlossen, könnte die Wassersteuer schon bald dazu dienen, die durch die Kriegspolitik gerissenen Löcher in den kommunalen Haushalten zu stopfen.