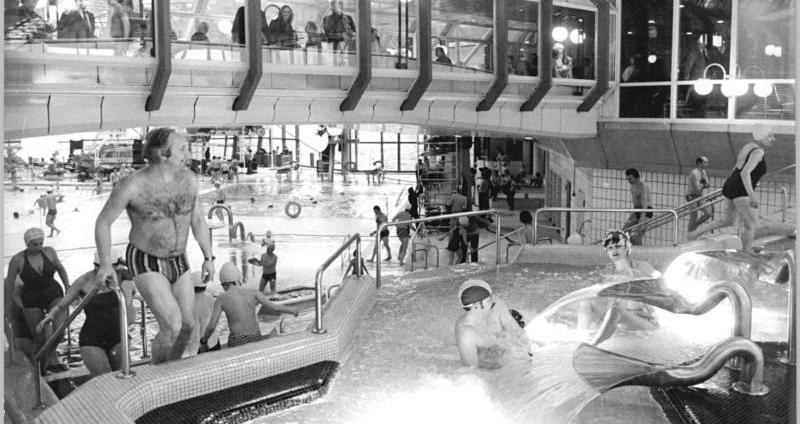Wer mit einer Bierdose in der Hand durch das rheinland-pfälzische Bad Kreuznach läuft, sollte genau darauf achten, wo er sich befindet. Denn auf einem rund 200 Meter langen Abschnitt der innenstädtischen Mannheimer Straße und auf den direkt angrenzenden Seitenstraßen gilt seit Anfang September ein striktes Alkoholverbot. Wer sich mit einem alkoholischen Getränk im öffentlichen Raum erwischen lässt, muss mit einem Platzverweis und einem Bußgeld von 50 Euro rechnen.
Ziel der Maßnahme ist die örtliche Trinkerszene, die sich vor allem aus völlig verarmten Menschen, Suchtkranken und Obdachlosen zusammensetzt. Weil sie sich in der Nähe von Geschäften im öffentlichen Raum aufhalten und dort die Passanten stören sollen, sieht die Stadtverwaltung eine „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“. So steht es in der Allgemeinverfügung, mit der die Stadt das Trinken verbietet und die auch für die Menschen gilt, die niemanden belästigen. Schließlich ließen sich „Störer und Nichtstörer nicht immer hinreichend unterscheiden“.
Ein paar Anhaltspunkte gibt es aber: Nicht stört, wer im Außenbereich der angrenzenden Gaststätten konsumiert. Der Alkoholausschank für diejenigen, die sich ein Bier (oder zwölf) auf der Terrasse leisten können, geht wie gewohnt weiter. Eine Ausnahme gibt es auch für den 14. Februar: An diesem Tag findet der Bad Kreuznacher Fastnachtsumzug statt. „Am Rande der Strecke wird hier von zahlreichen friedlich feiernden Personen auch Alkohol konsumiert“, heißt es in der Allgemeinverfügung. Und weil das bislang problemlos ablaufe, gelte die Verfügung nicht an diesem Tag.
Alkoholverbote sind zu einer beliebten Forderung in der bundesweiten kommunalpolitischen Diskussion geworden. Denn gerade Lokalpolitiker vermitteln gerne den Eindruck, für „Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit“ zu sorgen. Es ist die bürgerliche Reaktion auf eine Zeit, in der Armut und Elend weiter zunehmen und dadurch auch in den Stadtzentren sichtbar werden. Da das dahinterliegende gesellschaftliche Verhältnis nicht ins Bewusstsein derjenigen dringen darf, die sich noch mehr oder weniger gut über Wasser halten, wird die Verelendung der Betroffenen zu einer Aneinanderreihung individueller Fehltritte und störender Verhaltensweisen erklärt. Zugleich werden Sündenböcke für die Erscheinung der ohnehin absterbenden Innenstädte angeboten.
Die Perspektive der Betroffenen wird dabei regelmäßig ignoriert. So auch in Bad Kreuznach, wo es in den vergangenen Monaten zu mehreren Angriffen auf Obdachlose kam. Die Gewalt, die sie erfahren, ist – wie ihre gesamte Existenz – Teil der ästhetischen Kränkung, die die Verfechter der kapitalistischen Wohlstands-Wunderwelt erleben, wenn ihnen das Elend begegnet, das ihre liebste Gesellschaftsform produziert. Also: Aus den Augen – aus dem Sinn.
Um die Verdrängung der Armut zu bewerkstelligen, suchen die Kommunen nach geeigneten Kriterien. Die Unterscheidung zwischen erwünschtem und unerwünschtem Alkoholkonsum hat sich dabei – auch aufgrund der weit verbreiteten Suchtproblematik – als praktikabler Hebel erwiesen, um die Zusammenkunft von Wohnungs- und Perspektivlosen zu verhindern. Ausgesprochen wird das nicht und stattdessen lieber mit vermeintlicher Fürsorge argumentiert – freilich ohne einen tatsächlichen Ausweg aus Sucht, Krankheit und Verwahrlosung anzubieten.
Dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, zeigt das aktuelle Positionspapier, das der Deutsche Städte- und Gemeindebund ausgerechnet gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure (BSI) verabschiedet hat. Der Titel des zehnseitigen Papiers: „Alkoholprävention als gemeinsame Aufgabe von Städten, Gemeinden und Herstellern alkoholhaltiger Getränke“.
Im Text geht es um „negative Begleiterscheinungen des übermäßigen Alkoholkonsums in den Städten und Gemeinden“, um Jugendschutz, Prävention und vor allem die Aufgaben der Kommunen. Die sollen sich für die Einhaltung der verschiedenen Schutzgesetze einsetzen und Gastronomen in die Pflicht nehmen. Zum Beispiel dann, wenn diese Veranstaltungen mit Titeln wie „Koma-Party“ oder „Saufen bis zum Umfallen“ durchführen, was darauf hindeute, dass hier dem „Alkoholmissbrauch Vorschub“ geleistet werde. Die Städte und Gemeinden werden zudem angehalten, Aufklärung zum Jugendschutz zu leisten und die Einhaltung zu kontrollieren. Bedauert wird der ungenierte Alkoholkonsum im öffentlichen Raum. Vom Zusammenhang mit der sozialen Situation und den völlig unzureichenden therapeutischen Angeboten: kein Wort.
Wenig auskunftsfreudig zeigt sich das gemeinsame Positionspapier auch zu den Pflichten der Industrie. Man beruft sich auf eine „effektive Selbstregulierung der Mitgliedsfirmen des BSI“, die allerdings nicht weiter erläutert wird. Nur so viel: Die Schnapsbrenner und -händler setzen „primär auf die Durchsetzung der ‚Punktnüchternheiten‘“. Darunter wird der Verzicht auf Alkoholkonsum „in bestimmten Situationen“ verstanden. Als Beispiele genannt: im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz oder während der Schwangerschaft.
Während die Trinkerszene in Bad Kreuznach und anderswo am liebsten ganz verschwinden soll, gilt für den Rest der Gesellschaft das Hauptziel der „Punktnüchternheit“. Nicht nur daran zeigt sich die Widersprüchlichkeit einer Daseinsvorsorge, die das gesellschaftlich akzeptierte Trinken nach Kräften fördert – zugleich aber von denen angeekelt ist, die sich in ihrer Not in den Billigschnaps vom Discounter retten.
In Bad Kreuznach hat der „Kommunale Vollzugsdienst“ nach Inkrafttreten der Allgemeinverfügung inzwischen 17 Platzverweise ausgesprochen, wie die Stadt gegenüber UZ mitteilte. In acht Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Noch kurz nach Unterzeichnung der Allgemeinverfügung hatte der Ordnungsdezernent Markus Schlosser gegenüber der „Allgemeinen Zeitung“ erklärt, dass man statt auf Bußgeldverfahren auf Verwarnungen setzen will: „Uns ist allerdings klar, dass die Personengruppe, die es am meisten betrifft, kein solches Bußgeld bezahlen kann.“ Und vorahnungsvoll hinzugefügt: „Aber irgendwann werden auch Bußgelder verhängt werden müssen.“