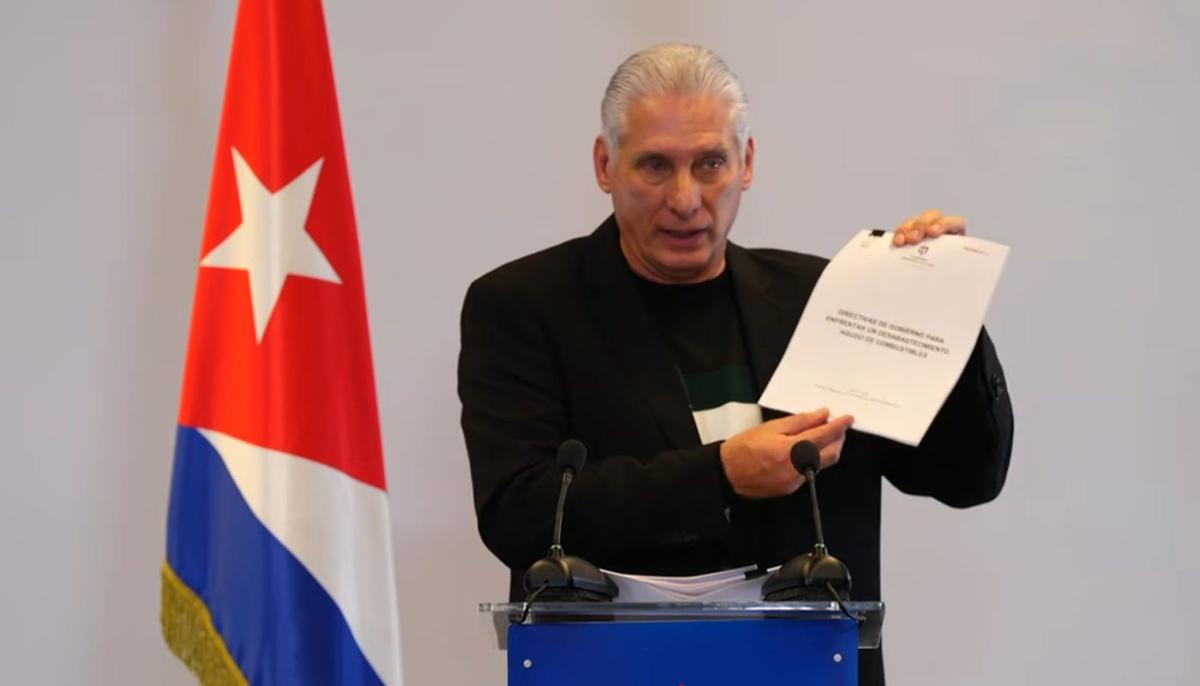Vor 80 Jahren erhob sich Vietnam mit der Augustrevolution aus der kolonialen Unterdrückung. Seither hat die Sozialistische Republik in der Praxis bewiesen, dass Weltmächte bezwungen und neue Produktivkräfte in den Diensten der werktätigen Klassen geschaffen werden können. Diese Serie aus vier Beiträgen nimmt das Jubiläum zum Anlass, die vietnamesische Sicht auf die eigene Geschichte zugänglich zu machen. Grundlage ist dafür die Analyse, Perspektive und Dokumentation der Kommunistischen Partei Vietnams, die die Revolution und den Aufbau des Landes als Einheit von nationaler Befreiung und sozialistischer Entwicklung begreift. Ziel ist es, die letzten acht Jahrzehnte in ihren Etappen verständlich zu machen und aus marxistisch-leninistischer Perspektive einzuordnen.
Sieg und Wiedervereinigung 1975 brachten Unabhängigkeit, aber nicht Wohlstand. Aus Zerstörung und Armut erwuchs die Aufgabe, die Produktivkräfte zu entwickeln. Mit Đổi Mới leitete die Partei 1986 eine neue Etappe ein: von der Kommandowirtschaft zur Marktwirtschaft mit sozialistischer Orientierung.
In den ersten Jahren nach dem Krieg stand die junge Sozialistische Republik wortwörtlich vor einem Trümmerhaufen. Die USA hatten merklich Schritte in Richtung ihres Zieles gemacht, das Land in die Steinzeit zu bomben. Große Teile sind heute noch vergiftet, unfruchtbar oder voller Blindgänger. Ganze Städte wurde ausradiert und entvölkert. Millionen Menschen waren zwangsumgesiedelt worden durch die Marionettenregierung oder flohen. Unzählige Brücken, Straßen, Bahnhöfe, Gleise wurden zerstört. Zu wenige Krankenhäuser, fast keine Schulen. Ganze Produktionszweige waren zunichte gemacht worden. Es fehlte den Menschen und der Wirtschaft an Allem: Essen, Kleider, Schuhe, Rohmaterialien. Mit dem Embargo des Westens und der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den anderen sozialistischen Ländern machte sich die wirtschaftliche Unterentwicklung erkennbar. Das BIP pro Kopf lag 1986 unter 86 US-Dollar pro Jahr, die Inflation bei teils über 774,7 Prozent. Trotz des sowjetischen Modells lebten nach Angaben der Weltbank 1985 rund 75 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze.
Kommandowirtschaft
In dieser Zeit der tiefsten Krise setzte die zentral organisierte Planwirtschaft auf strikte Rationalisierung. Alle Güter wurden der Bevölkerung via Marken zugeteilt, basierend auf der Arbeitsleistung. So hatten zwar die meisten zu wenig für ein anständiges Leben, aber niemand stand vor dem Nichts. Angesichts aller Schwierigkeiten konnte die Grundversorgung gesichert und die Gesellschaft stabilisiert werden, wenn auch die Menschen sich wegen des Mangels mit inoffiziellen Märkten selbst weiterhalfen. Zwar verhinderte diese Form des Wirtschaftens einen Kollaps, stieß aber auch schnell an ihre Grenzen. Das System stellte sich in der Praxis als ineffizient und äußerst bürokratisch heraus. Es gab kaum Exporteinnahmen, weshalb Kapital für Investitionen fehlte. Auch die Innovationskraft war viel zu gering ausgeprägt, um sich nachhaltig und selbstständig entwickeln zu können. Das Entwicklungsniveau der Produktivkräfte konnte sich mit der reinen Planwirtschaft trotz der immensen Anstrengung der Bevölkerung und intensiven Unterstützung der sozialistischen Länder nicht genug entwickeln. Mit den ökonomischen Schwierigkeiten der Sowjetunion in den früher 1980ern zeichnete sich ab, dass Vietnam eine neue Lösung für die inneren wie äußeren Probleme finden musste.
Đổi Mới
Auf dem 6. Kongress der Kommunistischen Partei Vietnams im Jahr 1986 wurden für Vietnam die Weichen für eine Transformationsphase auf dem Weg zum Sozialismus gestellt. Unter diesen Umständen wurde der Hauptwiderspruch in der wirtschaftlichen Unterentwicklung gesehen, die vorübergehend als Hauptursache für das Leiden der arbeitenden Klassen galt, nicht nur der Klassenwiederspruch. Ziel war es, zuerst das Fundament für den Sozialismus mit der Entwicklung der Produktionsmittel zu schaffen. Man beschloss, eine „Marktwirtschaft mit sozialistischer Orientierung“ einzuführen. Die reine zentrale Planwirtschaft hatte sich als zu starr und den neuen Anforderungen nicht mehr gewachsen erwiesen. So wurde der Markt, kombiniert mit gesamtgesellschaftlicher Planung, als Mechanismus für die Verteilung von Ressourcen, Dienstleistungen und Waren gewählt. In den Bereichen, in denen der Markt sozial versagt oder nicht dem makroökonomischen Plan in Richtung Sozialismus folgt, interveniert der Staat. Zu den bisherigen Staats- und Genossenschaftsbetrieben, die Stabilität und soziale Sicherheit garantieren, soll der Privatsektor ergänzend wachsen dürfen, was für Innovation und Wachstum sorgen soll. Wo also die Kollektivbetriebe unrentabel, ineffizient oder nicht marktsättigend arbeiten, soll nun der Privatsektor kompensieren. Zusätzlich sollen Investitionen, Wissen und Maschinerie aus dem Ausland angezogen werden. Weiterhin sind Kernsektoren wie Stromversorgung, Wasser und Ressourcen Monopol des Staates. Auch bleibt der gesamte Boden Volkseigentum. Agrarflächen werden nicht dem Markt überlassen, sondern vom Staat zugeteilt, um die soziale Stabilität der Landbevölkerung zu gewährleisten. Für Wohn- und Produktionsflächen können im Rahmen der staatlichen Wirtschaftsplanung und entsprechender Bewilligungen Nutzungsrechte – Kein Eigentum! – vom Staat oder Immobilienmarkt erworben werden. Ausländische Personen und Unternehmen hingegen können Grundstücke und Liegenschaften lediglich auf beschränkte Zeit pachten.
Erste Erfolge
Die neue Wirtschaftsform in Vietnam erwies sich in der Praxis schnell als gute Ergänzung zur sowjetischen Doktrin des Marxismus-Leninismus und dazu, wie dieser unter den spezifischen historischen Bedingungen angewandt werden kann. Musste die Republik noch im Jahr der Reformen Reis importieren, um Hungersnöte zu vermeiden, explodierte die Produktion innerhalb von drei Jahren so stark, dass Vietnam seit 1989 der weltweit drittgrößte Reisexporteur ist. Mit der verbesserten Ernährungssituation kamen auch spürbare Verbesserungen in der gesamten Wirtschaft. Die Armutsquote begann zu sinken, neue Arbeitsplätze wurden geschaffen, und die Möglichkeit der Selbstständigkeit brachte ein solides Fundament für die gesamte Gesellschaft. Auf der internationalen Bühne konnte Vietnam sich dank geschickter Diplomatie und den heimischen profitversprechenden Märkten trotz des Falls der Sowjetunion politisch und wirtschaftlich integrieren. Ab 1994 wurde das Embargo durch die USA schrittweise aufgehoben, und 1995 trat das Land ASEAN bei, dem Bund Südostasiatischer Staaten. Mit der Integration kam Kapital, Maschinerie und Know-how nach Vietnam. Die neue wirtschaftliche Leistung, kombiniert mit dem umfassenden Ausbau des Bildungs- und Gesundheitswesen, ermöglichte der Bevölkerung bisher ungeahnte Möglichkeiten und Perspektiven.
In die Zukunft
Trotz aller Erfolge haben auch die Đổi-Mới-Reformen ihre Limitierungen und Widersprüche. Die rasante Entwicklung der Produktivkräfte haben es ermöglicht, sich von einem halbfeudalen, halbkolonialen Land in eine blühende, vielversprechende und moderne Wirtschaft zu entwickeln. Die Sozialisierung der Produktion führte zu immensen Steigerungen der Effizienz und der Erhöhung des allgemeinen Wohlstands, aber auch zu einer Privatisierung der Gewinne und Kapitalakkumulation in der Bourgeoisie. Auch andere Widersprüche einer rasanten Entwicklung wie Umweltverschmutzung und Landflucht sind Themen, die das Land beschäftigen. Seit jeher ist der Weg zum Sozialismus für Vietnam ein langer und steiniger. Die kommende Ära, die Ära des Aufstiegs, die in diesen Tagen beginnt, setzt sich zum großen Ziel, die Widersprüche der Entwicklung und die Klassenwiedersprüche zu harmonisieren und die nächsten entscheidenden Schritte zum Sozialismus zu wagen.
Unser Autor kommt aus der Schweiz und lebt in Hanoi.