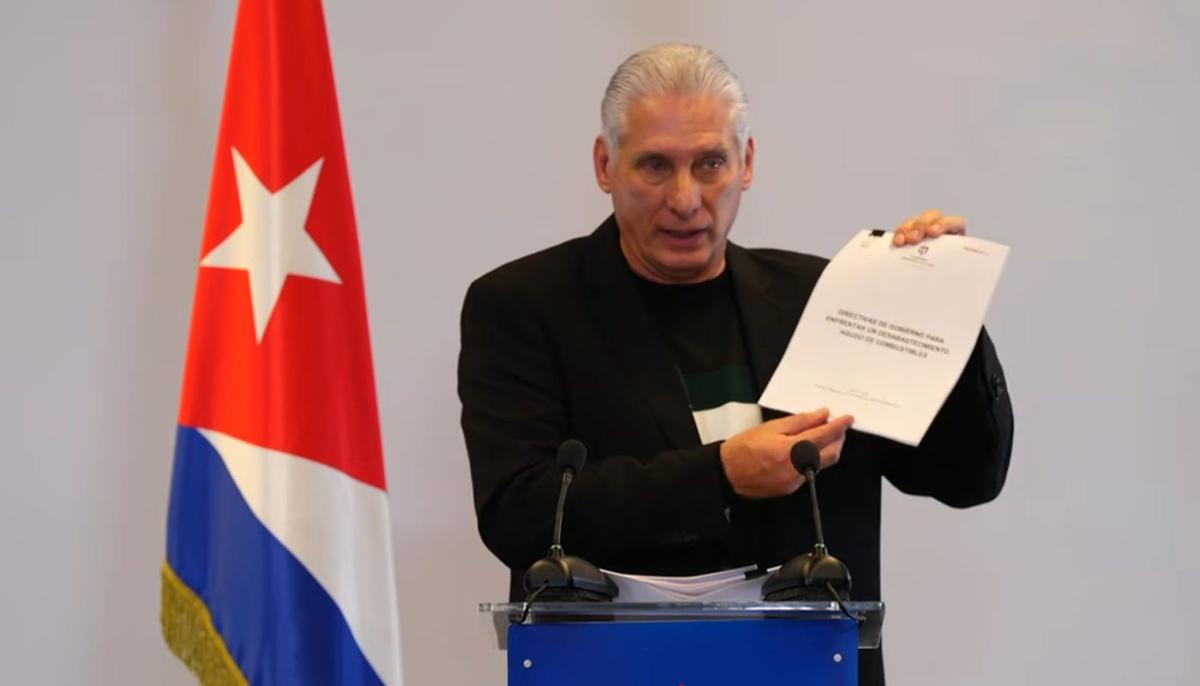Eine Einladung nach Burkina Faso – wer könnte sie ablehnen? Schon der Name macht neugierig: Burkina Faso, das „Vaterland (Faso) der aufrichtigen Menschen (Burkina)“. Ein Burkinabe ist somit der „Sohn Burkinas“, also ein integrer, ehrenhafter Mensch. Diese Bezeichnung geht auf den legendären Präsidenten Thomas Sankara zurück, der den von der französischen Kolonialverwaltung geprägten Namen Obervolta, nach dem Fluss Volta benannt, abschaffte. Der neue Name ist nicht nur eine Umbenennung, sondern Ausdruck eines Ideals: eines Menschenbildes, das über die Klassengesellschaften hinausweist und das hoffentlich eines Tages auf alle Menschen zutrifft.
Und dann war da noch der Putsch im Jahr 2022 durch das Militär, angeführt von Ibrahim Traoré. 2023 schlossen Burkina Faso und seine Nachbarländer Mali und Niger einen gegenseitigen Verteidigungspakt: die Allianz der Sahelstaaten (französich: Alliance des États du Sahel, AES). Alle drei Länder verwiesen die französischen Truppen des Landes. „Das war kein Staatsstreich – das war eine Revolution“, erklärt Professor Patrick Loch Otieno Lumumba, früher Direktor der Antikorruptionskommission in Kenia. Es ist bereits die zweite antiimperialistische Revolution in Burkina Faso. Das hebt das Land aus vielen seiner Nachbarn heraus. Während Burkina Faso in Deutschland nur wenigen ein Begriff ist, kennt es in Afrika fast jeder – und mit ihm seinen neuen Führer. „Wir sind so stolz auf Traoré, überall in Afrika“, sagt ein Mann aus Kamerun, der in Berlin lebt.
Das Flugzeug landet mitten in Ouagadougou. Der Flugplatz, ausgestattet mit nur einer Landebahn, liegt im Zentrum der Hauptstadt. Der Stadtverkehr muss sich täglich um ihn herumwinden. Er kann sinnbildlich für viele der strukturellen Probleme stehen, mit denen das Land bis heute zu kämpfen hat.
Sankaras Erbe und die neue Führung
Traoré sieht sich in der Tradition von Thomas Sankara. In Ouagadougou fährt man häufig an Tafeln und Plakaten vorbei, auf denen die Gesichter der beiden zu sehen sind. Für Sankara wird derzeit ein Mausoleum mit Parkanlage errichtet – ein deutliches Zeichen dafür, dass sein Vermächtnis in Ehren gehalten wird. Sankara war Präsident von 1983 bis 1987. Mit zwölf seiner engsten Kameraden wurde er 1987 von seinem damaligen Mitstreiter Blaise Compaoré verraten und ermordet. Compaoré regierte daraufhin Burkina Faso 27 Jahre lang – wieder im Sinne Frankreichs, das das Land seit 1919 bis zur Unabhängigkeit 1960 als Kolonie beherrschte.
2015 wurde Roch Marc Christian Kaboré Präsident. Während seiner Amtszeit nahm die Bedrohung durch islamistische Terroristen im Norden und Osten des Landes stark zu – ein Umstand, der zunehmend Unzufriedenheit im Militär hervorrief. Im Januar 2022 putschten Teile des Militärs unter Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nur wenige Monate später, im September desselben Jahres, wurde auch er entmachtet – diesmal unter der Führung von Capitaine Ibrahim Traoré.

Traoré ist mit 37 Jahren so alt wie Sankara damals – und zugleich der jüngste Staatschef weltweit. Welche Überzeugungen verleihen einem so jungen Mensch den Mut, das Schicksal seines Landes in die eigenen Hände zu nehmen, trotz der Tatsache, dass viele andere über weitaus mehr Erfahrung und Wissen verfügen? Es kann nur ein starker Wille sein – der Wille, sein Land zu retten – der ihm die nötige Kraft verleiht. Hinzu kommt seine Fähigkeit als Militär, diesen Willen notfalls mit der „Macht der Gewehrläufe“ (Mao) durchzusetzen.
In einem alten, klapprigen Taxi fahren wir zu unserer Unterkunft. Durch die geöffneten Fenster dringt ein seltsamer, ungewohnter Geruch. Später wird klar: Er stammt von kleinen Feuern am Straßenrand, in denen Müll, Plastikflaschen, Tüten und Fetzen verbrannt werden. Weitere Geruchsquellen sind die kleinen Grillhütten, auf denen Fleisch geröstet wird, die offenen Kochstellen mit Gemüse und wohl auch die wenigen Bäume, die sich in der Hitze behaupten.
Die Übergangsregierung und ihre Ziele
Die aktuelle Regierung unter Traoré versteht sich als Übergangsregierung mit einer geplanten Amtszeit von mindestens fünf Jahren. Im Mittelpunkt ihrer Politik stehen der Aufbau einer eigenen Industrie und die Verbesserung des Lebensstandards.
„Die Geschichte der Befreiungskämpfe wird oft mit Blut und Schweiß geschrieben. Die Belästigung durch Terroristen ist kein Zufall. Das internationale System wird mobilisiert, um diese Dynamik zu bremsen und einen Aufstand der Bevölkerung zu provozieren. Doch wenn sich alle verpflichten, diesen bereits begonnenen Weg mitzugehen, können die Ziele erreicht werden. Der Kampf wird lang, aber jeder muss seinen Teil beitragen – auch die sogenannte intellektuelle Klasse muss sich befreien, behaupten und eine klare Richtung vorgeben. Sich nicht zu positionieren, wie es heute viele tun, ist bereits eine Position. Es gibt keine Neutralität, die Bestand hat. Die mobilisierte Jugend und die zivilgesellschaftlichen Organisationen geben den Ton an. Ein entschlossenes Volk, das hinter einer aufgeklärten und standhaften Führung vereint ist, ist stärker als jedes System, das ihm von außen aufgezwungen wird. Die Geschichte ist in vollem Gange.“
Aus einem Bericht der Agence d‘Information du Burkina (AIB) vom 28. Januar 2025 über den Austritt der AES-Staaten Burkina Faso, Mali und Niger aus der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS)
Bereits unter Präsident Kaboré wurde mit dem ersten „Plan national de développement économique et social“ (PNDES, Nationaler Plan für wirtschaftliche und soziale Entwicklung) ein Fünfjahresplan aufgestellt, später gefolgt von einem zweiten Plan. Nach dem ersten Putsch unter Damiba erarbeitete das Militär einen Plan d’urgence – einen Dringlichkeitsplan. Unter Ibrahim Traoré wurde dieser nochmals überarbeitet und angepasst. Für die Umsetzung wurde ein eigenes „Bureau des grands projets“ eingerichtet – ein Büro für Großprojekte.
Zu den Schwerpunkten des Wiederaufbaus gehören:
- Investitionen in die Landwirtschaft. Zum Beispiel investierte der Staat kürzlich 19,8 Millionen Euro für Ladeschaufeln, Bagger, Baggerlader, Planierraupen, Walzen und Bulldozer. Damit sollen Bewässerungsanlagen gebaut und die Bauern bei der Feldbearbeitung unterstützt werden.
- Förderung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Die ersten E-Mopeds und E-Autos sind zu kaufen.
- Nutzung von Kernenergie zur Energieversorgung. Geplant ist der Bau eines Kraftwerks zusammen mit Mali und mit der Unterstützung durch Russland. Die größten Probleme betreffen die Kühlung und den Mangel an Know-how.
- Produktion von Solarpaneelen im eigenen Land. Bei der privaten Installation von Solarpaneelen gibt es die gesetzliche Regel, dass man für drei importierte Paneele mindestens eines aus inländischer Produktion dazukaufen muss.
- Flächendeckende Stromerzeugung durch Sonnenenergie. Das „Projet de Déploiement du Solaire à Large Echelle et d‘Electrification Rurale“ (SOLEER) mit einem Gesamtvolumen von 168 Millionen US-Dollar, das von der International Development Association (IDA), einer Untergruppe der Weltbank, finanziert wird, wird in allen Regionen von Burkina Faso durchgeführt.
- Weizenanbau zur Ernährungsabsicherung. Das Land kann seinen Bedarf an Nahrungsmitteln bisher nur zu 80 Prozent selbst decken.
Diese Programme sollen mittelfristig Arbeitsplätze schaffen, Abhängigkeiten von Importen verringern und die Selbstversorgung stärken.
Wirtschaft: Bergbau, Gold und Kontrolle
Der Goldbergbau ist eine zentrale Einnahmequelle für Burkina Faso. Man unterscheidet grob zwischen handwerklicher, halbindustrieller und industrieller Ausbeutung. Im vergangenen Jahr wurden die Lizenzgebühren, die die kanadischen, französischen und sonstigen ausländischen Goldminenbetreiber an den burkinischen Staat zu zahlen haben, von 10 auf 15 Prozent erhöht. Zusätzlich gibt es eine Bergbausteuer zugunsten der Kommunen. Ein Problem bleibt dabei jedoch: Nur Gemeinden, auf deren Gebiet sich Minen befinden, profitieren direkt. Um dem entgegenzuwirken, wurde ein nationaler Bergbaufonds geschaffen, aus dem landesweit Aktivitäten zur Wiederherstellung der staatlichen Souveränität finanziert werden.
Ein spezielles Thema ist der sogenannte Charbon fin – das sind feinkörnige Kohlerückstände, die bei der Goldgewinnung im Schlämmverfahren übrig bleiben. In der Kohle befinden sich noch beachtliche Mengen Goldstaub. Die ausländischen Minenunternehmen versuchten, dieses Material am burkinischen Staat vorbei zu exportieren, um die Goldreste selbst im Ausland zu gewinnen. Als Reaktion darauf wurde eine Commission de suivi – eine Nachverfolgungskommission – gegründet. Zusätzlich entstand eine eigene staatliche Fabrik zur Verarbeitung des Charbon fin in Burkina Faso.
Fährt man durch Ouagadougou oder auch durchs ganze Land, sieht man in der Mitte von vielen Straßenkreuzungen einen Laternenpfahl, an dem auf halber Höhe in vier Richtungen kleine Fahnen wehen: die der drei AES-Staaten Burkina Faso, Niger, Mali und die weiß-blau-rote Fahne Russlands. Ein Zeichen für die enge Verbundenheit. An einer Kreuzung sehen wir sogar einen ganzen Strauß von Fahnen: Die Fahnen Chinas und der DVR Korea stechen hervor.
Es trifft nicht zu, wie gelegentlich zu lesen ist, dass Burkina alle Goldminen verstaatlicht hätte. Tatsächlich sind es bisher zwei Minen, die für den günstigen Preis von 80 Millionen US-Dollar (statt für 300 Millionen US-Dollar) in Staatsbesitz übergingen. Gleichwohl hat Traoré die Absicht verkündet, den Ausländern langfristig alle Minen wieder zu entreißen. Die Souveränität über die Goldvorräte zu erlangen ist nicht nur wichtig, um die Staatseinnahmen zu erhöhen, sondern auch für den Aufbau einer nationalen Währung. Der Tauschwert, den sie repräsentiert, muss abgesichert sein, sodass derjenige, der die burkinische Währung erwirbt, immer einen handfesten Gegenwert erhalten kann, der nur aus Waren oder Edelmetall bestehen kann. Noch gilt in Burkina wie in ganz Westafrika der CFA-Franc, der Franc der Westafrikanischen Zentralbank, der letztlich in Paris reguliert wird.

Baumwolle – einstiger Stolz unter Druck
Auch die Baumwollproduktion – einst das Aushängeschild der Landwirtschaft – leidet unter den instabilen Verhältnissen. Die Anbauflächen sind wegen des Terrorismus deutlich zurückgegangen, rund ein Viertel weniger als früher. Nach einem gescheiterten Versuch mit genetisch verändertem Saatgut setzte Burkina Faso eine Zeitlang verstärkt auf Biobaumwolle. Jedoch ist man wieder auf den konventionellen Baumwollanbau mit Schädlingsbekämpfungsmitteln und Dünger übergegangen, womit man höhere Erträge erzielt. Die burkinische Baumwolle hat aufgrund ihrer Langfaserigkeit eine hohe Qualität. Das Land ist jedoch noch nicht in der Lage, die Baumwolle selbst weiterzuverarbeiten – zu Garn, Geweben und Konfektionen.
Weitere Projekte der Regierung sind: Die Arbeiten am Bau eines neuen Flughafens in Donsin, etwa 50 Kilometer nordöstlich von Ouagadougou, sind im Gange. Innerhalb der Regierung finden Umstrukturierungen statt – so wurde das Transportministerium in das Ministerium für Territorialverwaltung integriert. Fehlentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte werden korrigiert, wie zum Beispiel die nicht gerechtfertigten Gehaltsunterschiede im öffentlichen Dienst. Der Mindestlohn wurde angehoben. Gegen die Korruption wird vorgegangen. Auch „unzivilisiertes“ Verhalten im Straßenverkehr, bei der Umweltverschmutzung et cetera wird jetzt öfter mit Bußgeldern geahndet.
Burkina Faso ist ein Binnenstaat in der Sahelzone. In der heißesten Jahreszeit von März bis Mai liegt feiner, roter Staub über allem. Die Menschen kleiden sich mit Stolz und Sorgfalt. Frauen tragen farbenfrohe Gewänder und kunstvoll gewickelte Tücher – auf dem Kopf, über die Schultern, um die Hüften. Männer erscheinen in frischen, sauberen Hemden. Man grüßt sich höflich mit den Handflächen aneinander vor der Brust; „Bon arrivée“ – Gutes Ankommen, „Wie geht es dir?“ – „Und deiner Familie?“ Diese Freundlichkeit ist keine Touristenmasche – sie ist Tradition. Selbst wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, winken einem Menschen am Straßenrand zu und wünschen einen guten Tag.
Im öffentlichen Leben spielen zur Zeit fünf Organisationsformen eine Rolle:
- Die Gewerkschaften – sie sind eher schwach, bis auf die im öffentlichen Dienst.
- Die politischen Parteien – ihnen ist die Arbeit untersagt, sie sind aber nicht aufgelöst.
- Die Studentenbewegung – auch sie ist momentan schwach.
- Die Medien – es gibt einige regierungstreue Zeitungen wie „Sidwaya“, das staatliche Fernsehen und Radio, dann eine Reihe von privaten Sendern, die aber streng überwacht werden. Jeden Mittwoch findet eine Ministerratssitzung statt. Anschließend wird ein Kommuniqué über die Beschlüsse herausgegeben. Der Kommunikationsservice beim Präsidentenamt versorgt die Presse über WhatsApp mit Texten in Ton und Schrift mit Bildern.
- Die Wayiyan – sie ist eine vornehmlich jugendliche, radikale Organisation, die den Präsidenten und seinen Kurs vehement verteidigt. Sie steht für Volksdemokratie, soziale Gerechtigkeit, Sicherung der Grundbedürfnisse des Volkes und nationale Unabhängigkeit.
Terrorismus – die Geißel des Landes
Während man einerseits daran arbeitet, das Land wirtschaftlich voranzubringen und die Souveränität zu verteidigen, bleibt andererseits die Bekämpfung des Terrorismus eine vorrangige Aufgabe. Die Regierung hat hierfür klare Kernziele formuliert: den Terrorismus zu bekämpfen und die territoriale Integrität wiederzuherstellen, die öffentliche Ordnung zu stabilisieren, die intern Vertriebenen in ihre Heimatregionen zurückzuführen und den sozialen Zusammenhalt im Land zu stärken. Erst dann sollen Neuwahlen ermöglicht werden.
Vom Terrorismus sind insbesondere die Regionen Sahel, Centre-Nord und -Est im Norden und Osten des Landes betroffen – ebenso die angrenzenden Gebiete in Mali und Niger. Die Menschen in diesen Regionen leben in ständiger Angst vor den terroristischen Gruppen.
Eine alleinstehende Frau berichtet: „Immer wenn ich in meinem Garten vor der Stadt arbeite, habe ich Angst, dass sie kommen.“ Eine andere Frau, die geschäftlich im Lande unterwegs ist, teilt mit unterdrückter Stimme mit: „Sie kommen, machen Terror und verschwinden wieder. Beim nächsten Mal durchsuchen sie dein Handy. Wenn ihnen etwas dabei nicht gefällt, schneiden sie dir die Kehle durch. Oder sie nehmen Frauen mit. Oder sie verlangen Lösegeld. Oder sie töten einfach so.“
Die Zahl der Binnenvertriebenen ist auf über zwei Millionen angestiegen – das sind etwa 10 Prozent der gesamten Bevölkerung. Diese Menschen, hier „déplacés internes“ genannt, fliehen aus den äußeren Regionen in das Landesinnere, in die Hauptstadt oder verlassen gar das Land. Überall sieht man ihre provisorischen Unterkünfte: mit schwarzer Plastikplane überzogene Strohhütten. Manche formen Lehmziegel, lassen sie in der Sonne trocknen und bauen sich damit etwas festere Behausungen. Viele Kinder können nicht mehr zur Schule gehen. Familien werden auseinandergerissen. Auch verdeckte, erzwungene Prostitution kommt vor – ein Tabuthema.
Wer sind die islamistischen Gruppen?
In Burkina Faso sind mehrere terroristische Organisationen aktiv. Sie unterscheiden sich nach ihrer Herkunft, Zielsetzung und ihrer Verbindung zu größeren Netzwerken:
- Ansar al-Islam – „Helfer des Islam“, gegründet von einem burkinischen islamistischen Prediger aus der Bevölkerungsgruppe der Fula in der Sahelregion. Die Gruppe steht in Verbindung zur JNIM.
- JNIM (Jama‘at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin) – „Gemeinschaft zur Unterstützung des Islam und der Muslime“, ein Verbund verschiedener Gruppen mit Nähe zu al-Kaida.
- ISWAP („Islamic State West Africa Province“, „Westafrikanische Provinz des Islamischen Staats“) – eine Untergruppe von Boko Haram, offiziell „Jama‘at Ahl as-Sunna li ad-Da‘wa wa al-Dschihad“ („Organisation der Sunniten zur Verbreitung der Lehren und des Dschihad“), mit Verbindungen zum sogenannten „Islamischen Staat“. Die ISWAP agiert in weiten Teilen Westafrikas, auch in Burkina Faso.
Der Lebensunterhalt der Kämpfer beruht auf Raub, Erpressung, „Schutzgeldern“ und Ausbeutung der Bevölkerung. Nur schwer lassen sich bei diesen Gruppen ihre politischen Ziele erkennen. Die Motive scheinen die folgenden zu sein: Macht und wirtschaftlicher Gewinn für die Anführer der Gruppen; sozialer Aufstieg für ihre meist schlecht ausgebildeten Kämpfer; Zerschlagung des säkularen Bildungssystems, Unterdrückung anderer Weltanschauungen und Einführung einer strengen Scharia nach salafistischer Auslegung.
Die militärische und logistische Ausstattung der Terroristen ist vielfältig. Die Waffen stammen zum Teil aus Altbeständen Libyens. Auch werden bei Angriffen auf Armee- oder Polizeiposten Waffen, Fahrzeuge und Kommunikationsmittel erbeutet. Ein besonders perfider Mechanismus: Die Terrorgruppen kaufen Gold von handwerklichen Schürfern zu Schleuderpreisen auf und schmuggeln es über Nachbarländer wie Côte d‘Ivoire ins Ausland – etwa in die Golfstaaten. Im Gegenzug fließen erneut Waffen und Geld in die Region.
Die Destabilisierung Burkina Fasos dient selbstverständlich nicht nur lokalen Machtinteressen. Es ist klar: Der gegenwärtige Regierungskurs in Richtung Souveränität und Unabhängigkeit soll gezielt untergraben werden. So wird es häufig gemacht – man erzeugt Krisen, schwächt die Bevölkerung und hofft, dass der Widerstand gegen einen „Regimewechsel“ oder eine „farbige Revolution“ bröckelt. Präsident Traoré selbst äußerte öffentlich: Man kenne die Hintermänner. Neben Katar und Kuwait stecken sie auch in Paris, Washington – und aus Kiew kommen ihre Handlanger.
Staatsbudget – zwischen Verteidigung und Entwicklung
Der Kampf gegen den Terrorismus verschlingt enorme Ressourcen – Mittel, die dem zivilen Wiederaufbau sehr fehlen. Das Staatsbudget für 2025 beläuft sich auf rund 4,8 Milliarden Euro. Davon müssen allein 1,5 Milliarden Euro (27 Prozent) für Verteidigung und Sicherheit aufgewendet werden.
Die restlichen Ausgaben verteilen sich auf die Bereiche Gesundheit und Bildung (2,2 Milliarden Euro, etwa 40 Prozent), öffentliche Gehälter und sonstige Verwaltungsausgaben (1,5 Milliarden Euro, etwa 26 Prozent) und die ländliche Entwicklung (0,3 Milliarden Euro, etwas 5,6 Prozent). Diese Zahlen zeigen auch, welche Bedeutung der soziale Bereich für die Regierung hat.
Bei einem längeren Besuch eines afrikanischen Landes passiert etwas Merkwürdiges: Man verliert die Reste eines unbewussten Rassismus, von denen man dachte, man hätte sie gar nicht mehr. Sie werden einem jedoch daran bewusst, wie man einen schwarzen Menschen anschaut: Immer werden die Blicke begleitet von Gedanken, von eingefleischten ideologischen Versatzstücken, von Befürchtungen, sich inkorrekt zu verhalten. Erst in der massenhaften Begegnung mit der Bevölkerung verlieren sie sich, machen neuen Erfahrungen Platz, und du kannst den Menschen normal begegnen: man lacht, scherzt und plaudert zusammen. Sincère reconnaissance! – Aufrichtige Dankbarkeit!
Ein riskanter Kurs
Burkina Faso und auch Mali und Niger sind typische Länder, die für die aktuell fortschrittlichste Tendenz im globalen Süden stehen. Diese Länder wollen sich entwickeln, ihre Produktivkräfte stärken, den Jahrhunderte dauernden Stillstand überwinden.
In ihrem industriellen Entwicklungsprozess werden sie nebenbei einige Etappen überspringen, für die wir Jahrzehnte gebraucht haben – zum Beispiel den Verbrennungsmotor oder Kohlekraftwerke. Möglich wird dies auch durch die politische und wirtschaftliche Unterstützung eines erstarkten Russlands und Chinas, etwa im Rahmen der BRICS-Kooperation. Die Produktionsverhältnisse, in denen jene Länder ihre Produktivkräfte steigern, ähneln sich dabei stark: Es gibt einen großen staatlichen Sektor, der die Rohstoffvorkommen in Besitz nehmen will zur Finanzierung eigener Projekte und zur Hebung sozialer Standards. Daneben gibt es einen kleineren privaten Sektor in der Industrie und einen großen in Kleingewerbe und Landwirtschaft. Solche Strukturen findet man in unterschiedlichen Ausprägungen überall auf der Welt: in Venezuela, Bolivien, selbst in Russland.
Das Modell ähnelt auch stark dem chinesischen mit dem bedeutenden Unterschied, dass in China eine kommunistische Partei den Staat führt mit einer klaren Ausrichtung auf den Sozialismus. Das chinesische Modell ist gleichsam der Prototyp, der den anderen immer einen Schritt in der Entwicklung voraus ist. Die Länder des globalen Südens stehen vor einer klaren Alternative: Entweder sie ordnen sich weiterhin dem imperialistischen Weltsystem unter und verharren in Abhängigkeit und Armut, oder sie schlagen den Weg der eigenständigen Industrialisierung ein – mit einer eigenen Industrie, einer entstehenden Arbeiterklasse, einer nationalen Bourgeoisie und einem starken, regulierenden, dominierenden Staat.
Afrika wird sich – davon bin ich überzeugt – ganz sicher industrialisieren. Wenn wir Kommunistinnen und Kommunisten schon davon sprechen, in einer Epoche zu leben, in der sich die Übergangsprozesse vom Kapitalismus zum Sozialismus abspielen, dann scheint dieses Modell ein Abschnitt in diesem Übergang zu sein.
Der neue Kurs Burkinas ist kein Spaziergang, sondern ein riskantes Manöver auf offenem Meer. Doch wer das Land betritt, spürt sofort die Entschlossenheit, die Integrität und die Hoffnung der Menschen auf Fortschritt und ein besseres Leben. Der Weg ist steinig, wahrscheinlich langwierig, aber er ist eingeschlagen. Und man will nicht zurück.
Weitere Informationen über Burkina Faso
Deutsche Medien berichten kaum über Burkina Faso – und wenn, dann als Katastrophenberichterstattung aus der Ferne. Vor Ort gibt es keine deutschen Korrespondenten.
Eine Brücke baut die Deutsch-Burkinische Freundschaftsgesellschaft e. V. (DBFG). Sie informiert auf ihrer Website dbfg.de über Burkina Faso, gibt praktische Reisehinweise und berichtet in ihrem monatlichen Newsletter über aktuelle Entwicklungen – alles auf Deutsch.
Wer sich tagesaktuell informieren möchte, sollte gut Französisch sprechen. Die staatliche Nachrichtenagentur Agence d’Information du Burkina (AIB) berichtet detailliert und übersetzt immer wieder Beiträge ins Deutsche: aib.media. Zu ihr gehört die Tageszeitung „Sidwaya“. Das Leitmedium Burkinas berichtet auch online: sidwaya.info.
Der Revolutionär Thomas Sankara steht im Mittelpunkt der gleichnamigen, umfangreichen Website thomassankara.net. Sie wird von einem Burkinabe betrieben, der in Europa lebt, anonym bleiben möchte und sich deshalb „Mr. X“ nennt. Zumindest Teile dieser Netzfundgrube sind auch auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen verfügbar.
Vorsicht ist auf YouTube und TikTok angeraten: Dort landen immer wieder Fake-News über die Übergangsregierung Ibrahim Traorés. Teilweise stammen die von wohlmeinenden Fans des jungen Staatschefs, die der Sache damit einen Bärendienst erweisen.