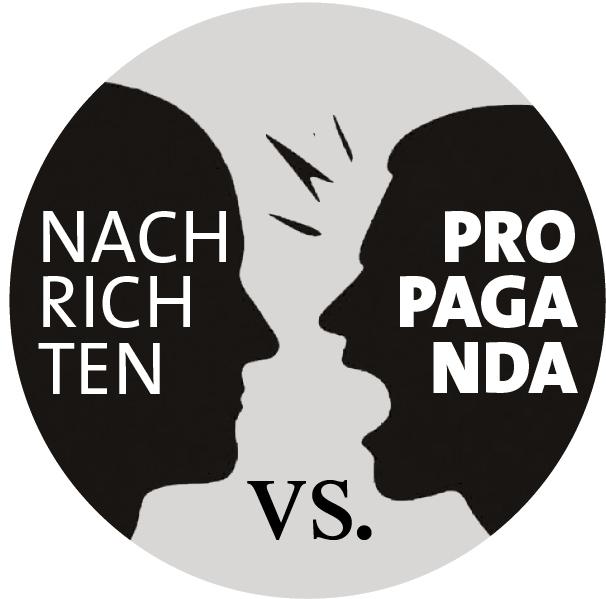„Koche mit Liebe, würze mit Bino“ – Bino, das war die DDR-Antwort auf die Maggi-Würze für Suppen aller Art. Hergestellt wurde die Speisewürze schon seit 1948 vom Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld Nord. Manfred Krug zitierte den Slogan übrigens im Titelsong des Films „Auf der Sonnenseite“, der im Jahr 1961 in die Kinos kam.
Mitte der 1970er Jahre kam in der DDR auch eine neue Fast-Food-Spezialität in die Imbissbuden: die Ketwurst, der DDR-Hotdog, ein Würstchen in einem länglichen Brötchen, gewürzt mit Ketchup, mild oder scharf, ganz nach Geschmack des Genießers. Daneben rangen die Bock- und Currywurst mit und ohne Darm um die Gunst der DDR-Münder. Doch über allen thronte in der Beliebtheit die Thüringer Bratwurst, mit und ohne Kartoffelsalat oder Schrippe, garniert mit reichlich „Bautz’ner Senf mittelscharf“. Für mich muss es immer noch der scharfe sein. Hergestellt wurde er in der VEB Essig- und Senffabrik Bautzen, später VEB Lebensmittelbetrieb Bautzen. Seit 1992 im Besitz der bayrischen Develey Senf & Feinkost aus Unterhaching, die nun ihren Bautzner Senf dazu gibt.

Extra scharf und begehrt war das Senfpulver aus der Sowjetunion, mit etwas Wasser angerührt ergab es eine teuflisch scharfe Angelegenheit und war eine gute Grundlage für Marinaden, Suppen oder als Basis für Senfsaucen. Der Verbrauch von Senf in der DDR lag deutlich über dem Verbrauch in der BRD. Er war schlicht ein Grundnahrungsmittel. Die Produktion erfolgte in mehreren Fabriken im gesamten Land, darunter in Bautzen, Jüterbog, Erfurt und Tutow. Rezeptangebote reichten von Senfsuppen oder Eiern in Senfsoße bis hin zu Senffleisch. Senf aus Bautzen wird auch heute noch in großer Menge produziert mit einem Marktanteil von 70 Prozent in Ostdeutschland und 23 Prozent bundesweit.
Daneben fanden Gewürzmischungen wie das „Geflügelgewürz“ oder die „Broiler-Gewürzzubereitung“ Verwendung in der Gastronomie und in den Betriebskantinen. Doch dazu gab es mahnende Worte für die Verantwortlichen in den Betriebsküchen. Es solle sparsam gewürzt werden, denn ausländische Gewürze wie Pfeffer, Piment, Muskat, Lorbeer, Nelken würden leider auch in der Gemeinschaftsküche immer stärker in Mode kommen. Sie sollten besser den Gaststättenküchen vorbehalten bleiben, da bei verschiedenen Spezialgerichten nicht auf ausländische Gewürze verzichtet werden könne. Der „werktätige Mensch nehme sein Essen selten regelmäßig im Gasthaus ein, es sei demzufolge ein gleichmäßiger, ständig wiederkehrender Reiz dieser Gewürze nicht zu befürchten. In der Gemeinschaftsverpflegung jedoch könne es bei täglichem Genuss ausländischer Gewürze zu gesundheitlichen Schäden führen“, so hieß es in einer Anweisung, deshalb sei es notwendig, heimische Gewürze und Würzkräuter durch die Anlage eines Betriebskräutergartens sicher zu stellen. ‚Basis bildete ein Leitfaden mit dem Titel: „Der Betriebskräutergarten, ein Leitfaden für Anlage und Pflege“.
Über die Rolle der Gewürze für die Gesundheit hat es in der Vergangenheit oft die widersprüchlichsten Dispute gegeben. Unser Geschmack ist erworbener Geschmack, er ist nicht angeboren, sondern muss anerzogen werden. Die Frage, ob Pfeffer schädlich sei, bewegt bis heute manche Gemüter. Schon auf der Hochzeit Karls von Burgund im Jahre 1468 sollen die Köche unter anderem kiloweise Pfeffer verbraucht haben. Es galt als vornehm, die Speisen zu verpfeffern und zu überwürzen, so dass niemand mehr herausschmecken konnte, was er eigentlich im Mund hatte. Selbst dem Paprika und Senf dichten besonders Misstrauische gerne eine schädliche Wirkung an. Gewürze sind wieder „Mode“, davon sprach schon in den 1970er Jahren Ursula Winnington, die Grande Dame der Kochkunst der DDR. Ein dekoratives Regal mit hübsch beschrifteten Gewürzdosen in der Küche lasse noch lange nicht auf einen Menschen schließen, der ihren Inhalt zu gebrauchen wisse, urteilte sie. Für einen guten Koch sei es ein Armutszeugnis, Salz anstelle von Gewürzen zu verwenden. Man greife aus Gewohnheit lieber zu Pfeffer und Kümmel und stelle den Senftopf auf den Tisch. Dabei sei es mit dem Würzen wie mit dem Kochen: Nur durch Kochen werde man zum Koch, nur durch Würzen – Würzmeister. Obwohl sie auch feststellte, für den Umgang mit den Gewürzen gebe es keine goldenen Regeln. Mit viel Phantasie kochte sie chinesische Gerichte ohne Soja und Bambus. Legendär ihr chinesischer Feuertopf. „Dafür nahmen wir“, so sagte sie mir einmal beim gemeinsamen Kochen, „Erwa-Speisewürze und gelben Paprika aus Bulgarien“. Gewürze waren für sie das I-Tüpfelchen für Speis und Trank. Für die an den Herden der Betriebskantinen tätigen Frauen und Männer der weißen Zunft hatte man aber vorsorglich in Sachen Gewürze eine Anordnung zur Hand, denn beim Würzen solle man sich nicht so sehr auf sein sogenanntes Fingerspitzengefühl verlassen. Statt des Würzens mit „Augenmaß und Handgewicht“ sei es unbedingt erforderlich, sich der Waage oder eines Messgeräts zu bedienen. Eine Warnung, die nicht ganz unbegründet war, denn so manche Köchin oder Koch war, so die Meinung der Tischgäste, „verliebt“, wenn zu viel des guten Salzes im Essen war. Also aufgepasst beim Würzen, es darf nicht immer eine Prise mehr sein!