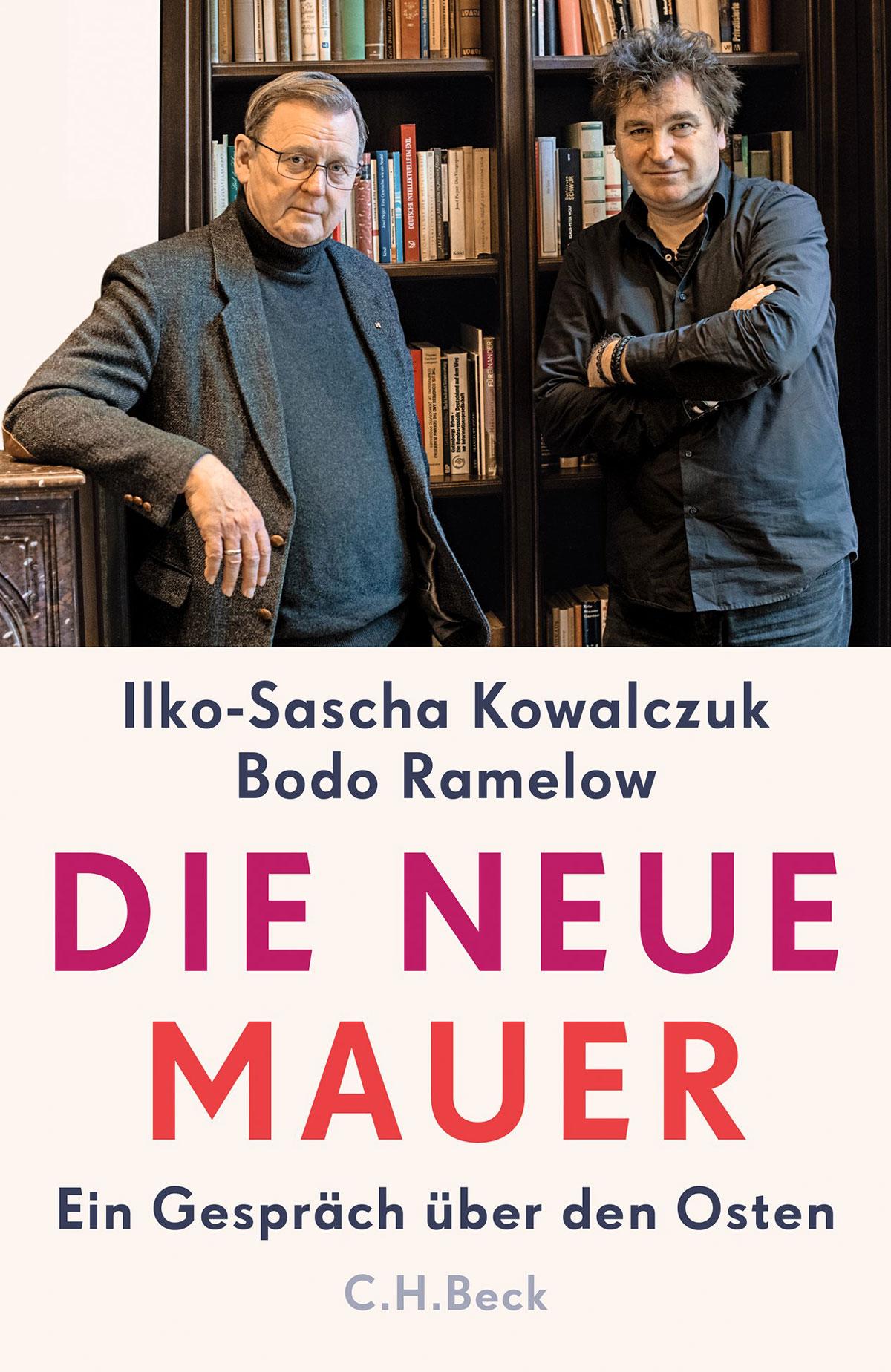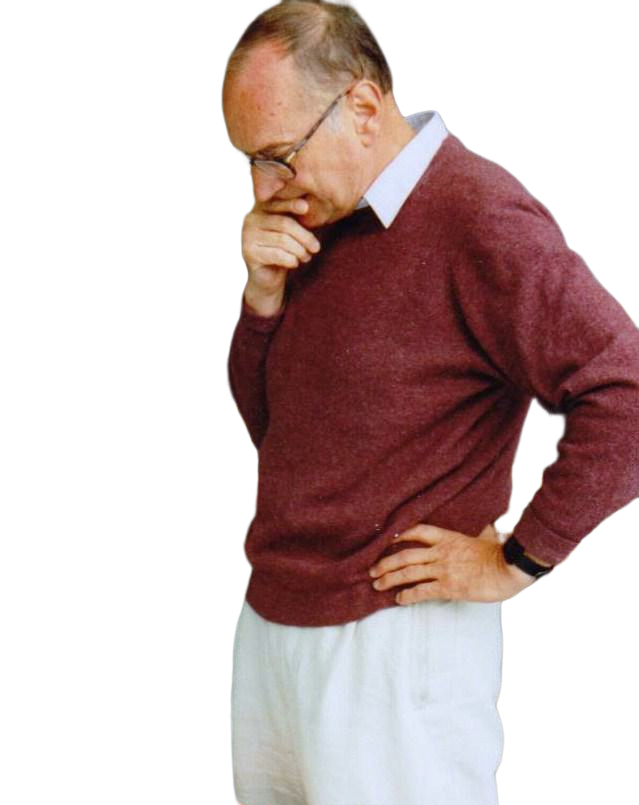Grohn: Wir haben Fanpost im Chat erhalten! User „Didi_Diedrichsen“ will wissen, ob wir an einem Beispiel erklären können, wie das Verhältnis zwischen Kapital und Influencern aussieht.
Meier: Nehmen wir mal das Beispiel Literaturkritik: Wo früher Feuilleton oder Literarisches Quartett die ADHS-freien Boomer bespaßten, haben wir jetzt die „Heute stelle ich ein Buch vor“-Mausis aka „Bookfluencer“. Diese Szene bespricht zwar meist nur den „Young Adult“-Schund, den die großen Verlags- und Vertriebsmonopole verkaufen, ist aber dennoch ein beachtlicher Markt. Das sieht man bei den Buchmessen, die ohne Mangas, Comics, Jugendroman, Verkleidungsfans oder Influencer kaum noch laufen würden. Stell dir vor, Reich-Ranicki müsste die heutigen Fantasy-Schweinereien besprechen. Die „Buchmausis“ kriegen sowas hinterhergeworfen, posten dafür irgendwas, et voilà, fertig ist die Rezension: „Nicer Schmöker, danke an Verlag XY.“
Grohn: Nur hört es bei den Büchern ja nicht auf: Inzwischen kann jede Freizeitbeschäftigung „viral“ gehen. Egal, was es ist, egal, wie gut man es kann: Solange es im selbstbesoffenen Brustton präsentiert wird, findet sich ein Publikum: „Hier, ich mache Skulpturen aus Mikroplastik!“ – „Hey, ich koche Pasta mit Sahne und LSD!“ – „Hallo, ich bastele mit meinen Kindern Panzersperren gegen den Russen!“ Hinter jedem Steckenpferd steht heutzutage eine komplette Industrie, die aus Hobby-Enthusiasten schnell Billig-Mannequins für die Marktnischen macht, sobald die Schallmauer der „sozialen“ Reichweite durchbrochen ist.
Ein teuflischer Kreislauf: Die Portale bieten anhand der gesammelten Nutzerdaten dem Kapital die passenden Werbeslots an, das dann seine PR-Maschine anwirft; die „Influencer“ werden mit dem Krempel beschenkt und machen dann Werbung dafür. Ihre Follower sehen das und generieren so wieder neue Daten für die Portale. Es läuft wie, äh – geschmiert.
Meier: Den Monopolen bleibt ja für ihren Absatz inzwischen nix anderes mehr übrig, als noch in die allerkleinste Nische des Privatlebens zu drängen; das ist die Tendenz des späten Imperialismus: Selbst die Dinge, von denen wir nicht glauben, dass sie der Kommodifizierung anheimfallen könnten, müssen zur Systemstabilisierung in den Warenkreislauf einfließen. In diesem Strudel verlieren sich so die Influencer schnell in einer virtuellen Identitätsmaske. Denn der Druck beziehungsweise Zwang, neue „Inhalte“ zu präsentieren, führt zur Komplettverwertung ihres Privatlebens, zur ständig neuen Inszenierung. So verschmelzen Maske und Mensch. Der Influencer produziert nicht mehr mit Fertigkeiten Waren, sondern wird aufgrund dieses Sachzwanges selbst zu einer, die sich irgendwie verkaufen muss – der blanke Warenfetisch in Menschengestalt.
Grohn: Es stellt heute schon eine eigene Fertigkeit dar, die Fähigkeit zu besitzen, sich in die Erfordernisse des Streamens und Postens als warenästhetisch angemessene Präsentationsfähigkeit der eigenen Charaktermaske einzupassen. Letztlich ist sie inzwischen eine Arbeitsmarkterfordernis, die sich die Nonfluencer, Podcaster und Halbjournalisten mit Medienzirkus-Ambitionen schon in Jugendjahren freiwillig selbst zulegen – ganz nach dem neoliberalen Bild des engagierten Jungselbstständigen.
Meier: Während andere Jugendliche Parteiarbeit machen, Theorie lesen und mit Freunden oder Genossen Politik diskutieren, beschäftigen diese Leute sich in ihrer Freizeit mit dem Testen von Mikrofonen, Kameras, Tablets, Sound-Apps und sonstigem technischen Equipment.
Grohn: Und das spielt dem Kapital in die Hände, das jede Form der Selbstausbeutung begrüßt, die außerhalb eines klassischen Lohnarbeitsverhältnisses steht, und mit ihren Mittel fördern wird.
Meier: Das ist die Strategie der Monopole in der Nutzung der Influencer: Jede Form gesetzlich, am besten noch tariflich geregelter Bezahlung bekämpfen und jeden Menschen in die „Selbstständigkeit“ drängen. Der Erfolg im Internet, die einst bei laufender Kamera Computerspiele zockten und heute eine Fernsehshow haben – das schafft natürlich Anreize für die junge Generationen, ihre Freizeitbeschäftigung, ihre Schrullen oder die Präsentation ihres Körpers als Einkommensquelle zu betrachten. In der Hoffnung, dass irgendwer sie „entdeckt“ und zum Star krönt. Da sind unsere „Politfluencer“ keine Ausnahme.
Grohn: Der neue American Dream – vom Selbstvermarkter auf YouTube zum Medienhampelmann.
Meier: Das ist kein US-amerikanischer, sondern ein feuchter Traum des Kapitals. Jeder seine eigene Werbetrommel unterm Bann des Monopols.
Grohn: Aber eine beachtliche Anzahl glaubt diesen Quatsch: Sie glauben an Ruhm, also „Reichweite“, weil sie meinen, das als Basis für ihren politischen Aktivismus zu benötigen. Dementsprechend sieht dann aber auch der Aktivismus aus – einer, der sich von der sonstigen medialen Propaganda nicht mehr unterscheidet. In den herkömmlichen TV-Formaten dienen die YouTuber als Verjüngungskur wie Bestätigung des bürgerlichen Medienapparats zugleich.