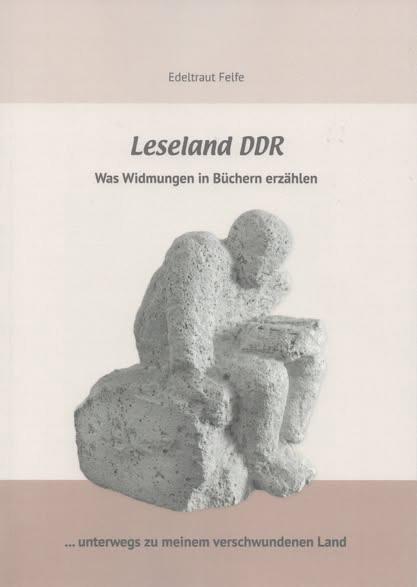„Sie lesen ja ein Buch“, hörte ich zwei junge Ärzte ausrufen, in deren Warteraum ich saß. Wer heute (öfffentlich) ein Buch liest, ist ein vergreister Exot, dabei gehörten Bücher, Filme, Gemälde, Theaterstücke zu unserem früheren Leben wie das tägliche Brot. Edeltraut Felfe, Jahrgang 1943, griff zur Feder und hielt ihre Gedanken dazu in dem gut lesbaren und ansprechend gestalteten Büchlein fest: „Leseland DDR. Was Widmungen in Büchern erzählen … unterwegs zu meinem verschwundenen Land“.
Professor Edeltraut Felfe ist Juristin und wurde 1992 an der Greifswalder Universität „natürlich“ gekündigt. Die Idee zum Schreiben ergab sich aus Widmungen, welche sie vor allem in Büchern fand, die ihr Verein „Bücherfreunde Greifswald“ vor der Müllhalde rettete. Zu dessen Kernbestand zählen die „überflüssig“ gewordene Bücherei des Kernkraftwerkes Lubmin, der SED-Kreisleitung sowie die Atelierbibliothek des Grafikers Armin Münch. Greifswalder Bürger spendeten so viele Bücher, vor allem aus DDR-Verlagen, dass der Verein mittlerweile 35.000 Bände Belletristik, Kinderbücher, Kunstbände bewahrt. Die 45 Vereinsmitglieder leihen Bücher aus, veranstalten Lesungen, Bücherbasare und bestücken die im Stadtgebiet Greifswald verteilten Bücherbäume, die selbst kleine Kunstwerke sind.
Bücher verschenkte man in der DDR häufig, an Kinder, Freunde und Arbeitskollegen: für besondere Leistungen, erfolgreiche Weiterbildungen, für Neuererideen und Zirkelarbeit, fleißiges Altstoffsammeln, gute Zensuren, zum Geburtstag, Frauentag, zur Konfirmation, als Dank an die Patenbrigade. Unter den Widmungen findet sich Witziges wie der Eintrag in Scholochows „Ein Menschenschicksal“: „Dem Major der Feuerwehr als Anerkennung für ausgezeichnete Leistungen im Aquariumszirkel, 26.1.67“; Kluges: „Kommen muß die Vergeistigung der Massen“ von Albert Schweitzer in einem Buch über ihn oder „Die weitere Vertiefung des Wissens ist der beste Beitrag zum aktiven Kampf um Frieden, Einheit und Demokratie“ aus den frühen Fünfzigern. Inmitten dieser Schätze erinnert sich Edeltraut Felfe an „all die Erzählungen, Romane, Gedichte, schöne Bücher eben“, die seit der Kindheit zu ihrem Leben gehören. Sie will weitergeben, dass „die Bücher und ihre Widmungen etwas vom Wesen der DDR erzählen … weil sozialistische Ideen lebendig waren, die gegenwärtig und künftig gebraucht werden“.
An den großen Anspruch des „Bitterfelder Weges“ erinnert die Autorin mit Brigitte Reimanns „Franziska Linkerhand“. Da ging es um Liebe, Träume, Berufstätigkeit von Frauen, die Chance, „als ganzer Mensch zu leben“, um Selbstbewusstsein auch aus ökonomischer Unabhängigkeit. „Bücher helfen verändern“, war Brigitte Reimann überzeugt. Christa Wolfs spätere Enttäuschung wird erwähnt, dass der „Bitterfelder Weg“ von der Politik „ganz rigoros beschnitten wurde“, als die Schriftsteller eben begannen, auch über die ökonomische Realität in diesem Land zu schreiben. Edeltraut Felfe zitiert Literaturwissenschaftler, die dem Weg dennoch das Verdienst bescheinigen, „bei den heute sogenannten bildungsfernen Schichten ein Interesse an Kunst und Literatur angeregt“ zu haben.
Die zeitweise heftigen Konflikte zwischen Künstlern und der Macht werden nicht ausgespart. Einige meinten, durch die „Diktatur“ in die „Zwangsjacke des sozialistischen Realismus“ gesteckt zu werden. Aber manchmal hatte die Macht auch Sorgen mit den Künstlern; gut, dass die Autorin festgehalten hat, was Eva Strittmatter 1980 an Jürgen Kuczynski schreibt: „Wir, Erwin und ich, sind seit langem sehr glücklich zu wissen, welch geistiges Potential in dieser Gesellschaft (bezogen auch auf Leserbriefe) steckt … Die Liebe zu den kleinen Leuten hat gewiß mit der Herkunft zu tun. Wir haben viele Bekannte, Genossen, die aus dem Bürgertum stammen. Ihr Verhältnis zu jenen Menschen ist doch immer eine Sache des Verstandes geblieben. Im Grunde haben sie sie nie für voll genommen, wenn sie auch für sie gekämpft haben. Aber wir meinen, daß gerade die kleinen Leute im Sozialismus aufgehoben sein sollten, daß der Sozialismus für sie gemacht wird. Keinesfalls als Experiment für Intellektuelle.“
Sozialismus war ein Lernprozess für alle Beteiligten – die Leser, die Künstler und die Funktionäre. Sich die Kunst zu erschließen, mit ihren eigenen Gesetzen, macht Mühe. Bei uns brauchten sich Leser und Schriftsteller. Die Vielzahl der Leserbriefe und Lesungen waren Symptom für Kunstbedürfnis und Lebensnähe. Die Witwe des Schriftstellers Günter Görlich reagierte auf das „Leseland“-Buch mit der Bemerkung: „Bei uns war immer viel los in der Wohnung, die Leute (Leser seiner Bücher) wollten mit ihm über ihr Leben diskutieren.“ Humanistische Literatur kann formend sein für Charakter und Weltanschauung, setzt aber auch Wissen und Reife voraus. Für uns war wertvolle Literatur erreichbar, preiswert, wir behandelten sie in der Schule, diskutierten im Kollektiv. Ich erinnere mich, wie sehr ich vom Buch „Olga Benario“ von Ruth Werner geprägt wurde, als ich 14 Jahre alt war.
Im „Leseland“ wird ein Buch mit Gedichten für die Grundschule aus dem Jahr 1949 einem Lesebuch für Pommern von 1909 gegenübergestellt. Im ersten sind Themen wie Völkerfrieden, Freiheit, Heimat, Freundschaft Anliegen der Kulturpolitik der jungen DDR; im zweiten die Kriegstüchtigkeit: da geht es gebückt und rührselig um Gott und Kaiser, Paraden, treue preußische Soldaten. „Auch steht der Kaiser mit Tränen in den Augen einem glücklich sterbenden Soldaten bei.“ Kriegstüchtigkeit wird von heutigen Kinderbüchern wieder erwartet. Sie sollen die kleinen Leser im Alter von drei und vier Jahren aufwärts schon mal darauf vorbereiten, dass Papa oder die gleichberechtigte Mama „lange weg ist“, weil es „einen Menschen auf der Welt gibt, der keinen Frieden will“.
Wie geht es weiter? Die Bücherretter bangen und mühen sich um die Zukunft ihrer Literatur. Sollen die Aitmatow und Simonow, Nexö und Arnold Zweig, Renn, Hermann Kant und Elfriede Brüning, Heinz Kahlau und Uwe Berger, Harry Thürk und Inge von Wangenheim, Hedda Zinner und Wolfgang Schreyer, Bodo Uhse … gerettet worden sein, um doch auf dem Müll zu landen?
Der Artikel erschien zuerst in der September-Ausgabe des „RotFuchs – Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke“, rotfuchs.net
Edeltraut Felfe
Leseland DDR
Was Widmungen in Büchern erzählen
nordlicht verlag, 128 Seiten, 12 Euro
Das Buch ist bei der Autorin zu beziehen: edeltraut.felfe@gmail.com oder telefonisch: 03834/4482413