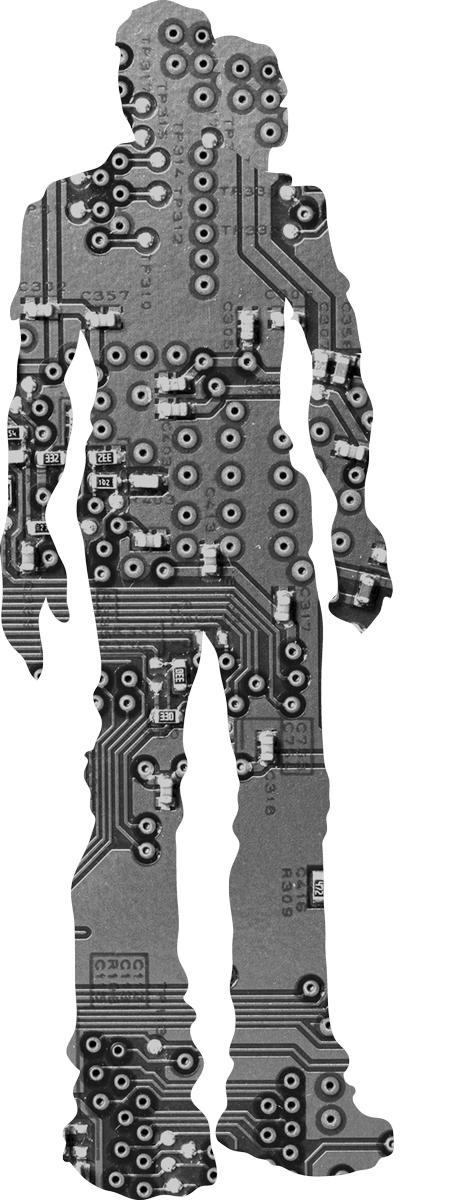In den späten sechziger Jahren machte ich eine Lehre als Spezialglas-Facharbeiter in meiner Heimatstadt Torgau. Dort produzierte man seit über dreißig Jahren Glas. Zwar war neben dem alten Betriebsteil ein neuer errichtet worden, das ganze Unternehmen hieß jetzt VEB Flachglaskombinat, kurz Flako, und war der größte und wichtigste Glashersteller der DDR. Aber die Ausbildung der Oberschüler, die sich neben der Lehre aufs Abitur vorbereiteten, erfolgte im alten Teil. Wir schoben an Schienen an der Decke Behälter zu den einzelnen Füllstationen, zogen an der Strippe und ließen Sand, Soda, Flussspat und andere Zutaten hineinrutschen. Dann wurde dieses Gemenge gemischt und laufend in die Schmelzwanne geschoben, wo es kontinuierlich bei anderthalbtausend Grad zerfloss. Am Ende lief das rotglühende Glas durch eine auf der Schmelze schwimmende Düse, durch die das Glasband über siebzehn Walzenpaare nach oben zur Abbrechbühne gezogen wurde. Dort brach man es per Hand, trug die schwere Platte zu einem Tisch, warf diese darauf, zerlegte sie in die vorgegebenen Streifen und stellte die Scheiben auf Böcken ab. Rund um die Uhr. Eine schweißtreibende, körperlich anstrengende Arbeit nach alter Technologie. Ich habe dort im Vier-Schicht-System malocht. Und die Kraft der Klasse gespürt, der ich für kurze Zeit angehörte, und meine ersten Texte geschrieben für die Betriebszeitung, die, nomen est omen, „Klare Sicht“ hieß …
Heute wird Flachglas ganz anders hergestellt, computergesteuert und weitgehend von Maschinen besorgt. Als ich jüngst einen Beitrag im „Freitag“ las, in welchem ein Filmrezensent darüber jubelte, dass „mittlerweile“ der „gesamte Bestand der Staatlichen Filmdokumentation“ (SFD) dokumentiert sei und „online im digitalen Lesesaal des Bundesarchivs besichtigt werden (kann), kostenlos und ohne Anmeldung“, begab ich mich im Internet auf die Suche. Und in der Tat: Es wurde dort auch die Existenz dreier Filme aus dem Flachglaskombinat Torgau angezeigt. Allerdings erschien beim Anklicken des Titels die Zeile „Das Video ist aus rechtlichen Gründen online nicht verfügbar und liegt nicht digital vor.“
Das wiederholte sich bei Dutzenden anderen Titeln auch, die aufzurufen ich mich bemühte. Des Rezensenten Loblieb auf die komplette Digitalisierung („Angesichts knapper Kassen eine bemerkenswerte Leistung“) war offenbar nur verbalisierte heiße Luft, zeitgemäße Propaganda.
Gewiss traf dies auch auf seine inhaltliche Bewertung einzelner Streifen zu, die er vielleicht im Zeughauskino (das befindet sich an der Spreeseite des Deutschen Historischen Museums in Berlin) gesehen hatte. Dort zeigt man seit 2014 solche Filme in thematisch sortierten Reihen. Diese Veranstaltungen erfreuen sich großer Nachfrage, sie sind stets ausverkauft. Denn: Das sind O-Töne aus der DDR, vom heutigen Zeitgeist unverstellte Einblicke in den Alltag des untergegangenen Landes: mit seinen Härten, seinen Unzulänglichkeiten, mit den Ärgernissen, aber eben auch mit seinen sympathischen Seiten. Wie die Leute redeten, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen! Allein an den Umgangsformen und Gesten sieht man erstens, welche Klasse hier das Sagen hatte, und zweitens, wie „Demokratie am Arbeitsplatz“ real funktionierte. Wie da der Arbeiter mit seinem Betriebsdirektor sprach, sagenhaft. Heute arbeitsplatzgefährdend.
Zwischen 1971 und 1986 produzierte die Staatliche Filmdokumentation dreihundert solcher Filme, mehr als die Hälfte davon waren Interviews mit unbekannten und prominenten Arbeiterveteranen, Antifaschisten und Akademikern, die über sich und ihr Leben berichten – von Bruno Apitz (Autor von „Nackt unter Wölfen“) über den Schauspieler Erwin Geschonneck und die Spanienkämpferin Eva Jonack bis zu Alfred Zimm, Neulehrer nach dem Krieg und dann Forschungsdirektor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Es sind berührende zeitgeschichtliche Zeugnisse, die dort auf Zelluloid für die Nachgeborenen festgehalten wurden.
Nun kann man sich darüber mokieren, dass die Filmemacher meist nur in Berlin drehten, weil ihnen – angeblich – nur 70 Liter Benzin im Monat bewilligt wurden. Oder so tun, als sei jeder Film zur geheimen Verschlusssache erklärt worden, weil die DDR darin ungefiltert vorkam (was für ein blödes Argument: die potenziellen Zuschauer lebten doch in dieser Wirklichkeit). Diese Aufnahmen waren von Anfang an nur fürs Archiv bestimmt. Und Nachfragen bei Interviews unterblieben nicht, weil die Beteiligten – wie es in der Rezension höhnend hieß – „die berühmte Schere im Kopf hatten“. Käse, es herrschte in der DDR damals einfach eine andere Gesprächskultur als heutzutage. „Das Wort Zensur fällt kein einziges Mal.“ Aber hallo!
Halten wir also fest: Im Bundesarchiv sind an die 320.000 Filme archiviert, darunter knapp 12.000 aus der DDR. Und davon wiederum sind 2.332 Dokumentarfilme, von denen lediglich 270 von der Staatlichen Filmdokumentation (SFD) stammen. Nicht alle sind, entgegen der Behauptung, online zu sehen, aber die, die man sehen kann, sind höchst informativ und erhellend – sofern man sich diesen Filmen unvoreingenommen und frei von Klischees und Vorurteilen nähert. Zum Beispiel den von 1982 mit dem Titel „Formen des Zusammenlebens: Unverheiratete Partner mit Kind“. Allein die Straßenumfragen zur Lebensweise in diesem halbstündigen Film entschädigten mich reichlich für den ungesehenen Streifen übers Flako. Das übrigens am Ende der DDR das modernste Flachglaswerk Europas war und dann privatisiert wurde. Heute gehört es einem börsennotierten französischen Industriekonzern.
Im Internet finden sich die Filme, sofern real vorhanden und auch online zugänglich.