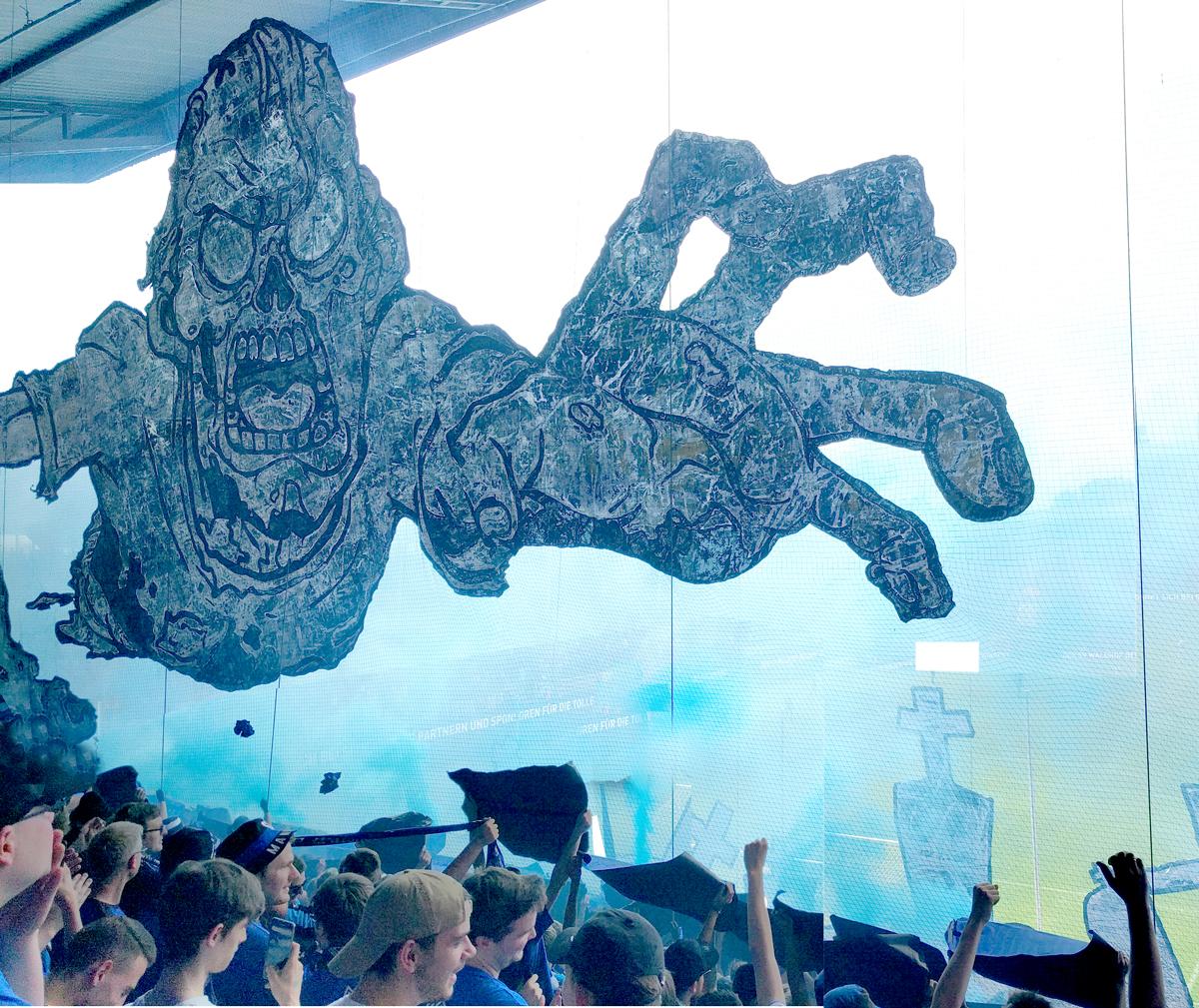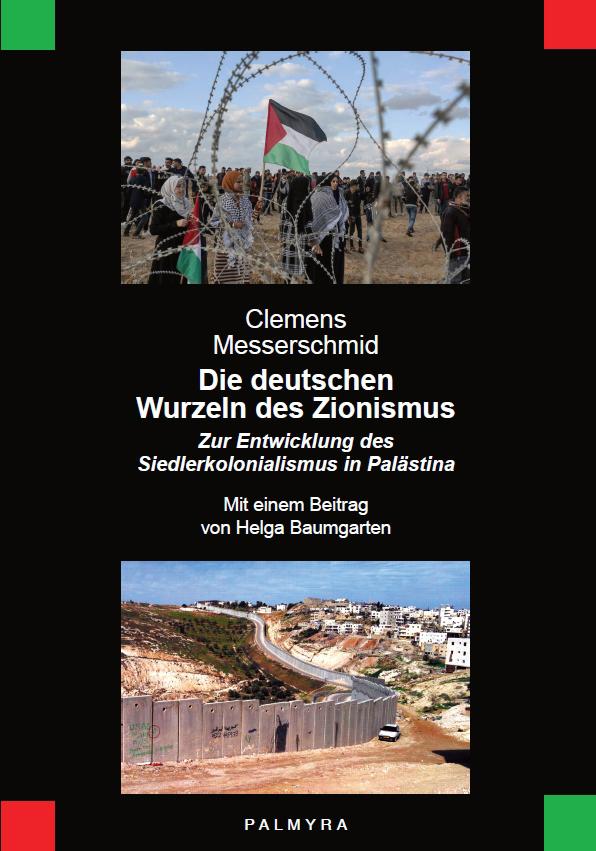Rainer Perschewski skizziert in seinem Referat, das er Anfang September beim Aktiventreffen der Kommission Betrieb und Gewerkschaft der DKP gehalten hat, die antimonopolistische Strategie der Partei mit Blick auf die Gewerkschaften. Der Sekretär für Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit der DKP geht auf die aktuelle Krise und Kriegspolitik ein, formuliert als Hauptaufgabe der DKP die Herauslösung der Arbeiterklasse und der Gewerkschaften aus dem Kriegskurs und benennt zudem die Folgen der Hochrüstung – sowohl auf unsere Arbeits- und Lebensbedingungen als auch die ideologischen Folgen. Wir dokumentieren das Referat in Auszügen.
Antimonopolistische Strategie und Gewerkschaften
Die antimonopolistische Strategie der DKP richtet sich gegen die Herrschaft des Monopolkapitals. Denn wenige Großkonzerne und Banken kontrollieren die Schlüsselbereiche der Ökonomie und bestimmen, vermittelt über den bürgerlichen Staat, die politischen Leitlinien. Dabei ist die Erkenntnis wichtig, dass der Staat im Kapitalismus – und erst recht im Imperialismus – kein neutraler Schiedsrichter, sondern ein Klassenstaat ist. Er organisiert und sichert die Bedingungen kapitalistischer Profitproduktion. Wie Engels es formulierte, ist der bürgerliche Staat nichts anderes als der „ideelle Gesamtkapitalist“. Die Form mag demokratisch sein, der Inhalt bleibt jedoch die Durchsetzung der Interessen der herrschenden Klasse.
Daraus folgt, dass der Kampf um gesellschaftliche Veränderung nicht als Bittstellung an den Staat als scheinbar neutrale Instanz geführt werden kann. Es geht vielmehr um das Verändern der Kräfteverhältnisse – im Betrieb, in den Gewerkschaften, in der Gesellschaft. Dabei spielt die Arbeiterklasse die zentrale Rolle, mit den Gewerkschaften als ihrem Masseninstrument: Sie sind sowohl Träger von Alltagskämpfen als auch Ort der Herausbildung von Klassenbewusstsein.
Historischer Bezug
Die antimonopolistische Strategie hat eine lange Tradition in der DKP. Im Grunde reiht sie sich in die Debatte um Übergänge zum Sozialismus ein, wie sie bereits in den 1920er Jahren bei den Beratungen der Kommunistischen Internationale geführt wurde, und spielte seitdem immer wieder eine Rolle.
Ein wichtiges Beispiel für diese Debatte liefert Clara Zetkin auf dem IV. Kongress der Kommunistischen Internationale im Jahr 1922, als sie sich mit der „Neuen Ökonomischen Politik“ (NÖP) in Sowjetrussland auseinandersetzte. Damals befürchteten viele, dass die Zulassung kapitalistischer Elemente einen Rückfall oder gar einen Verrat an den Zielen des Sozialismus darstelle. Im Auftrag Lenins nahm Clara Zetkin dort eine Einschätzung der NÖP vor und stellte klar, dass die NÖP keine Abkehr vom kommunistischen Endziel ist, sondern eine unvermeidliche Politik der Übergangsperiode. Diese soll den Aufbau des Sozialismus unter den spezifischen historischen Bedingungen Russlands sichern und ist im Prozess der Übergänge allgemein zu berücksichtigen. Zudem betonte sie, dass es keine Einheitsformel gibt, sondern dass Übergangsstrategien an die konkreten ökonomischen und sozialen Bedingungen angepasst werden müssen. Dieses Beispiel zeigt: Übergänge sind keine abstrakten Kompromisse, sondern bewusste Strategien, die aus den konkreten Bedingungen heraus entwickelt werden müssen.

Genau in dieser Tradition steht die antimonopolistische Strategie, die in den 1970er Jahren von der DKP entwickelt wurde. Sie begreift die antimonopolistische Demokratie als historische Übergangsetappe in einem hochentwickelten imperialistischen Land mit dem Ziel, die Macht der Monopole zurückzudrängen, gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen und den Weg zum Sozialismus vorzubereiten. Diese Konzeption knüpfte an Lenins Lehre an, dass Reformen als „Stützpunkte” im Klassenkampf genutzt werden können, solange sie nicht als Ersatz für eine revolutionäre Umwälzung missverstanden werden.
Im Zentrum stand die Vorstellung, dass die Arbeiterklasse durch demokratische und antimonopolistische Reformen gesellschaftliche Machtpositionen erobern, ihre Verbündeten in anderen Schichten – etwa kleinere Selbstständige oder Intellektuelle – gewinnen und die Kräfteverhältnisse so verschieben kann, dass der Weg zum Sozialismus geöffnet wird.
Heutige Bedeutung
Die Notwendigkeit der antimonopolistischen Strategie ist heute noch offensichtlicher als zur Zeit ihrer Entstehung. Die Konzentration von Kapital ist weiter vorangeschritten. Internationale Konzerne verfügen heute über eine Machtfülle, die viele nationale Regierungen deutlich überragt. Sie diktieren Investitionsentscheidungen, beeinflussen die Gesetzgebung und bestimmen die Entwicklung von Arbeitsmärkten und ganzen Regionen.
Hinzu kommt der Zusammenhang von Konkurrenz und Kooperation im Imperialismus. Solange die Spielregeln des Freihandels – ob über den IWF oder die WTO – den westlichen Monopolen Vorteile verschaffen, wird die „Globalisierung“ als Ideal hochgehalten. Doch sobald „der Westen“ im Konkurrenzkampf ins Hintertreffen gerät, wie wir es aktuell gegenüber China sehen, tritt der bürgerliche Staat erneut in den Vordergrund: mit Zollpolitik, Sanktionen, geopolitischen Interventionen und militärischen Drohungen. Der Staat zeigt heute wieder ganz offen seine Funktion als Schutzmacht „seiner“ Monopole.
Die Folge sind imperialistische Konflikte, die immer deutlicher hervortreten: Zollstreitigkeiten, Handelskriege, Kriege um Ressourcen, Einflusssphären und Absatzmärkte. Globalisierung erweist sich nicht als harmonischer Prozess, sondern als Ausdruck der inneren Widersprüche des Imperialismus.
Für die Gewerkschaften ergibt sich daraus eine zentrale Aufgabe: Sie dürfen sich nicht auf die bloße Vertretung betrieblicher Interessen beschränken. Denn jeder Angriff auf Sozialleistungen, jede Umverteilung zugunsten der Rüstung, jeder Abbau demokratischer Rechte ist zugleich ein Angriff auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder. Gewerkschaften müssen diese Kämpfe gesellschaftspolitisch führen – gegen Krieg, gegen Hochrüstung, gegen Sozialabbau.
Für uns Kommunistinnen und Kommunisten in Betrieb und Gewerkschaft heißt das konkret: Wir müssen betriebliche Auseinandersetzungen erweitern und auf ihre gesamtgesellschaftliche Dimension zuspitzen, ohne uns dabei von den Kolleginnen und Kollegen zu isolieren. Wir müssen die Offensive der Gegenseite – Angriffe auf Arbeitszeit, Tarifrecht und Mitbestimmung – in ihren Zusammenhang stellen und politisch einordnen. Wir müssen kritisch mit der Haltung der DGB-Spitzen umgehen, die allzu oft einen Kurs der Anpassung an die Regierungspolitik verfolgen, also die Einbindung der Gewerkschaften in Standort- und Sicherheitspolitik akzeptieren. Und schließlich: Wir müssen in den Gewerkschaften die Debatte anstoßen, wie dieser Kurs verändert werden kann – hin zu einer kämpferischen, antimonopolistischen Politik, die die Interessen der Beschäftigten konsequent gegen die Macht der Monopole stellt.
Krisen- und Kriegsvorbereitungspolitik
Die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland ist von Stagnation, hohen Energiepreisen und einer schwächelnden Industrieproduktion geprägt. Wesentliche Faktoren dafür sind die Sanktionspolitik gegen Russland und die zunehmenden Handelskonflikte mit China. Die Sanktionen haben vor allem die Energieversorgung verteuert und die Inflation angeheizt. Das trifft die Werktätigen unmittelbar: höhere Heizkosten, steigende Lebensmittelpreise und eine sinkende Kaufkraft, trotz Tarifabschlüssen.
Gleichzeitig wird die deutsche Exportindustrie durch die weltweiten Zollkonflikte und protektionistischen Maßnahmen stark belastet. Besonders betroffen sind der Maschinenbau, die Chemie- und die Autoindustrie, die unter höheren Kosten und unsicherem Absatz leiden. Die Unternehmen reagieren darauf mit Produktionsverlagerungen, Kostensenkungsprogrammen und Arbeitsplatzabbau. Für die Beschäftigten bedeutet das wachsenden Druck auf Löhne, Arbeitszeiten und Mitbestimmungsrechte.
Aus der Perspektive von Gewerkschaftsaktiven sollte damit klar sein: Die Kosten dieser Politik werden auf die Arbeiterklasse abgewälzt. Während die Konzerne versuchen, ihre Profite durch Preiserhöhungen, Subventionen und Rationalisierung zu sichern, zahlen die Beschäftigten mit Reallohnverlusten, Arbeitsplatzunsicherheit und Sozialabbau. Hinzu kommt die politische Dimension: Unter dem Vorwand der „Standortsicherung“ werden Gewerkschaften aufgefordert, eine maßvolle Lohnpolitik zu betreiben und sich hinter den Kurs von Regierung und Kapital zu stellen – eine neue Form des „Burgfriedens“.
Politischer Kontext
Spätestens mit der Eskalation des Krieges in der Ukraine im Jahr 2022 wurde unter dem Stichwort „Zeitenwende” ein umfassender Kurswechsel vollzogen. Dieser Kurswechsel ist jedoch kein Bruch, sondern die Zuspitzung einer seit Jahren angelegten Entwicklung: Deutschland strebt danach, seine ökonomischen Interessen als imperialistische Führungsmacht in Europa auch militärisch abzusichern.
Die Bundesregierung verfolgt eine NATO-gebundene Hochrüstungs- und Kriegskurs-Strategie. Kern dieses Kurses sind milliardenschwere Sondertöpfe: Mit dem sogenannten Sondervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro wurde ein gigantisches Rüstungspaket beschlossen, das außerhalb des regulären Haushalts läuft. Hinzu kommt das Sondervermögen Infrastruktur, das offiziell für den Ausbau von Straßen, Schienen und Brücken gedacht ist, aber ganz klar auch die militärische Verlegbarkeit von Truppen und Material sicherstellen soll. Damit soll zivile Infrastruktur im Kern zur Kriegsinfrastruktur umgestaltet werden.
Besonders brisant ist, dass für diese Ausgaben die Schuldenbremse faktisch aufgehoben wird. Während also im sozialen Bereich, bei Schulen, Krankenhäusern, kommunalen Investitionen und Klimaschutzprogrammen weiter mit der Schuldenbremse argumentiert und gekürzt wird, gilt diese Bremse für die Hochrüstung nicht. Hier zeigt sich die Klassenlogik besonders deutlich: Für Panzer, Raketen und Militärforschung ist Geld im Überfluss da; für die Lebensinteressen der Arbeiterklasse wird hingegen jeder Euro dreimal umgedreht.
Wirtschaftspolitisch wird dieser Kurs als eine Art Rüstungskeynesianismus verkauft: Rüstungsausgaben sollen angeblich die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze sichern. Kurzfristig mag das wie ein Konjunkturprogramm wirken, langfristig aber bindet es gesellschaftliche Ressourcen unproduktiv, denn Panzer und Raketen schaffen keine Werte, sondern dienen der Zerstörung. Die Folgen für die Arbeiterklasse sind deutlich spürbar: Die Inflation wird durch Kriegspolitik, Sanktionen und Aufrüstung weiter angeheizt – vor allem bei Energie, Lebensmitteln und Wohnen. Selbst gute Tarifabschlüsse reichen nicht mehr aus, um Reallohnverluste auszugleichen. Gleichzeitig wächst der politische Druck auf die Gewerkschaften, sich bei Lohnforderungen „maßvoll“ zu verhalten – im Namen der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. So zahlen die Beschäftigten die Hochrüstung doppelt: durch steigende Preise und durch sinkende Lohnsteigerungen.
Deutlich wird dieser Regierungskurs im Operationsplan Deutschland (OPLAN DEU). Dieses „geheime Dokument“ (wörtliche Bezeichnung in der Broschüre der Bundeswehr) enthält ein Konzept der Bundeswehr und legt fest, wie Deutschland im Krisen- oder Kriegsfall funktionieren soll – nicht nur militärisch, sondern auch im Zusammenspiel mit Polizei, Verwaltungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Demnach soll Deutschland das logistische Rückgrat der NATO sein: Truppen, Waffen und Versorgungsgüter sollen durch unser Land verlegt werden; dafür werden Häfen, Bahnstrecken, Straßen und die Energieversorgung militärisch abgesichert. Damit wird zivile Infrastruktur systematisch in die militärische Logik einbezogen. Der OPLAN sieht auch eine enge zivil-militärische Zusammenarbeit vor, bei der Polizei, Rettungsdienste und Unternehmen in die Kriegslogik eingebunden werden. Wir haben es hier mit einer gesamtstaatlichen Kriegsvorbereitung zu tun.
Und hier stellt sich die Frage: Wie reagieren die Gewerkschaften darauf? Die ernüchternde Antwort lautet: In weiten Teilen gar nicht. Von den Spitzen der großen Gewerkschaften gibt es kaum kritische Stellungnahmen. Stattdessen finden wir in Teilen sogar eine Unterstützung. So hat die IG Metall gemeinsam mit der SPD und der Rüstungsindustrie ein Papier veröffentlicht, in dem eine „wehrtechnische Industriepolitik“ gefordert wird, angeblich um hochqualifizierte Arbeitsplätze zu sichern. Damit wird Rüstungspolitik nicht als Bedrohung für die Beschäftigten, sondern als Chance für den Standort und die Jobs gesehen – eine Sichtweise, die die tatsächlichen sozialen und ökonomischen Folgen völlig ausblendet.
Opposition
Doch es gibt auch Gegenstimmen. Bei Aktionen der IG Metall und ver.di in einigen Regionen haben Kolleginnen und Kollegen unter dem Motto „Waffen runter – Löhne rauf!“ deutlich gemacht, dass man Lohnkämpfe mit einer klaren Friedensposition verbinden kann. Diese Ansätze sind wichtig, weil sie die Zusammenhänge zwischen Sozialabbau, Rüstungsausgaben und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen aufzeigen.
Für uns bedeutet das: Wir müssen diese kritischen Strömungen innerhalb der Gewerkschaften stärken, den Zusammenhang von Kriegskurs und Sozialabbau thematisieren und die Debatte darüber führen, ob sich die Arbeiterbewegung wirklich hinter die Logik der Kriegsvorbereitung spannen lassen darf.
Hauptaufgabe
Krieg ist im Imperialismus kein Zufall, kein „Betriebsunfall“ der Politik. Er entspringt der Logik des Kapitalismus in seiner höchsten Phase. Lenin hat in seiner Schrift „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“ klar herausgearbeitet: Die Konkurrenz zwischen Monopolen und imperialistischen Staaten um Rohstoffe, Absatzmärkte und Einflussgebiete führt zwangsläufig zu Kriegen. Daraus folgt: Die Arbeiterklasse darf sich nicht hinter „nationale Interessen“ (nichts anderes ist die Standortpolitik) spannen lassen. Diese „nationalen Interessen“ sind in Wahrheit nichts anderes als die Interessen des Monopolkapitals – von Rheinmetall, BASF, Siemens oder der Deutschen Bank. Die Arbeiterklasse hat ein eigenes Interesse: Frieden, soziale Sicherheit, demokratische Rechte.
Eine entscheidende Aufgabe ist es daher, das Klassenbewusstsein zu schärfen und die Spaltungen zu überwinden, die im Zuge des Klassenkampfes erzeugt werden:
- Spaltung zwischen einheimischen und migrantischen Kolleginnen und Kollegen
- Spaltung zwischen Erwerbslosen und Beschäftigten
- Spaltung entlang von Branchen (zivile Produktion vs. Rüstungsproduktion).
Der entscheidende Punkt ist: Dieses Bewusstsein bildet sich nicht abstrakt, sondern in konkreten Kämpfen – Streiks, Tarifauseinandersetzungen, betrieblichen Auseinandersetzungen. Erst hier entsteht die Möglichkeit, die „großen politischen Fragen“ mit den alltäglichen Interessen zu verbinden.
Die entscheidende Frage lautet daher: Wie können Gewerkschaften – und insbesondere wir Kommunistinnen und Kommunisten in ihnen – der Einbindung der Arbeiterklasse in den Kriegskurs entgegenwirken?
Ein erster zentraler Punkt ist die Ablehnung der Standortlogik. Gewerkschaften dürfen nicht auf die „Arbeitsplatzkarte“ der Rüstungskonzerne hereinfallen. Rheinmetall und andere werben damit, sichere Jobs zu schaffen. Doch diese Jobs hängen an einer Spirale von Aufrüstung, Krieg und Zerstörung. Rüstungsaufträge sind kein Garant für Beschäftigung, sondern Teil der Militarisierung. Heute Panzer, morgen Stellenabbau, wenn die Aufträge ausbleiben.
Daraus folgt unmittelbar die Notwendigkeit des Kampfes für Konversion, für die Umstellung von Rüstungs- auf zivile Produktion: Statt Rüstungsproduktion braucht es soziale und ökologische Investitionen. Gewerkschaften müssen fordern, dass die Milliarden nicht in Leopard-Panzer, sondern in Schienenfahrzeuge, erneuerbare Energien, sozialen Wohnungsbau oder Medizintechnik fließen. Dass solche Konzepte möglich sind, zeigt die Geschichte: In den 1980er Jahren erarbeiteten IG-Metall-Betriebsräte bei Messerschmitt-Bölkow-Blohm konkrete Konversionspläne. Und auch heute gibt es wieder erste Diskussionen dazu, zum Beispiel auf der Friedenskonferenz in Salzgitter.
Ein dritter zentraler Baustein ist die internationale Solidarität statt Standortkonkurrenz. Die Kapitalseite versucht, deutsche Beschäftigte gegen polnische oder chinesische auszuspielen, nach dem Motto: „Wenn ihr nicht billiger produziert, gehen die Aufträge woanders hin.“ Dem müssen wir eine klassenbewusste Gewerkschaftspolitik entgegensetzen, die auf Kooperation über Grenzen hinweg baut. Beispiele gibt es: Hafenarbeiterstreiks in mehreren europäischen Ländern haben Waffenlieferungen blockiert. Und überhaupt ist eine enge Verbindung mit der Friedensbewegung notwendig – gegen NATO-Kriege, gegen Militarisierung.
Ganz entscheidend ist es außerdem, das Friedensthema in die Betriebe zu tragen. Konkrete Beispiele machen deutlich, dass das funktioniert: Münchner Tramfahrer haben sich geweigert, Bundeswehr-Werbung zu fahren. Hafenarbeiter in Italien haben Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien und Israel blockiert. In Deutschland gibt es Initiativen gegen Bundeswehr-Werbung in Schulen und Betrieben. Diese Erfahrungen zeigen: Frieden darf kein abstraktes Thema bleiben, sondern muss auch in den Betrieben verankert werden – durch Diskussionen im Betriebsrat, durch Resolutionen in Gewerkschaftsgremien oder durch Kampagnen gegen Rüstungsproduktion im eigenen Betrieb.
Ein weiterer unverzichtbarer Punkt ist es, Debatten in den Gewerkschaften selbst anzustoßen. Denn die aktuelle Haltung der DGB-Spitzen ist vielfach eine Unterordnung auf die Argumentation der Regierung: Zustimmung zu Aufrüstung, Schweigen zur NATO-Politik, Orientierung auf „Standortsicherung“. Dem müssen wir die entscheidenden Fragen entgegensetzen: Was heißt Sicherheit für die Beschäftigten wirklich? Welche Zukunft bietet ein „Standort Deutschland“, wenn er auf Militarisierung baut? Welche Alternativen hätten wir, wenn die Milliarden in Soziales und Ökologie flössen? Solche Debatten sind nicht nur theoretischer Natur, sondern sie sind notwendig, um Kolleginnen und Kollegen für eine antimonopolistische Perspektive zu gewinnen – und um zu verhindern, dass die Gewerkschaften in die Rolle von Standortverwaltern gedrängt werden.
Schließlich ist es wichtig, praktische Vernetzungen und Initiativen voranzutreiben. Plattformen wie die Streikkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind wertvolle Orte, um Arbeitskämpfe mit Friedensforderungen zu verbinden. Friedenskonferenzen dienen dem betriebsübergreifenden Austausch und sind daher ein geeignetes Instrument. Internationale Erfahrungen zeigen ebenfalls den Weg: In Großbritannien haben Rüstungsarbeiterinnen und -arbeiter selbst Konversionspläne entwickelt und in Griechenland haben Gewerkschaften aktiv gegen NATO-Stützpunkte protestiert.
All das zeigt: Eine konsequente, antimonopolistische Gewerkschaftspolitik muss den Kampf gegen Krieg und Militarisierung mitten in die Betriebe tragen – praktisch, internationalistisch und mit einer klaren Alternative.
Die Herauslösung der Gewerkschaften aus dem Kriegskurs gelingt nicht durch Appelle, sondern durch konkrete Praxis:
- im Betrieb (durch Kämpfe und Aufklärung)
- in den Gewerkschaften (durch Debatten, Beschlüsse, Initiativen)
- in der Gesellschaft (durch Bündnisse mit der Friedensbewegung und sozialen Bewegungen).
Das Ziel ist es, Gewerkschaften wieder zu Orten zu machen, an denen Klassenbewusstsein entsteht – nicht Standortnationalismus. Nur so können sie ihre Rolle als Hauptkraft der Arbeiterbewegung in einer antimonopolistischen Strategie erfüllen.
Hochrüstung und Sozialabbau
Dazu kommt, dass die Hochrüstung direkt auf die sozialen Errungenschaften durchschlägt. Die Milliarden müssen finanziert werden – und sie werden aus den Sozialhaushalten genommen. Das bedeutet ganz praktisch: weniger Geld für staatliche Investitionen, für Bildungseinrichtungen, für Krankenhäuser oder für Programme gegen Arbeitslosigkeit. Gerade dort, wo die Menschen dringend Unterstützung brauchen, wird gekürzt. Erst vor wenigen Wochen machte Bundeskanzler Merz deutlich: „Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar. Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen.“ Das ist eine klare Kampfansage. Und die SPD erklärt, dass sie zu „Reformen“ bereit sei. Auch der Arbeitsschutz soll aufgeweicht werden. Ruhezeiten sollen flexibilisiert und Überstunden ausgeweitet werden. In den Betrieben verschärft sich der Druck, länger und härter zu arbeiten, ohne dass die Rechte der Beschäftigten gewahrt bleiben.
Besonders spürbar wird die Hochrüstung im Alltag durch die Inflation: Kriegspolitik, Sanktionen und Aufrüstung treiben die Preise für Energie, Lebensmittel und Wohnen massiv in die Höhe. Selbst wenn Tarifabschlüsse auf den ersten Blick ordentlich aussehen, reichen sie oft nicht aus, um die Reallohnverluste auszugleichen. Die Arbeiterklasse verliert also Kaufkraft, während gleichzeitig der Druck steigt, bei Lohnforderungen „maßvoll“ zu bleiben – im Namen des „Standorts“. Das Resultat: Die Beschäftigten zahlen die Hochrüstung also gleich doppelt: einmal an der Supermarktkasse und mit der Energierechnung – und ein zweites Mal durch geringere Lohnerhöhungen.
Ideologische Folgen
Zu diesen materiellen Belastungen kommt eine ideologische Offensive: Es läuft eine ideologische Einstimmung auf den Krieg, die von Hetze und Hysterie zur Beeinflussung des Massenbewusstseins begleitet ist, um die Massen für die Ziele der besitzenden Klasse zu gewinnen. Die Mobilisierung gegen einen „äußeren Feind“ ist immer auch verbunden mit der Mobilisierung gegen den „inneren Feind“, also Kriegsgegner. Anfeindungen wie „Vaterlandsverräter“, „Fünfte Kolonne Moskaus“ oder „Putinversteher“ stehen in einer Linie. Dieser Zustand schwächt die gewerkschaftliche Kampffähigkeit, da er den Blick auf das Wesentliche versperrt.
Dazu gehört auch die Standortpolitik, mit der bewusst Spaltung betrieben wird. Gewerkschaften geraten unter Druck, die Ruhe an der „Heimatfront“ soll gesichert werden, anstatt Konflikte zuzuspitzen. Das zersetzt die Einheit der Arbeiterklasse, die durch nationale, betriebliche oder branchenbezogene Gegensätze auseinanderdividiert wird. Für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet das: weniger Zusammenhalt, mehr Konkurrenz – und eine Schwächung derjenigen Kraft, die als einzige in der Lage wäre, der Hochrüstung Widerstand entgegenzusetzen.
Um die gigantischen Rüstungsausgaben zu rechtfertigen und insbesondere deren Folgen für staatliche Sozialleistungen zu verharmlosen, wird auf die positiven Effekte von staatlichen Investitionen auf die Wirtschaftsleistung hingewiesen. Dieser Ansatz wird in der politischen Linken als „Rüstungskeynesianismus“ bezeichnet. Das bedeutet, dass der Staat seine Militärausgaben bewusst als Mittel der Wirtschaftspolitik einsetzt, um Nachfrage zu schaffen und die Konjunktur zu stützen. Anstatt zivile Investitionen zu fördern, fließen Milliarden in Panzer, Raketen und Militärforschung. Kurzfristig kann das wie ein Konjunkturprogramm wirken, aber langfristig bindet es gesellschaftliche Ressourcen unproduktiv – es entstehen keine Werte, sondern Mittel zur Zerstörung. Gewinner sind die Rüstungskonzerne, Verlierer die Arbeiterklasse.
Auch die ökonomische Forschung bestätigt das: Rüstungsausgaben haben im Vergleich zu zivilen Investitionen einen deutlich niedrigeren Fiskalmultiplikator. Das heißt: Ein Euro für Rüstung erzeugt weniger Wirtschaftsleistung als er kostet.
Wenn wir uns ansehen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den wirtschaftlichen Folgen von Rüstungsausgaben herausgefunden haben, dann ist das Ergebnis ziemlich eindeutig: Die von der Politik behaupteten positiven Effekte treten kaum oder gar nicht ein.
Erstens: Rüstung schafft kein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Im Gegenteil, viele Untersuchungen zeigen sogar schwache oder negative Effekte auf das Bruttoinlandsprodukt.
Zweitens: Rüstungsausgaben verdrängen zivile Investitionen. Jeder Euro, der für Panzer oder Raketen ausgegeben wird, fehlt für Schulen, Krankenhäuser, Infrastruktur oder erneuerbare Energien. Langfristig schwächt das die Produktivität der gesamten Wirtschaft.
Drittens: Die oft angeführten Beschäftigungseffekte sind stark übertrieben. Pro eingesetztem Euro entstehen in der Rüstungsindustrie deutlich weniger Arbeitsplätze als etwa im Bauwesen, in der Pflege oder im Bereich der erneuerbaren Energien. Mit demselben Geld könnten also in zivilen Bereichen viel mehr Menschen beschäftigt werden.
Die Politik behauptet oft, Rüstungsausgaben seien ein Mittel, um Beschäftigung zu sichern. Aber ökonomisch betrachtet ist das ziemlich schwach. Der entscheidende Maßstab ist hier der Fiskalmultiplikator, also die Frage: Wie viel zusätzliches Bruttoinlandsprodukt entsteht, wenn der Staat einen Euro ausgibt?
Bei zivilen Investitionen – etwa in Infrastruktur, Bildung, Gesundheit oder erneuerbare Energien – liegt dieser Multiplikator nach Studien oft zwischen 1,5 und 2,5. Das heißt: Ein Euro Staatsausgabe erzeugt im Schnitt bis zu 2,50 Euro zusätzliche Wirtschaftsleistung.
Bei Rüstungsausgaben sieht das völlig anders aus: Der Multiplikator liegt in den meisten Studien unter 1, teilweise sogar nur bei 0,6 oder 0,7. Das bedeutet: Ein Euro für Rüstung erzeugt weniger als einen Euro zusätzliche Wirtschaftsleistung – und ist damit im volkswirtschaftlichen Sinn unproduktiv.
Dazu kommt: In der Rüstungsindustrie entstehen weniger Arbeitsplätze pro investiertem Euro, weil es sich um einen sehr kapitalintensiven Bereich handelt. Wenn man das gleiche Geld beispielsweise in Pflege, Bildung oder erneuerbare Energien steckt, können zwei- bis dreimal so viele Jobs entstehen.
Viertens: Rüstungsausgaben können zwar kurzfristig die Nachfrage ankurbeln, ähnlich wie ein Konjunkturprogramm. Aber dieser Effekt ist nur oberflächlich und hält nicht lange an. Mittel- und langfristig führen sie zu einer wirtschaftlichen Belastung, weil die Investitionen unproduktiv sind – sie schaffen keine Werte, sondern dienen letztlich der Zerstörung.
Und fünftens: Die sogenannten Opportunitätskosten sind enorm. Das Geld, das in Rüstung fließt, könnte viel sinnvoller in zukunftsweisende Technologien und öffentliche Aufgaben gesteckt werden. Stattdessen blockiert die Hochrüstung den Fortschritt in jenen Bereichen, die wir gesellschaftlich dringend brauchen.
Rüstungsausgaben sind kein Motor für Wohlstand oder für Beschäftigung, sondern eine ökonomische Sackgasse. Gewinner sind die Konzerne – während Werktätige steigende Preise und Kürzungen im Sozialbereich tragen müssen. Ganze Gesellschaftsschichten werden ärmer.
Die Hochrüstung ist keine „äußere“ Frage, die nur das Militär oder die Außenpolitik betrifft. Sie greift direkt in den Alltag der Arbeiterklasse ein, und zwar durch Stellenabbau, Sozialabbau, verschärften Druck auf Löhne, Arbeitszeit und Rechte sowie Militarisierung und Spaltung.
Für die Gewerkschaftspolitik der DKP ergibt sich daraus:
- Kampf gegen Krieg und Hochrüstung ist Teil des Klassenkampfes, nicht „Nebenschauplatz“.
- Gesellschaftliche Gegenmacht aufbauen: Die Gewerkschaften müssen ihre Rolle als Klassenorganisation zurückgewinnen und sich der Vereinnahmung durch Standortlogik und NATO-Ideologie widersetzen.
- Alternativen aufzeigen: zivile Investitionen, soziale Sicherheit und demokratische Mitbestimmung.
Die aktuelle Politik von Hochrüstung, Standortlogik und Kriegsvorbereitung trifft die Arbeiterklasse direkt – materiell, politisch und ideologisch. Für uns Kommunistinnen und Kommunisten ist klar: Wir müssen in den Gewerkschaften dafür wirken, dass Kämpfe um Löhne, Arbeitszeit oder Arbeitsbedingungen mit dem Kampf gegen Krieg, Aufrüstung und Sozialabbau verbunden werden. Nur so können wir die Kräfteverhältnisse verschieben und eine antimonopolistische Alternative entwickeln. Unsere Verankerung in den Betrieben ist eine unabdingbare Voraussetzung für den Einfluss auf die Klasse. So stärken wir nicht nur den Widerstand gegen Krieg und Militarisierung, sondern auch die Perspektive einer grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung – hin zu einer solidarischen, sozialistischen Zukunft.