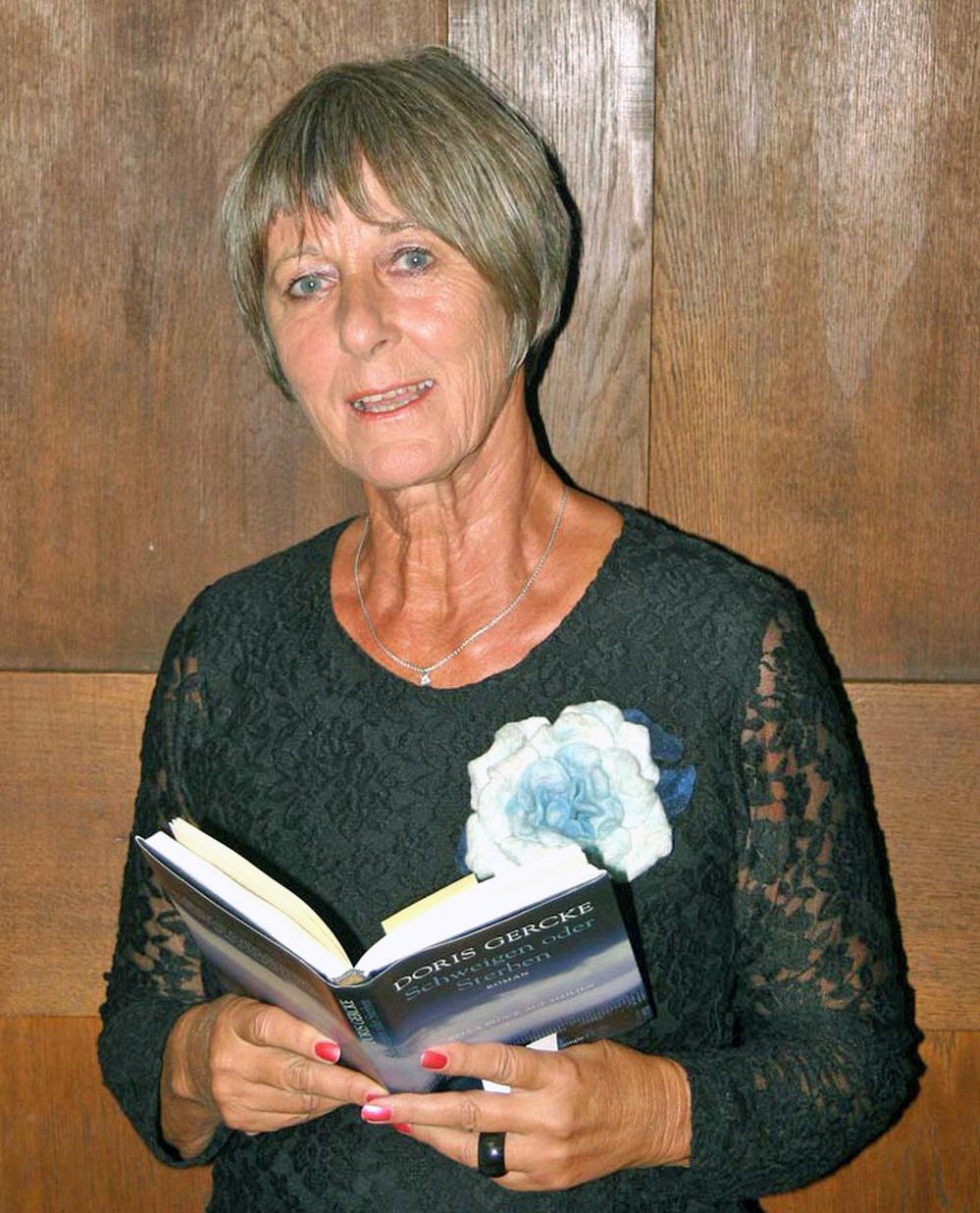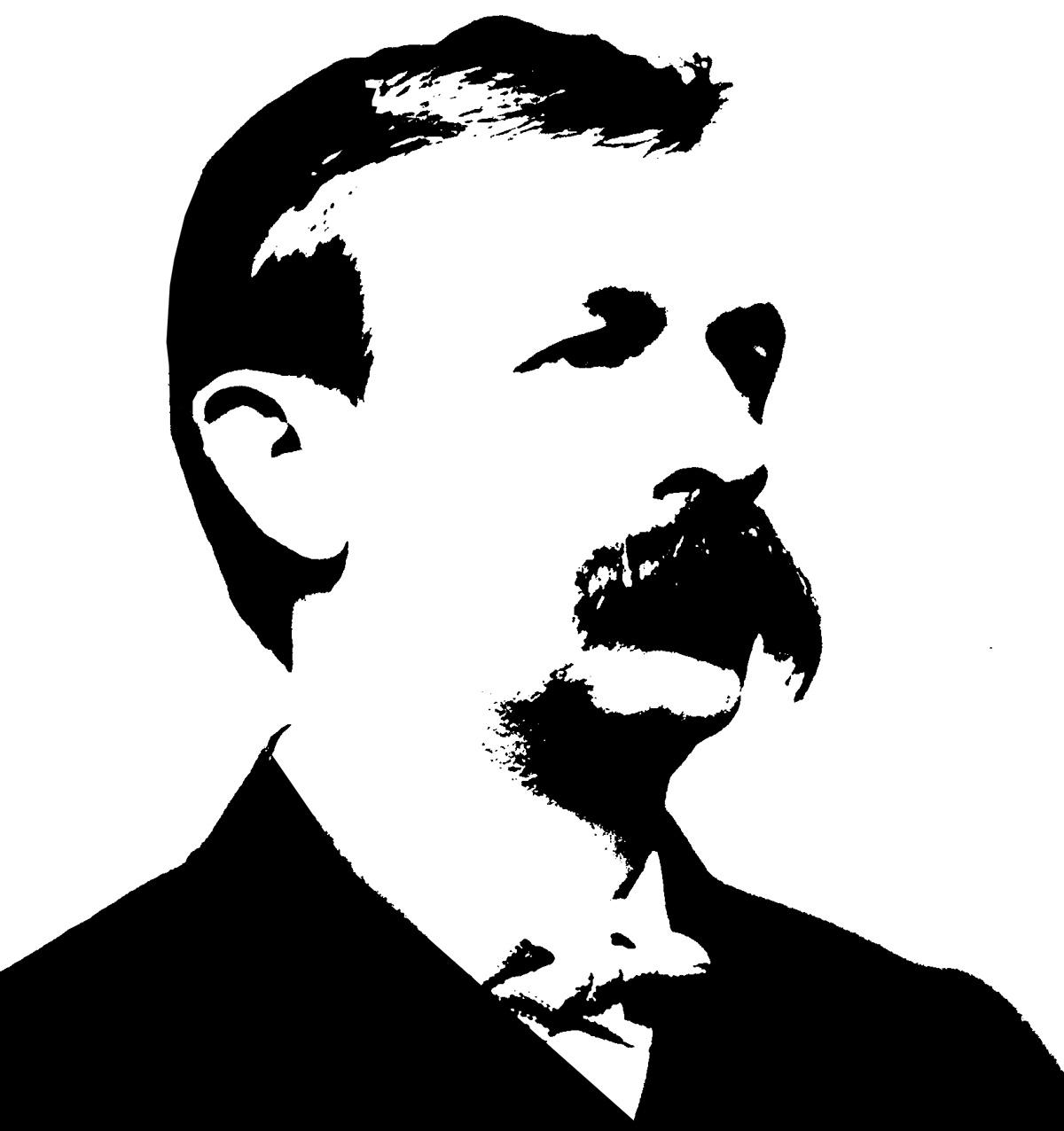Nach ersten Erhebungen im süddeutschen Raum weitete sich der Deutsche Bauernkrieg rasch aus und erreichte Thüringen, wo sich Frankenhausen im Frühjahr 1525 zum Zentrum des Aufstands entwickelte. Unter der Führung von Thomas Müntzer sammelten sich dort tausende Bauern und Handwerker. Trotz anfänglicher Erfolge wurden sie am 15. Mai 1525 in einer entscheidenden Schlacht vom fürstlichen Heer vernichtend geschlagen. Etwa 6.000 Aufständische gaben ihr Leben, viele weitere wurden hingerichtet oder grausam bestraft. Müntzer selbst wurde gefangen genommen, gefoltert und öffentlich enthauptet.
Diese Niederlage bedeutete das Ende des Bauernkriegs in Mitteldeutschland. Heute erinnert das Panorama Museum auf dem Schlachtberg in Bad Frankenhausen mit Werner Tübkes Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ an dieses heroische Kapitel der Geschichte. Das 13 Meter hohe Rundbild gilt als eines der bedeutendsten Werke moderner Monumentalkunst. Es vereint historische Ereignisse mit mythologischen und symbolischen Elementen zu einer vielschichtigen Komposition. Im Zentrum stehen der Bauernkrieg, der geistige Wandel der Renaissance und die Frage nach individueller Verantwortung in Zeiten des Umbruchs. Dieser Artikel folgt der Darstellung Karl Max Kobers (Werner Tübke. Monumentalbild Frankenhausen, VEB Verlag der Kunst Dresden 1989) und bietet eine Einführung in das außergewöhnliche Kunstwerk sowie eine begleitende Deutung zentraler Bildabschnitte.
Ein 360-Grad-Panorama ohne Anfang oder Ende zieht die Besucher in seinen Bann. Der erste Blick richtet sich nach vorn, wo eine Reise durch die Geschichte beginnen kann. Eine senkrechte Achse verläuft vom unsichtbaren Scheitel eines riesigen Regenbogens – ein Symbol der Bauern – bis zum Brunnen am unteren Rand. In der Mitte steht Thomas Müntzer, zentrale Figur des Bauernkriegs, in schwarzer Kleidung, mit gesenkter Fahne. Er erscheint als ruhige, nachdenkliche Figur, die den tragischen Ausgang des Kampfes ahnt. Zwei Banner rahmen diesen Abschnitt und führen weiter ins Geschehen. Darunter drängen turbulente Figurengruppen aus dem Bildraum und erzeugen dynamische Spannung. Im oberen Teil erscheint die Wagenburg der Bauern, umgeben vom Chaos des Gefechts. Ein leuchtender Farbkreis mit einer lichtblauen Figur symbolisiert den Absturz des Ikarus – und das Scheitern der Bauern.
Unterhalb des Kampfgeschehens versammeln sich Figuren um einen Brunnen mit roten Blüten. Der Granatapfel in der Mitte steht für Auferstehung und Erneuerung – ein ruhiger Kontrast zum turbulenten Geschehen. Der Künstler vereint hier bedeutende Persönlichkeiten des 16. Jahrhunderts: Hans Sachs, Albrecht Dürer, Martin Luther, Lucas Cranach, Tilman Riemenschneider, Jörg Ratgeb, Erasmus von Rotterdam, Ulrich von Hutten, Nikolaus Kopernikus, Paracelsus, Kolumbus, Johannes Gutenberg, Bartholomäus Welser und Jakob Fugger – sie verkörpern den geistigen und kulturellen Umbruch ihrer Zeit.
Ein düsteres Jüngstes Gericht erscheint als bedrohlicher Keil, der auf die Menschheit herabstößt. Justitia sitzt auf einer Weltkugel; ihre Waage neigt sich einem knienden Bauern zu – ein Verweis auf Gerechtigkeit und Verantwortung. Dem gegenüber stehen Szenen dörflichen Lebens – von Strafen bis zur Schafschur. Darüber segeln Schiffe mit geblähten Segeln und verweisen auf die Entdeckung Amerikas.
Das Panorama ist reich an symbolträchtigen Szenen: Pilatus wäscht sich die Hände in Unschuld, während der Narr den Betrachter direkt ansieht. Dämonen häuten einen Körper, ein Gehenkter wird umtanzt und Bauern entrichten Abgaben an feudale Herrscher. Eine Druckwerkstatt und ein Räderwerk stehen für den technischen Fortschritt der Zeit. Drei Zelte mit Tieren verweisen auf eine zeitgenössische Fabel, in der Tiere als Allegorien für Menschen Könige wählen und Kriege führen. Der Maler hat sich selbst im Bild dargestellt – neben seiner Frau auf einem Pferd. Ganz oben liegt ein Sterbender, dessen Seele von einem bösen Wesen geholt wird – ein weiteres Selbstbildnis des Künstlers.
Ein nächster Bildabschnitt reicht bis zur Burg am Horizont und blauen Wolke. Bodenflächen trennen die Szenen optisch, doch Tübkes Komposition verknüpft sie innerlich. Ein großes Schiff auf einer Wiese steht im Zentrum – Sinnbild für Ratlosigkeit und sozialen Abstieg. Die dicht gedrängten Insassen, Handwerker mit ihren Werkzeugen, warten auf die Abfahrt, ohne zu merken, dass sie „auf dem Trockenen“ sitzen. Vor dem Schiff liegen Schuhe als Zeichen der Bundschuh-Bewegung. Ein Narr spielt auf, Mönche beobachten das Geschehen. Darüber verspottet ein „Anti-Rom-Kalb“ den Papst, der als gekreuzigter böser Schächer von Teufeln gequält wird. Eine gefesselte Frau mit Kind verkörpert „Der Welt Lauf“. Oben zerren Bauern einen Adligen vom Pferd, um mit ihm auf Augenhöhe zu verhandeln. Daneben herrscht „Verkehrte Welt“: Hähne kämpfen im Turnier, Hühner und Gänse hängen einen Fuchs.
Die Szene der Schriftenverbrennung zeigt Martin Luther mit zwei Gesichtern – Symbol seiner Widersprüchlichkeit: revolutionär gegen den kirchlichen Feudalismus, später Gegner der Bauern. Darunter erscheint Thomas Müntzer als Münzpräger – Sinnbild seiner Rolle als Präger neuer Ideen–, flankiert von einem Ablasshändler. Ganz oben ringt der Heilige Antonius mit teuflischen Versuchungen; Luther wendet ihm eines seiner Gesichter zu – ein Verweis auf seine inneren Konflikte und die Angst vor dem aufbegehrenden Volk. Luthers Kampf mit dem Papst, einem Holzschnitt der Zeit nachempfunden, spielt sich hinter einer Bodenwelle ab – der Betrachter bleibt distanziert. Die Figuren tragen ihre Werkzeuge, Musikanten und ein Narr begleiten das Geschehen.
Vor einer bläulich schimmernden Kugel am Horizont stürzt ein aggressiver Engel auf einen zurückweichenden Bauern zu – nicht als Verkünder froher Botschaft, sondern bedrohlich. Der Bauer, mit grünem Heiligenschein, hat ein Schriftpult umgeworfen. Die transparente Kugel zeigt eine flache Erdscheibe – ein Verweis auf Kopernikus und den geistigen Umbruch der Renaissance. Rechts davon hält eine grotesk verkleidete Gruppe ein „Narrengericht“ ab – im Kontrast zu den Bauern, die einen Adligen umringen. Im Hintergrund zieht ein verarmter Handwerker mit monströsen Tieren an einer prächtigen Burg vorbei.
Eine große blaue Lichtwolke dominiert das Panorama. Umgeben von tanzenden Bauern und einem abgewandten Narren, verweist sie auf Jeremias’ Prophezeiung eines göttlichen Strafgerichts. In ihrem Zentrum erscheint ein schreiender Kopf, umgeben von Engeln, die den Zorn Gottes ausgießen. Links oben klagen neun Musen über den Verlust der Künste in „Teutschem Land“.
Ein scharfkantiger Fels durchzieht die Komposition, begleitet von einer spiralförmigen Feuerwolke und herabregnenden Steinen – Zeichen von Stillstand und Unheil. Adam und Eva sind im Moment des Sündenfalls gezeigt – teils lebendig, teils wie Statuen. Adam sät Knochen und Schädel, Eva folgt mit der Egge auf einem Pferd. Das entstehende Menschengeschlecht zeigt unterschiedliche Leidenschaften: Einige verlieren sich im Hintergrund, andere beklagen einen Ermordeten.
Bauern versammeln sich am Fels, um den Bundschuh-Schwur zu leisten. Flammen über ihren Köpfen symbolisieren Erleuchtung, während eine nackte Figur vergeblich versucht, einen Baumstumpf auszureißen – Sinnbild menschlicher Ohnmacht.
Unterhalb einer blauen Wolke sitzen zwei Männer an einem Tisch, ein Dritter hält ein Fähnchen mit der Aufschrift „Gen Narragonien“ – ein imaginäres Zufluchtsland nach gescheiterten Hoffnungen. Ein Narr kriecht am Boden, um eine gefallene Karte zu greifen.
Am unteren Bildrand zeigt der Künstler unterwürfiges Verhalten (damals „Fuchsschwanzstreifen“): Eine Figur verbeugt sich mit einem Fuchsschwanz in der Hand, ein älterer Mann putzt einem Herrn den Schuh, drei andere verneigen sich vor einem Reiter. Graue, klagende Gestalten verkörpern die „Dunkelmänner“, die den sittlichen Verfall der Kirche verspotten.
Ein schwebender, blauer Teufel mit Blasebalg leitet zur nächsten Szene, in der Musikanten, Tänzer und Betrunkene zu sehen sind. Der Tod als Richter bricht den Stab, während ein Dieb einen Gehenkten bestiehlt. Ausgelassenheit und Freude sind eng mit Frevel und Tod verbunden.
Am unteren Rand steht ein großer Narr, der mit mehrdeutiger Geste auf das Geschehen weist. Er verkörpert „Herrn Niemand“ und „Herrn Jedermann“ und fungiert als Kommentator des Weltgetriebes. Als Schlüsselfigur fordert er den Betrachter auf, den Blick zu weiten und den großen Rhythmus des Bildes zu erfassen. Zwei aufragende Felsen bilden den inneren Abschluss dieses Bildteils. Jenseits breitet sich das bunte Geschehen aus, während ein Turm dem Blick Halt gibt. Der Wechsel von „Herbst“ zu „Winter“ deutet auf einen chronologischen Ablauf hin.
Hinter einem Felskegel drängt eine Gruppe Pestkranker auf einem Karren hervor. Ein Ablasshändler als Narr zieht mit seinen Briefen durchs Land, während eine Hinrichtung mit Schwert und ein aufs Rad geflochtener Verurteilter zu sehen sind. Am schwarzen Himmel erscheint der Papst mit Eselsohren, umgeben von Teufeln und Dämonen. Auf einem Schneefeld herrscht emsiges Treiben: In einem Haus sitzt ein friedliches Ehepaar, während draußen Landsknechte das Dorf plündern. Links attackieren Frauen Ablasshändler mit Peitschen und Kübeln, während ein Narr die Hände faltet. Die Eitelkeit reitet mit Spiegel in der Hand vorbei, während zwei Frauen auf einem beladenen Karren zur Abfahrt bereitstehen. Doch das Zugtier fehlt – ein Gleichnis für närrisches Verhalten.
Bauern stellen brennende Kerzen in den Schnee. Eine Rückenfigur mit dem Bundschuh-Zeichen ragt hervor, gefolgt von merkwürdigen Gestalten: ein Einbeiniger mit Krücken, ein Kriechender unter einer Bibel und ein Kauernder mit Doppelkreuz im Rücken. Ein lorbeerbekränzter Dichter mit Narrenkolben erinnert an Ulrich von Hutten. Eine Frau trägt ein Kind in der Wiege und führt ein zweites Kind an der Hand. Daneben streut die Frühlingsgöttin Flora Blumen auf zwei Raufbolde, die sich zu ihren Füßen bekämpfen. Ein vergitterter Kasten mit liegenden Gestalten stellt eine Menschenfalle dar, bedient vom Teufel. Der Turm von Babel symbolisiert menschliche Überheblichkeit. Eine gelbgekleidete Frau mit mehreren Gesichtern hält ein Spruchband mit der Inschrift „Babel“, während das „Siebenlasterweib“ mit Schmetterlingsflügeln erscheint. Ein großer, transparenter Fisch schwebt über einem Schneefeld mit einer liegenden Figur und Landkartenteilen im Inneren. Ein Wasserstrahl stürzt zerstörerisch auf die Erde, daneben steht ein großes Ei, das sowohl Hoffnung als auch – in der Kälte –Erstarren symbolisiert.
Vor dem Turm predigt Thomas Müntzer zu einer Gruppe von Menschen. Ein gelbgekleideter Bauer richtet sich auf, während ein Wanderer mit Stock – Symbol des „Bundschuhs“ (auch Stäbler genannt) – am unteren Bildrand ausschreitet. Landsknechte ziehen geordnet in den Kampf, während Geschütze in Stellung gebracht werden. Der Regenbogen über dem Zentrum lenkt den Blick zum anderen Teil der Kampfszene, wo die Bauern unter dem Banner der Freiheit ihre Gegner besiegen. Ein Narr schläft am unteren Rand, während ein anderer mit einer Windmühle in der Hand vorwärtsstürzt.
Der Maler gestaltet das Chaos mit präziser Ordnung. Weiße Spitzlichter, dunkle Stellen und schwingende Formen erzeugen Lebendigkeit. Der ruhige Himmel und die Kyffhäuserlandschaft steigern die Dramatik. Ein Vogel flattert vor der Fahne der fürstlichen Söldner. Vögel erscheinen auch an anderen Stellen – Natur neben Narren, Engeln, Dämonen – und erfassen die reiche Weltvorstellung der Menschen vor rund 500 Jahren.
Werner Tübkes Panorama ist ein Meisterwerk der modernen Kunst, das historische, mythologische und symbolische Ebenen vereint. Es thematisiert den Bauernkrieg, den geistigen Wandel der Renaissance und die existenzielle Suche des Menschen nach Orientierung, Gerechtigkeit und Freiheit. Die Komposition nutzt diagonale, kreisförmige und spiralförmige Strukturen, um den Blick zu führen und die Dramatik zu verstärken. Narrenfiguren, symbolträchtige Szenerien und illusionistische Elemente verstärken die Ambivalenz menschlichen Handelns und die Tragik historischen Scheiterns. Tübkes Panorama lädt die Betrachter ein, sich auf die Komplexität der Geschichte und die Tiefen der Bildsprache einzulassen. Es ist nicht nur ein außergewöhnliches Kunstwerk, sondern auch ein Denkmal für die Suche nach einer besseren Welt, für Opferbereitschaft im Ringen darum und für die Kraft künstlerischer Erinnerung.
Panorama Museum
Am Schlachtberg 9, Bad Frankenhausen
Dienstag bis Sonntag 10 Uhr bis 17 Uhr
9,50 Euro / ermäßigt 8,50 Euro, Audioguide inklusive