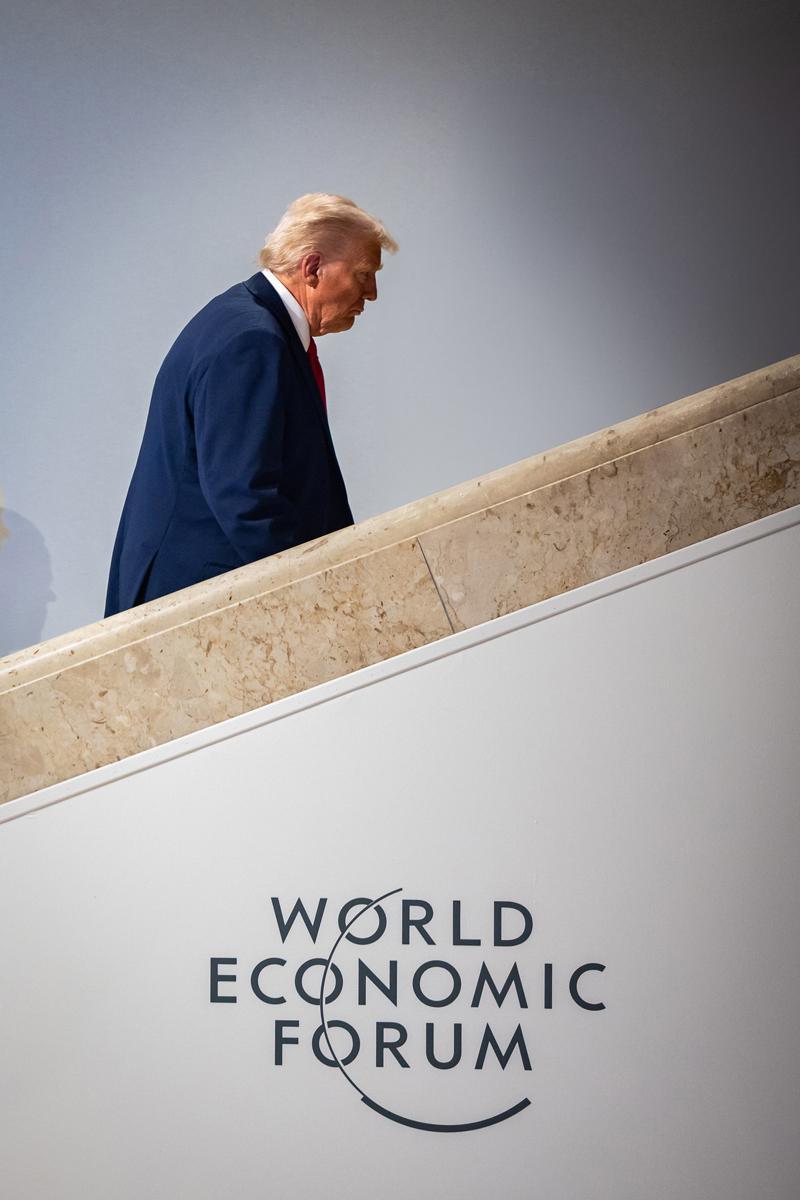Am Rande des Gipfeltreffens in Alaska traf Russlands Präsident Wladimir Putin den Erzbischof der Orthodoxen Kirche Alaskas. Im Anschluss erhob sich ein kleiner Sturm im Wasserglas der orthodoxen Gemeinde der USA. Erzbischof Alexei sah sich zu einer Entschuldigung gezwungen, da er von Putin nicht verlangt hatte, Frieden zu schließen.
„Noch immer höre ich von vielen, dass dieser Moment (des Treffens mit Putin) eine vertane Möglichkeit für Tadel und die Forderung nach Frieden vor dem Hintergrund des Verlaufs des Konflikts und des erzeugten Leidens ist“, schreibt Alexei auf der Website der Orthodoxen Kirche in Amerika. Zudem entschuldigt er sich dafür, keine Erlaubnis für das Treffen beim Bischof der Orthodoxen Kirche in Amerika, Metropolit Tichon, eingeholt zu haben. Alexei hat eigenmächtig gehandelt.
Metropolit Tichon schreibt in diesem Zusammenhang, dass die Orthodoxe Kirche in Amerika unter den ersten orthodoxen Kirchen war, die die russische Aggression gegenüber der Ukraine verurteilt haben. Bei seinem Besuch in der Ukraine im letzten Jahr habe er Metropolit Onuftri und der Ukrainischen Orthodoxen Kirche seiner Solidarität versichert.
Die Ukrainische Orthodoxe Kirche ist seit 2024 in der Ukraine verboten, obwohl sie sich 2022 vom Moskauer Patriarchat lossagte und den Krieg als „russischen Angriffskrieg“ verurteilt.
Der ganze Vorgang wirft ein Schlaglicht auf ein, nennen wir es „Chaos“, bezüglich der orthodoxen Kirchen in der Ukraine. Es gibt davon drei. Zwei davon schlossen sich 2018 zur Orthodoxen Nationalkirche der Ukraine zusammen. Die beiden Kirchen repräsentieren jedoch auch zusammen nur eine Minderheit der orthodoxen Gläubigen. Sie finden sich vor allem in der Westukraine. Der damalige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, unterstützte den Schritt, obwohl klar war, dass dadurch der ethnische Konflikt in der Ukraine angeheizt wurde.
Der Krieg in der Ukraine hat seine Ursache zwar einerseits in der Absicht, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Russland sieht dadurch seine Sicherheit bedroht. Andererseits liegen dem Konflikt auch ethnische Spannungen zugrunde, die vom Westen befeuert werden. Trotz des Verbots der orthodoxen Kirche sieht die EU das Grundrecht auf Religionsfreiheit in der Ukraine gewährleistet. Auch am Verbot der russischen Sprache stören sich die westlichen Förderer Kiews nicht. Klar ist jedoch, dass es Frieden nur dann geben kann, wenn nicht nur das Problem der NATO-Mitgliedschaft ausgeräumt ist, sondern auch die ethnischen Konflikte befriedet sind.
Der Versuch, Religionsfreiheit und das Recht auf die Verwendung der russischen Sprache bei Erhalt der territorialen Integrität der Ukraine durch Minsk 2 sicherzustellen, wurde von Deutschland, Frankreich, der EU und Kiew sabotiert. Die orthodoxen Kirchen können aufgrund ihrer Organisationsform keinen Beitrag zur Schlichtung leisten. Sie verfügen über keine Resilienz gegenüber politischer Instrumentalisierung, das zeigt auch dieser Vorgang. Was bleibt, ist die Aufspaltung der Ukraine entlang der ethnischen Konfliktlinien.