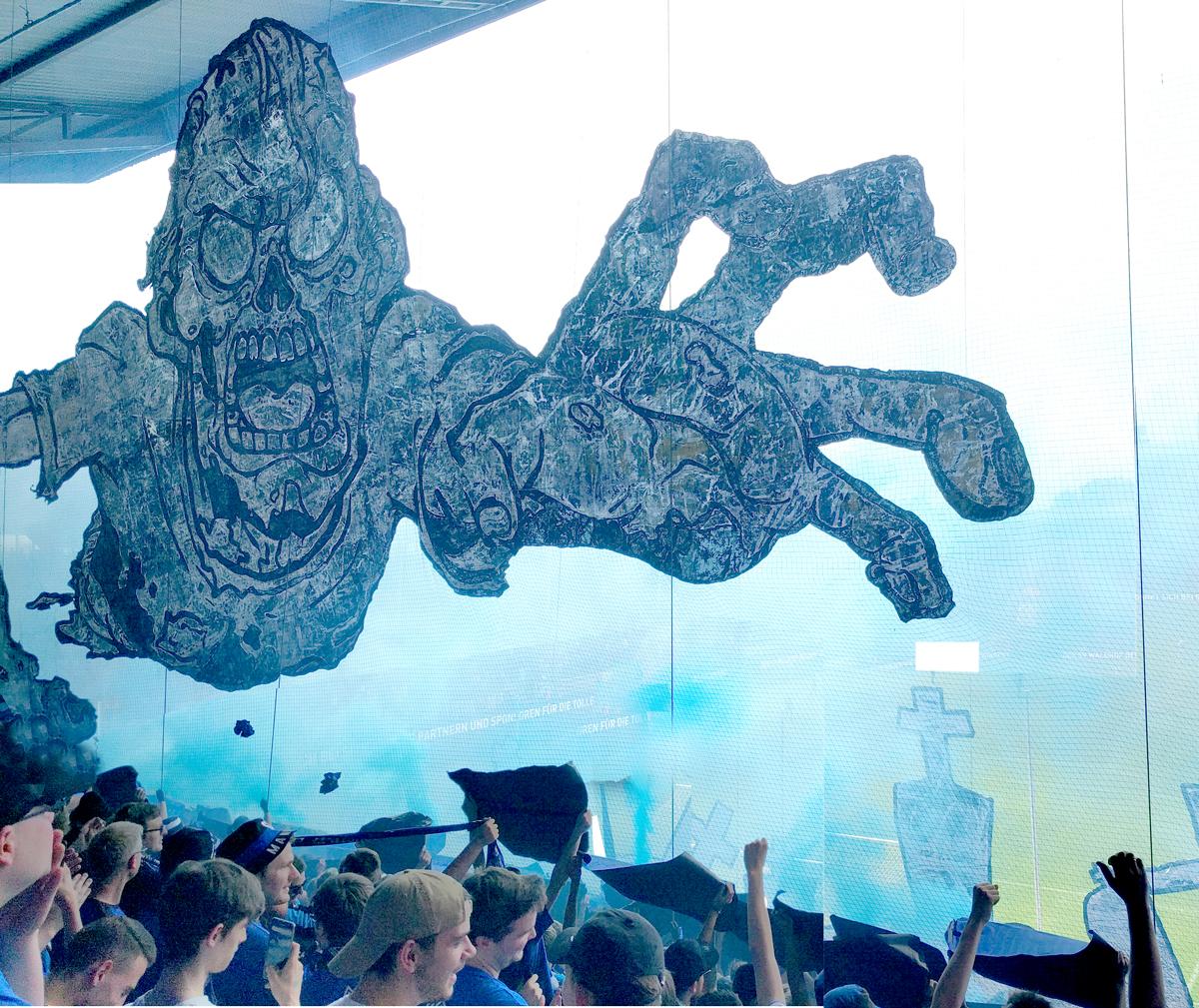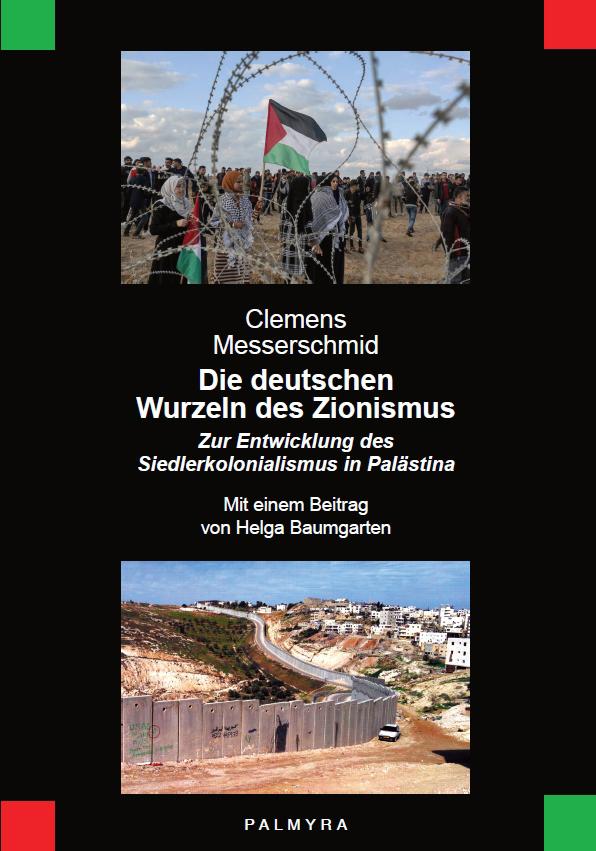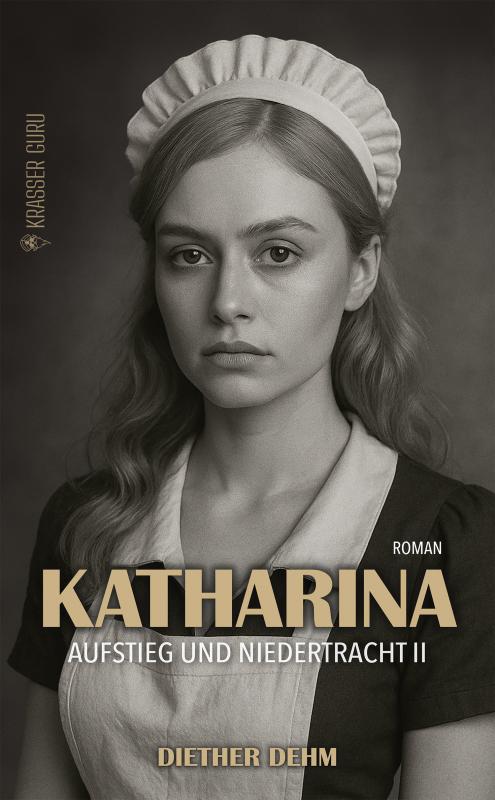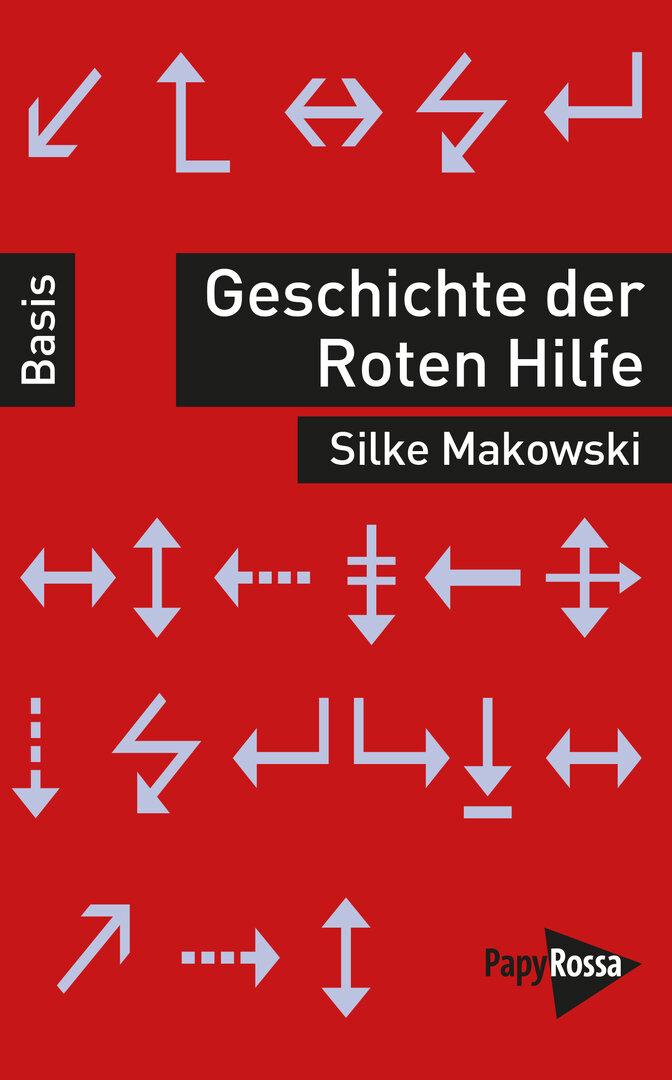Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit Fragen der Gesundheit umgeht, gibt einen Eindruck von ihrem allgemeinen Charakter. Im Kapitalismus muss sich der Gesundheitsschutz im ständigen Kampf gegenüber wirtschaftlichen Interessen behaupten. Maßnahmen und Einrichtungen der öffentlichen Gesundheitsversorgung werden wesentlich von den Interessen der Privatwirtschaft bestimmt oder müssen gegen sie verteidigt werden. Die DDR vermochte in den 40 Jahren ihres Bestehens ein grundsätzlich anderes Gesundheitswesen aufzubauen. Am Ende ihres Bestehens wies sie bei wichtigen internationalen Vergleichsziffern gute, bei einzelnen Parametern sogar Spitzenwerte auf. Zu nennen sind beispielsweise die Ärztedichte sowie Erfolge bei der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit und der Tuberkulose. Die Internationale Forschungsstelle DDR (IFDDR) hat im Jahr 2022 eine Broschüre „Sozialismus ist die beste Prophylaxe“ herausgegeben. Der folgende Text fasst die Grundaussagen der Broschüre zusammen. Er wird um einen redaktionell leicht bearbeiteten Auszug ergänzt. Die Broschüre gibt es hier.
Die Schaffung sozialistischer Eigentumsverhältnisse in der DDR brachte wesentliche Grundvoraussetzungen für die Gesundheitspolitik mit sich. Fragen der Gesundheit waren damit einheitlich dem Staat und seinen Entscheidungsstrukturen unterworfen. Eine prophylaktische, das heißt krankheitsvorbeugende Perspektive wurde zu einem leitenden Anspruch. Gesundheitsschädliche Bedingungen in den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der Menschen sollten erkannt und nach Möglichkeit bekämpft werden. Damit knüpfte die DDR an die Traditionen der Sozialmedizin an, die die Wechselwirkung zwischen gesundheitlicher Lage und sozialen Verhältnissen untersucht. Insbesondere die Ausrichtung auf den Gesundheitsschutz in den Betrieben und für Kinder und Jugendliche sowie auf ein modernes Konzept der ambulanten Versorgung – das poliklinische Prinzip – bringen diesen einheitlichen und gesamtgesellschaftlichen Charakter des Gesundheitswesens gut zum Ausdruck.
Die heute in kapitalistischen Ländern bestehende strukturelle Trennung zwischen dem sogenannten öffentlichen Gesundheitsdienst als staatlich finanziertem und in der Tendenz schwachem Bereich und dem privat organisierten großen Bereich der ambulanten und Krankenhausbetreuung war in der DDR überwunden. Die Beseitigung der unterschiedlichen Eigentumsformen machte die fachliche und organisatorische Umsetzung der angestrebten Einheit von vorbeugenden, therapeutischen und nachsorgenden Maßnahmen erst möglich. Es bestand eine enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Ein- und Fachrichtungen des Gesundheitswesens – von der lokalen, ambulanten und allgemeinmedizinischen Betreuung bis zur spezialisierten stationären Behandlung. So entstand ein umfassendes Netz von ineinandergreifenden Institutionen, dessen Arbeit das Ministerium für Gesundheit maßgeblich koordinierte.
Die poliklinische Idee
In einem modernen und demokratisch organisierten Gesundheitswesen spielt die ambulante medizinische Betreuung eine entscheidende Rolle. „Ambulant“ bedeutet, dass die Betreuung in der Regel außerhalb von Krankenhäusern, in der eigenen Wohnumgebung, aber auch allgemein im sozialen Lebensumfeld stattfindet. Sie sorgt dafür, dass die Menschen an ihren Wohn- und Lebensorten unmittelbar notwendige medizinische Hilfe erhalten, von vorbeugenden Maßnahmen über die Therapie bis hin zur Nachsorge und rehabilitativen Maßnahmen.
Mit dem Ausbau von Polikliniken, staatlichen Arztpraxen und weiteren Strukturelementen sollten die Einschränkungen, denen privat niedergelassene Ärzte in ihrer Einzelpraxis unterliegen, überwunden werden. Die Poliklinik war eine staatliche ambulante medizinische Einrichtung mit mehreren Fachabteilungen und medizinischer Ausrüstung unter einem Dach. Dort sollten Ärzte als Angestellte mit einem angemessenen Einkommen ihre medizinischen Entscheidungen unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen treffen können. Ihnen sollten Labore und medizinische Technik unmittelbar zur Verfügung stehen. Die fachliche Zusammenarbeit mit anderen Kollegen in der Ambulanz und in den Krankenhäusern sollte ohne bürokratische Hürden möglich sein. Die poliklinische Idee bezeichnet also eine Art und Weise der ambulanten medizinischen Betreuung, bei der Ärzte und andere Mitarbeiter unabhängig von wirtschaftlichen Erwägungen unkompliziert zwischen den einzelnen Fachgebieten sowie mit den Krankenhäusern zusammenarbeiten und die Einheit von vorbeugenden, therapeutischen und nachsorgenden Maßnahmen gestalten können.
Die arbeitsrechtliche Gleichstellung als Angestellte und die Mitgliedschaft von Ärzten, Schwestern und Pflegern in der gleichen Gewerkschaft förderten eine kollegiale Zusammenarbeit. Die Besetzung einer Poliklinik mit mehreren Ärzten und Mitarbeitern ermöglichte zudem deutlich längere Öffnungszeiten und unkomplizierte Vertretungsregelungen bei Urlaub oder Krankheit.
Widersprüche und Probleme
Der Aufbau und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens in der DDR entwickelten sich nicht konfliktlos. Es kam zu Widersprüchen zwischen gesundheitlichen Zielen und ökonomischen Möglichkeiten. So führte beispielsweise das Programm der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“ ab 1971 einerseits zu großzügigen Zuwendungen an das Gesundheitswesen, andererseits machten sich auch dort zunehmende wirtschaftliche Probleme aufgrund eines allgemeinen Investitionsrückstandes bemerkbar. Das betrifft zum Beispiel den baulichen Verschleiß von Krankenhäusern und die Knappheit bestimmter Verbrauchsmaterialien, was die tägliche Arbeit erschwerte. In den letzten Jahren konnte die DDR moderne Medizintechnik, die in westlichen Industrieländern entwickelt wurde, nicht mehr im notwendigen Umfang importieren. Ein Teil davon unterlag dem Embargo des Westens gegen die sozialistischen Länder.
Während der gesamten Zeit der DDR wirkte die Systemkonfrontation mit dem Westen in vielfältiger Weise auf die Entwicklungen im Gesundheitswesen. Im besonderen Maße betraf das den eingeschränkten Zugang zu medizinischem und technischem Material sowie den Zugang zu internationaler Forschung und die Abwerbung von Arbeitskräften durch die Bundesrepublik. Obwohl bis zum Bau der Mauer 1961 einige Tausend Ärzte die DDR verließen, nahm ihre Zahl mit etwa 41.000 im Jahr 1988 im europäischen Vergleich einen vorderen Platz ein und hatte sich seit 1949 mehr als verdreifacht.
Das Erbe für heute
Der Arzt und Gesundheitspolitiker Maxim Zetkin (1883 – 1965) beschrieb den Sozialismus nicht ohne Grund als „radikalste und umfassendste Prophylaxe“, denn er isolierte und eliminierte das Marktinteresse und ermöglichte durch eine zentrale staatliche Organisierung der Wirtschafts- und Sozialpolitik die umfassende Verbindung der Gesundheitspolitik mit allen Bereichen der Gesellschaft. Dadurch, dass alle Fragen der gesellschaftlichen Aufgaben in den demokratischen Strukturen des Staates zusammenliefen, wurde es möglich, gesundheitspolitische Zielstellungen beispielsweise im Verhältnis zu wirtschaftlichen Zielen zu diskutieren und vor allem verbindlich zu entscheiden. Daraus ergaben sich durchaus handfeste Konflikte und komplizierte Entscheidungsaufgaben, aber die Möglichkeit zur Abwägung und Diskussion war erstmals gegeben.
Der Sozialismus hat bewiesen, dass selbst unter den Bedingungen schwerwiegender wirtschaftlicher Zwänge eine präventive Versorgung, eine wirksame Behandlung und eine menschenwürdige Beschäftigung für alle gewährleistet werden können. Das mit einem Embargo belegte Kuba beweist dies noch heute, indem es nicht nur eine vorbildliche Gesundheitsversorgung für seine Bevölkerung bietet, sondern auch Notleidenden in aller Welt mit Ärztebrigaden hilft.
Das Eingrenzen von Arbeitsbelastungen als vorrangige Aufgabe
„Sozialismus ist die beste Prophylaxe“ – Auszug aus dem Kapitel „Gesundheitsschutz in den Betrieben“
Die Frage, wie aus medizinischer Sicht der Schutz der Beschäftigten in den Betrieben organisiert werden kann, hatte in der DDR großes Gewicht. Der entscheidende Unterschied zur Praxis in kapitalistischen Ländern ist, dass dort mit der betriebsärztlichen Arbeit die Interessen der Unternehmen und nicht die der Beschäftigten durchgesetzt werden.
Die Betriebspolikliniken, -ambulatorien und Betriebssanitätsstellen mit insgesamt 19.000 Beschäftigten waren 1989 für den medizinischen Arbeitsschutz von 7,5 Millionen Werktätigen in 21.550 Betrieben tätig. Das waren 87,4 Prozent aller Berufstätigen der DDR. Etwa jeder siebte ambulante Arzt arbeitete hier. Zudem waren in diesem Bereich etwa 1.000 Fachärzte und -ärztinnen für Arbeitshygiene/Arbeitsmedizin sowie 1.200 für den medizinischen Arbeitsschutz weitergebildete Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler und Ingenieure tätig. (…) Zum Vergleich: In der BRD gab es bei gut viermal höherer Ärztezahl nur 1.169 Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner.
Neben allgemeinen medizinischen Leistungen (…) erfolgte eine gezielte Dispensairebetreuung für die Beschäftigten an Arbeitsorten mit erhöhter Umweltbelastung. Das Zurückdrängen von Berufskrankheiten und damit auch von Invalidisierung war ein Schwerpunkt. Die Eingrenzung von Arbeitsbelastungen wurde vorrangige Aufgabe. Dem diente auch die seit 1981 verschärfte Berichterstattungspflicht der Betriebe über Stand und Reduzierung exponierter Arbeitsplätze. Die große Beschäftigtengruppe im Verkehrswesen von etwa 500.000 Menschen wurde vom Verkehrsmedizinischen Dienst als eigenständige staatliche Struktur betriebsärztlich betreut.
Ein dem Ministerium unterstelltes Zentralinstitut für Arbeitsmedizin mit einer Klinik und Poliklinik für Berufskrankheiten erforschte Fragen des medizinischen Arbeitsschutzes und fungierte als eine Leiteinrichtung. Nach 1990 wurde nur ein Bruchteil dieser Struktur bewahrt – trotz der Zusage des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Jahr 1990, dass das Institut „in einem geeinten Deutschland als leistungsfähige Einrichtung erhalten werden“ soll.
Parallel zum Zentralinstitut bestanden in den Bezirken und in den meisten Kreisen staatliche und fachärztlich geleitete Arbeitshygieneinspektionen, die die Betriebe in ihrem Verantwortungsbereich auf die Einhaltung der Normen und festgelegten Grenzwerte bei Schadstoffen oder anderen Belastungen zu kontrollieren hatten. Von den 7,5 Millionen betreuten Arbeitern und Angestellten befanden sich etwa 3,34 Millionen in arbeitsmedizinischer Dispensairebetreuung. Etwa ein Fünftel von ihnen arbeitete noch an Arbeitsplätzen, die durch Schadstoffe und Belastungen beeinträchtigt waren. Diese Faktoren reichten vom Lärm, schwerer körperlicher Arbeit, Vibrationen, chemischen Schadstoffen, Stäuben bis hin zu Hitzebelastung und wurden exakt fachlich aufgegliedert.
Gerade weil durch den technologischen Rückstand mancher Betriebe oder durch die Energieversorgung auf Braunkohlenbasis mit der entsprechenden Staubbelastung die Exposition in der DDR nicht den technisch erreichbaren Stand hatte, war das Vorgehen der arbeitshygienischen Überwachung sehr wichtig und auch konfliktreich. Es galt besonders, sogenannte Ausnahmegenehmigungen für Grenzwertüberschreitungen zu reduzieren.
Neben Untersuchungen zu den Auswirkungen körperlicher Arbeit auf die physische Gesundheit wurde dem Gebiet der Arbeitspsychologie besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bedeutende Ergebnisse lieferte hier der Arbeitspsychologe Winfried Hacker. Hauptgegenstand seiner Forschung war die psychische Regulation der Arbeitstätigkeit vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Produktivitätssteigerung zur besseren Bedürfnisbefriedigung im Sozialismus. Arbeit sollte nach ihm so gestaltet werden, dass die Gesundheit der Arbeitenden nicht nur erhalten bleibt, sondern eine Persönlichkeitsentwicklung im Sinne eigenständiger Handlungsregulation (Einfluss, Entscheidungen etc.) ermöglicht. Von Hacker und seinem Team wurden daher Verfahren entwickelt, um potenziell gesundheits- und entwicklungsfördernde objektive Tätigkeitsmerkmale herauszustellen und die subjektiv wahrgenommene Auswirkung zu messen. Wenngleich Hackers Vorschläge noch nicht in größerem Maße in der Praxis umgesetzt werden konnten, setzte seine Forschung Maßstäbe in der Arbeitspsychologie, die auch außerhalb der DDR rezipiert wurden und werden – wobei unter kapitalistischen Bedingungen die Steigerung der Effektivität der Arbeitsabläufe und nicht die Persönlichkeitsentwicklung der Beschäftigten entscheidendes Motiv ist.
In Anbetracht der heutigen unregulierten Verschärfungen von Arbeitsbedingungen hat eine umfassende arbeitshygienische Überwachung ebenso wie eine gezielte und fachlich unabhängige betriebsärztliche Versorgung – trotz vieler Fortschritte in den Produktionsprozessen selbst – ihre Bedeutung nicht verloren. Die Erfahrungen der DDR zeigen auf, dass ein völlig anderer Umgang mit dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz möglich ist.