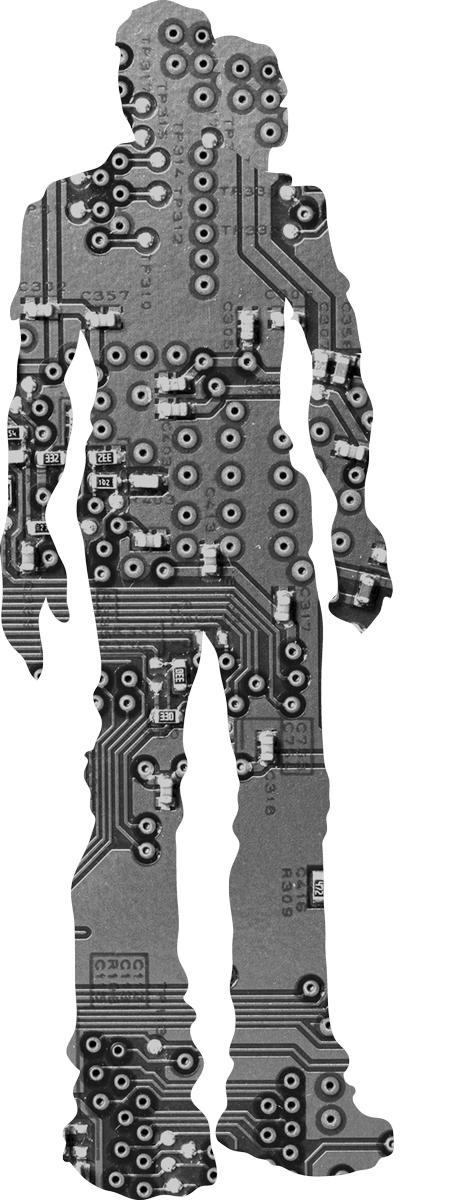Sicher ungewöhnlich, aber Theodor Plieviers Welt- und Antikriegsroman „Stalingrad“ handelt anfangs nicht nur im Krieg, sondern auch zur Weihnachtszeit. Aber nicht deshalb wurde er berühmt und seit fast 80 Jahren immer wieder aufgelegt, sondern wegen seiner Schilderung des unermesslichen Grauens in einer Schlacht, die 1942 bis 1943 stattfand und detailliert beschrieben wird. Anfangs verwendet der Autor noch den Begriff „Deutsche Weihnacht“ und nennt typisch weihnachtliche Requisiten wie „Glanz der Lichterbogen, Marzipan, Nüsse“ – Kurze Zeit später ist nur noch eine schwache Erinnerung daran vorhanden, ausgelöst durch „ein Hindenburglicht“ für jedes Erdloch, bei dem im Dunst, den es verbreitet, kein Mensch mehr zu unterscheiden ist.
Das wird zu einem literarischen Merkmal des Romans: Er arbeitet mit einprägsamen Bildern, die für größere Zusammenhänge stehen. So gibt es zwar Millionen von Betroffenen, aber nur sehr wenige typische Gestalten werden herausgehoben, ohne dass sie dadurch Hauptgestalten würden. Sie bekommen wenig individuelle Züge und sind Betroffene, fast blind; im „trüben Dunst“ des schwachen Hindenburglichts „war kein einzelnes Gesicht zu unterscheiden“, sondern nur „ein den Boden bedeckender trüber Brei“ zu erkennen. Zum Hauptmerkmal des Dunstes wird „das Rasseln aus verschleimten Atemwegen und kranken Lungen“; ein den Tatsachenroman durchziehendes Motiv ist „der mit Lumpen bewickelte Fuß“. Individuelle Züge haben die Gestalten nicht, Namen tragen einige; auch sie werden nicht zu Hauptgestalten, sondern dienen zur Orientierung in dem räumlich wie personell umfangreichen Wirklichkeitsausschnitt. Namentlich Genannte stehen für Gruppen Betroffener. Einer ist der Unteroffizier August Gnotke: Die Eröffnung – sie wird vom Erzähler mit seinem Namen betitelt: „Und da war Gnotke“ – beschreibt die Gruppe der Menschen, für die er steht. An die Stelle der einzelnen Individuen – sie „unterschieden sich in nichts voneinander“, nicht einmal „Schulterklappen“ tragen sie als Feldstrafgefangene – tritt eine alles vernichtende, von Menschenmassen betriebene Kriegsmaschinerie, die von den Deutschen in Gang gesetzt wurde, ihnen aber bei Stalingrad entglitten ist.
Das wird mit einem einfachen Vorgang in der Eröffnung dem Leser beschrieben: Die Menschen um Gnotke graben mit einem Spaten eine „Grube“; die Assoziation „Grab“ stellt sich sofort ein; sie sind Leichenbestatter. Doch stellt sich für den belesenen Leser in dieser Passage eine weitreichende Beziehung ein, die den Abstand von hoffnungsvoller humanistischer Utopie zur realen, von den Deutschen ausgelösten verbrecherischen Gegenwart der Romanhandlung ausweist: Auch der alte und blinde Faust Goethes hört das Klirren von Spaten und meint, es würden Sümpfe trocken gelegt für eine friedliche Zukunft, doch ist auch dieses Graben ein Zeichen des Todes: Die Lemuren graben Fausts letzte Grube.
Die Beschäftigung mit der Eröffnung lässt deutlich werden, wie der Autor seinen Roman angelegt hat und verstanden wissen will. Nach Unterhaltung klingt das nicht, vielmehr ist Einsicht und Erkenntnis angesagt. Gnotke steht als Offizier Oberst Vilshofen, später General, gegenüber, der die Leiden der Soldaten miterlebt. Beide gehen am Ende gemeinsam in Gefangenschaft, nicht mehr als Soldat und General, sondern – so lautet der letzte Satz – „Es war die Fußspur von zwei nebeneinander schreitenden Männern“. Dieser Satz beschließt die Vision des Friedens, in der Plievier völlig anderes Wortmaterial verwendet. Bis dahin von Entsetzen und Schrecken geprägt, folgt die Sprache nun dem Motiv von „Schnee und Stille“, und es entsteht eine fast traumhafte Beschreibung eines beginnenden Friedens.
Die Menschen im Roman sind Deutsche, nur wenige der Verbündeten, zum Beispiel Rumänen, treten am Rande auf oder vom Gegner – den Russen – wird hin und wieder gesprochen oder ihre Rundfunksendungen, mit Hilfe deutscher Emigranten, werden erwähnt. Russische Frauen werden für die deutschen Soldaten Gebrauchsstücke.
Die Soldaten der 6. Armee unterliegen, werden vernichtet, verstört sind sie selbst dann, wenn sie am Leben bleiben. Sie sind Besiegte, beschrieben wird die deutsche Front beziehungsweise das, was einmal Front war, nun aber zum riesigen Kessel von Zerstörung und Tod geworden ist, nachdem die deutsche Wehrmacht Vernichtung ins Land getragen hat. Der russische Gegner bleibt die drohende und endlich siegende Macht, nachdem zu Weihnachten 1942 die deutsche „Stalingradarmee eingekesselt war“ und die Aufforderung zu einer auf vernünftigen Bedingungen gegründeten Kapitulation, die als Dokument eingefügt ist, ausgeschlagen hat.
Plieviers Roman nimmt unter der umfangreichen Literatur zum Zweiten Weltkrieg eine Spitzenstellung ein. Geschrieben wurde er auf der Grundlage von Dokumenten, die der Autor während seines Exils in der Sowjetunion einsehen konnte. Er hat gewagt, das im Grunde nicht Beschreibbare in einen Roman einzubringen, der vom Weihnachtsfrieden nichts mehr übriglässt, die Erinnerung daran verstärkt jedoch das Entsetzen über die Beschreibung von Tod, Vernichtung und Verzweiflung. Dazu hat er die traditionell erwarteten Strukturen eines Romans durch eine Flut von Mosaikteilen ersetzt, die immer zielloser und gefahrvoller wird – Personenkonstellationen, Konflikte, Beschreibungen – und verlässt sich ganz auf die erschreckende minutiöse Reihung von Tod und Zerstörung, wobei durch zahlreiche Ortsangaben betont wird, dass die Handlung im fremden Land geschieht. Was der Autor mit dem Werk zu erreichen gedachte, wird deutlich von ihm benannt: „Stalingrad musste kommen, nicht uns zum Triumph, uns zur Lehre.“ Ich wüsste viele bekannte heutige deutsche Politiker und Politikerinnen, die sich fortwährend zum Krieg, der Kriegsertüchtigung und Wehrpflicht äußern, und denen man den Roman dringend zu baldiger Lektüre empfehlen sollte, um sie von ihren Kriegsvorstellungen und ihrer Kriegstüchtigkeit – jedenfalls mit dem Mund – abzubringen. Dazu eignet sich das Buch sehr.
Der bekannte Germanist Carsten Ganzel hat das Buch im gleichen Verlag, in dem es zuerst 1945 erschienen ist, dem Aufbau-Verlag, 2025 neu herausgegeben. Er hat ihm eine fünfzig Seiten umfassende historische Einordnung mitgegeben, die Politiker mit großem Gewinn lesen sollten, ehe sie sich zu Themen äußern wie Krieg gegen Russland, Waffen für die Ukraine und die militärische Unterstützung für Kiews nationalistische Bandera-Heroisierung und korrupte Regierung.
Theodor Plievier
Stalingrad
Roman. Hrsg. und mit einem Nachwort von Carsten Ganzel
Aufbau-Verlag, 624 Seiten, 30 Euro