Vor 500 Jahren erhoben sich die Bauern in Deutschland. Aus diesem Anlass drucken wir in UZ Friedrich Engels’ Werk „Der deutsche Bauernkrieg“ in Auszügen ab. In den bisherigen Teilen ging es um die soziale Lage und die daraus entstehenden Klassenkämpfe zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Durch die Entwicklung der Produktivkräfte hatte sich das feudalistische System ökonomisch überlebt. Fürsten und katholische Kirche vermehrten ihren Reichtum zulasten der gesamten Gesellschaft, besonders der Bauern. Die Städte und die dortige Produktion gewannen immer mehr an Bedeutung. Dort bildete sich eine Oberschicht, die zunehmend Macht erlangte. Sie geriet vor allem mit der Kirchenhierarchie in Konflikt, deren Macht die aufstrebende Bourgeoisie einschränken wollte. Für die Bauern und die städtischen Unterschichten, die Plebejer, war durch den Übergang der politischen Macht von einer herrschenden Klasse an eine neue nichts zu gewinnen. Ideologisch konnten die gesellschaftlichen Widersprüche nicht anders als religiös verarbeitet werden: Die Bibel war die einzige zur Verfügung stehende weltanschauliche Grundlage. Die Klassenkämpfe erschienen als theologische Auseinandersetzungen zwischen Katholischer Kirche, dem Reformator Martin Luther und dem Revolutionär Thomas Müntzer. Luther stand für die Interessen der heranreifenden Bourgeoisie und stärkte vor allem die Macht der regionalen Fürsten. In Müntzers Wirken wuchs die frühbürgerliche Revolution über sich hinaus in eine soziale Revolution. Die Produktivkräfte waren allerdings noch nicht reif für die Gütergemeinschaft. Im vorigen Teil ging es um den Ausbruch und die Entwicklung der Kämpfe im Frühjahr 1525 in Schwaben und Franken.
Wir verließen den Truchsess bei Ulm, wohin er sich Ende März wandte, nachdem er bei Kirchheim unter Teck ein Beobachtungskorps unter Dietrich Spät zurückgelassen. Das Korps des Truchsess, nach Herbeiziehung der in Ulm konzentrierten bündischen Verstärkungen nicht ganz 10.000 Mann stark, wovon 7.200 Mann Infanterie, war das einzige zum Angriffskrieg gegen die Bauern disponible Heer. Die Verstärkungen kamen nur sehr langsam nach Ulm zusammen, teils wegen der Schwierigkeit der Werbung in insurgierten Ländern, teils wegen des Geldmangels der Regierungen, teils weil überall die wenigen Truppen zur Besatzung der Festungen und Schlösser mehr als unentbehrlich waren. Wie wenig Truppen die Fürsten und Städte disponibel hatten, die nicht zum Schwäbischen Bund gehörten, haben wir schon gesehen. Von den Erfolgen, die Georg Truchsess mit seiner Bundesarmee erfechten würde, hing also alles ab.
Fall der Leipheimer
Der Truchsess wandte sich zuerst gegen den Baltringer Haufen, der inzwischen begonnen hatte, Schlösser und Klöster in der Umgehung des Ried zu verwüsten. Die Bauern, beim Herannahen der Bundestruppen zurückgegangen, wurden aus den Sümpfen durch Umgehung vertrieben, gingen über die Donau und warfen sich in die Schluchten und Wälder der Schwäbischen Alb. Hier, wo ihnen die Reiterei und das Geschütz, die Hauptstärke der bündischen Armee, nichts anhaben konnten, verfolgte sie der Truchsess nicht weiter. Er zog gegen die Leipheimer, die mit 5.000 Mann bei Leipheim, mit 4.000 im Mindeltal und mit 6.000 bei Illertissen standen, die ganze Gegend insurgierten, Klöster und Schlösser zerstörten und sich vorbereiteten, mit allen drei Kolonnen gegen Ulm zu ziehen. Auch hier scheint bereits einige Demoralisation unter den Bauern eingerissen zu sein und die militärische Zuverlässigkeit des Haufens vernichtet zu haben, denn Jakob Wehe suchte von vornherein mit dem Truchsess zu unterhandeln. Dieser aber ließ sich jetzt, wo er eine hinreichende Truppenmacht hinter sich hatte, auf nichts ein, sondern griff am 4. April den Haupthaufen bei Leipheim an und zersprengte ihn vollständig. Jakob Wehe und Ulrich Schön sowie zwei andere Bauernführer wurden gefangen und enthauptet; Leipheim kapitulierte, und mit einigen Streifzügen in der Umgegend war der ganze Bezirk unterworfen.
Eine neue Rebellion der Landsknechte, durch das Verlangen der Plünderung und einer Extralöhnung veranlasst, hielt den Truchsess abermals bis zum 10. April auf. Dann zog er südwestlich gegen die Baltringer, die inzwischen in seine Herrschaften Waldburg, Zeil und Wolfegg eingefallen waren und seine Schlösser belagerten. Auch hier fand er die Bauern zersplittert und schlug sie am 11. und 12. April nacheinander in einzelnen Gefechten, die den Baltringer Haufen ebenfalls vollständig auflösten. Der Rest zog sich unter dem Pfaffen Florian auf den Seehaufen zurück. Gegen diesen wandte sich nun der Truchsess. Der Seehaufen, der inzwischen nicht nur Streifzüge gemacht, sondern auch die Städte Buchhorn (Friedrichshafen) und Wollmatingen in die Verbrüderung gebracht hatte, hielt am 13. großen Kriegsrat im Kloster Salem und beschloss, dem Truchsess entgegenzuziehen. Sofort wurde überall Sturm geläutet, und 10.000 Mann, zu denen noch die geschlagenen Baltringer stießen, versammelten sich im Bermatinger Lager. Sie bestanden am 15. April ein günstiges Gefecht mit dem Truchsess, der seine Armee hier nicht in einer Entscheidungsschlacht aufs Spiel setzen wollte und vorzog zu unterhandeln, um so mehr, als er erfuhr, dass die Allgäuer und Hegauer ebenfalls heranrückten. Er schloss also am 17. April mit den Seebauern und Baltringern zu Weingarten einen für sie scheinbar ziemlich günstigen Vertrag, auf den die Bauern ohne Bedenken eingingen. Er brachte es ferner dahin, dass die Delegierten der Ober- und Unterallgäuer diesen Vertrag ebenfalls annahmen, und zog dann nach Württemberg ab.
Verpasster Sieg
Die List des Truchsess rettete ihn hier vor sicherem Untergang. Hätte er nicht verstanden, die schwachen, beschränkten, größtenteils schon demoralisierten Bauern und ihre meist unfähigen, ängstlichen und bestechlichen Führer zu betören, so war er mit seiner kleinen Armee zwischen vier Kolonnen, zusammen mindestens 25.000 bis 30.000 Mann stark, eingeschlossen und unbedingt verloren. Aber die bei Bauernmassen immer unvermeidliche Borniertheit seiner Feinde machte es ihm möglich, sich ihrer gerade in dem Moment zu entledigen, wo sie den ganzen Krieg, wenigstens für Schwaben und Franken, mit einem Schlage beendigen konnten. Die Seebauern hielten den Vertrag, mit dem sie schließlich natürlich geprellt wurden, so genau, dass sie später gegen ihre eigenen Bundesgenossen, die Hegauer, die Waffen ergriffen; die Allgäuer, durch ihre Führer in den Verrat verwickelt, sagten sich zwar gleich davon los, aber inzwischen war der Truchsess aus der Gefahr.
Die Hegauer, obwohl nicht in den Weingartner Vertrag eingeschlossen, gaben gleich darauf einen neuen Beleg von der grenzenlosen Lokalborniertheit und dem eigensinnigen Provinzialismus, der den ganzen Bauernkrieg zugrunde richtete. Nachdem der Truchsess vergeblich mit ihnen unterhandelt hatte und nach Württemberg abmarschiert war, zogen sie ihm nach und blieben ihm fortwährend in der Flanke; es fiel ihnen aber nicht ein, sich mit dem württembergischen hellen christlichen Haufen zu vereinigen, und zwar aus dem Grunde, weil die Württemberger und Neckartaler ihnen auch einmal Hilfe abgeschlagen hatten. Als daher der Truchsess sich weit genug von ihrer Heimat entfernt hatte, kehrten sie ruhig wieder um und zogen gegen Freiburg.
List und Verrat
Wir verließen die Württemberger unter Matern Feuerbacher bei Kirchheim unter Teck, von wo das vom Truchsess zurückgelassene Beobachtungskorps unter Dietrich Spät sich nach Urach zurückgezogen hatte. Nach einem vergeblichen Versuch auf Urach wandte sich Feuerbacher nach Nürtingen und schrieb an alle benachbarten Insurgentenhaufen um Zuzug für die Entscheidungsschlacht. Bei Böblingen stieß der Truchsess auf die vereinigten Haufen. Ihre Zahl, ihr Geschütz und ihre Stellung machten ihn stutzig; er fing nach seiner üblichen Methode sofort Unterhandlungen an und schloss einen Waffenstillstand mit den Bauern. Kaum hatte er sie hierdurch sicher gemacht, so überfiel er sie am 12. Mai während des Waffenstillstandes und zwang sie zu einer Entscheidungsschlacht. Die Bauern leisteten langen und tapferen Widerstand, bis endlich Böblingen dem Truchsess durch den Verrat der Bürgerschaft überliefert wurde. Der linke Flügel der Bauern war hiermit seines Stützpunktes beraubt, wurde geworfen und umgangen. Hierdurch war die Schlacht entschieden. Die undisziplinierten Bauern gerieten in Unordnung und bald in wilde Flucht; was nicht von den bündischen Reitern niedergemacht oder gefangen wurde, warf die Waffen weg und eilte nach Hause. Der „helle christliche Haufen“, und mit ihm die ganze württembergische Insurrektion, war vollständig aufgelöst. Theus Gerber entkam nach Esslingen, Feuerbacher floh nach der Schweiz, Jäcklein Rohrbach wurde gefangen und in Ketten bis Neckargartach mitgeschleppt, wo ihn der Truchsess an einen Pfahl ketten, ringsherum Holz aufschichten und so bei langsamem Feuer lebendig braten ließ, während er selbst, mit seinen Rittern zechend, sich an diesem ritterlichen Schauspiel weidete.
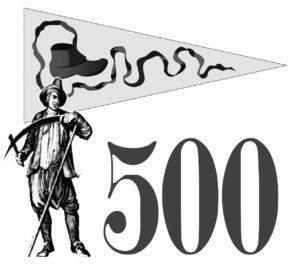
Von Neckargartach aus unterstützte der Truchsess durch einen Einfall in den Kraichgau die Operationen des Kurfürsten von der Pfalz. Dieser, der inzwischen Truppen gesammelt, brach auf die Nachricht von den Erfolgen des Truchsess sofort den Vertrag mit den Bauern, überfiel am 23. Mai den Bruchrain, nahm und verbrannte Malsch nach heftigem Widerstand, plünderte eine Anzahl von Dörfern und besetzte Bruchsal. Zu gleicher Zeit überfiel der Truchsess Eppingen und nahm den dortigen Chef der Bewegung, Anton Eisenhut, gefangen, den der Kurfürst nebst einem Dutzend anderer Bauernführer sogleich hinrichten ließ.
Vorahnung der bürgerlichen Gesellschaft
Die Nachricht von der Böblinger Niederlage hatte überall Schrecken unter den Insurgenten verbreitet. Die freien Reichsstädte, soweit sie unter die drückende Hand der Bauern geraten waren, atmeten plötzlich wieder auf. Heilbronn war die erste, die zur Versöhnung mit dem Schwäbischen Bund Schritte tat. In Heilbronn saßen die Bauernkanzlei und die Delegierten der verschiedenen Haufen, um die Anträge zu beraten, die im Namen sämtlicher insurgierten Bauern an Kaiser und Reich gestellt werden sollten. In diesen Verhandlungen, die ein allgemeines, für ganz Deutschland gültiges Resultat haben sollten, stellte sich abermals heraus, wie kein einzelner Stand, auch der der Bauern nicht, weit genug entwickelt war, um von seinem Standpunkt aus die gesamten deutschen Zustände neu zu gestalten. Es zeigte sich sogleich, dass man zu diesem Zweck den Adel und ganz besonders die Bürgerschaft gewinnen musste. Wendel Hipler bekam hiermit die Leitung der Verhandlungen in seine Hände. Wendel Hipler erkannte von allen Führern der Bewegung die bestehenden Verhältnisse am richtigsten. Er war kein weitgreifender Revolutionär wie Müntzer, kein Repräsentant der Bauern wie Metzler oder Rohrbach. Seine vielseitige Erfahrung, seine praktische Kenntnis der Stellung der einzelnen Stände gegeneinander verhinderte ihn, einen der in die Bewegung verwickelten Stände gegen die anderen ausschließlich zu vertreten. Gerade wie Müntzer, als Repräsentant der ganz außer dem bisherigen offiziellen Gesellschaftsverband stehenden Klasse, der Anfänge des Proletariats, zur Vorahnung des Kommunismus getrieben wurde, geradeso kam Wendel Hipler, der Repräsentant sozusagen des Durchschnitts aller progressiven Elemente der Nation, bei der Vorahnung der modernen bürgerlichen Gesellschaft an. Die Grundsätze, die er vertrat, die Forderungen, die er aufstellte, waren zwar nicht das unmittelbar Mögliche, sie waren aber das, etwas idealisierte, notwendige Resultat der bestehenden Auflösung der feudalen Gesellschaft; und die Bauern, sobald sie sich darangaben, für das ganze Reich Gesetzentwürfe zu machen, waren genötigt, darauf einzugehen. So nahm die Zentralisation, die von den Bauern gefordert wurde, hier in Heilbronn eine positivere Gestalt an, eine Gestalt, die von der Vorstellung der Bauern über sie indes himmelweit verschieden war. So wurde sie zum Beispiel in der Herstellung der Einheit von Münze, Maß und Gewicht, in der Aufhebung der inneren Zölle et cetera näher bestimmt, kurz, in Forderungen, die weit mehr im Interesse der Städtebürger als der Bauern waren. So wurden dem Adel Konzessionen gemacht, die sich den modernen Ablösungen bedeutend nähern und die auf die schließliche Verwandlung des feudalen Grundbesitzes in bürgerlichen hinausliefen. Kurz, sobald die Forderungen der Bauern zu einer „Reichsreform“ zusammengefasst wurden, mussten sie sich nicht den momentanen Forderungen, aber den definitiven Interessen der Bürger unterordnen.
Konterrevolutionäre Wut
Während diese Reichsreform in Heilbronn noch debattiert wurde, reiste der Verfasser der „Deklaration der Zwölf Artikel“, Hans Berlin, schon dem Truchsess entgegen, um im Namen der Ehrbarkeit und Bürgerschaft wegen Übergabe der Stadt zu unterhandeln. Reaktionäre Bewegungen in der Stadt unterstützten den Verrat, und Wendel Hipler musste mit den Bauern fliehen. Er ging nach Weinsberg, wo er die Trümmer der Württemberger und die wenige mobile Mannschaft der Gaildorfer zu sammeln suchte. Aber das Herannahen des Kurfürsten von der Pfalz und des Truchsess vertrieb ihn auch von hier, und so musste er nach Würzburg gehen, um den hellen lichten Haufen in Bewegung zu bringen. Die bündischen und kurfürstlichen Truppen unterwarfen indes die ganze Neckargegend, zwangen die Bauern, neu zu huldigen, verbrannten viele Dörfer und erstachen oder hängten alle flüchtigen Bauern, deren sie habhaft wurden. Weinsberg wurde, zur Rache für die Hinrichtung des Helfensteiners, niedergebrannt.
Die vor Würzburg vereinigten Haufen hatten inzwischen den Frauenberg belagert und am 15. Mai, noch ehe die Bresche geschossen war, einen tapferen, aber vergeblichen Sturm auf die Festung versucht. 400 der besten Leute, meist von Florian Geyers Schar, blieben in den Gräben tot oder verwundet liegen. Zwei Tage später, am 17., kam Wendel Hipler an und ließ einen Kriegsrat halten. Er schlug vor, nur 4.000 Mann vor dem Frauenberg zu lassen und mit der ganzen, an 20.000 Mann starken Hauptmacht unter den Augen des Truchsess bei Krautheim an der Jagst ein Lager zu beziehen, auf das sich alle Verstärkungen konzentrieren könnten. Der Plan war vortrefflich; nur durch Zusammenhalten der Massen und durch Überzahl konnte man hoffen, das jetzt an 13.000 Mann starke fürstliche Heer zu schlagen. Aber schon war die Demoralisation und Entmutigung unter den Bauern zu groß geworden, um noch irgendeine energische Aktion zuzulassen. Götz von Berlichingen, der bald darauf offen als Verräter auftrat, mag auch dazu beigetragen haben, den Haufen hinzuhalten, und so wurde der Hiplersche Plan nie ausgeführt. Stattdessen wurden die Haufen, wie immer, zersplittert. Erst am 23. Mai setzte sich der helle lichte Haufen in Bewegung, nachdem die Franken versprochen hatten, schleunigst zu folgen. Am 26. wurden die in Würzburg lagernden markgräflich-ansbachschen Fähnlein heimgerufen durch die Nachricht, dass der Markgraf die Feindseligkeiten gegen die Bauern eröffnet habe. Der Rest des Belagerungsheers, nebst Florian Geyers Schwarzer Schar, nahm Position bei Heidingsfeld, nicht weit von Würzburg.
Zerfall
Der helle lichte Haufen kam am 24. Mai in Krautheim an, in einem wenig schlagfertigen Zustand. Hier hörten viele, dass ihre Dörfer inzwischen dem Truchsess gehuldigt hatten, und nahmen dies zum Vorwand, um nach Hause zu gehen. Der Haufen zog weiter nach Neckarsulm und unterhandelte am 28. mit dem Truchsess. Zugleich wurden Boten an die Franken, Elsässer und Schwarzwald-Hegauer mit der Aufforderung zu schleunigem Zuzug geschickt. Von Neckarsulm marschierte Götz von Berlichingen auf Öhringen zurück. Der Haufen schmolz täglich zusammen; auch Götz von Berlichingen verschwand während des Marsches; er war heimgeritten, nachdem er schon früher durch seinen alten Waffengefährten Dietrich Spät mit dem Truchsess wegen seines Übertritts unterhandelt hatte. Bei Öhringen, infolge falscher Nachrichten über das Herannahen des Feindes, ergriff plötzlich ein panischer Schreck die rat- und mutlose Masse; der Haufen lief in voller Unordnung auseinander, und nur mit Mühe konnten Metzler und Wendel Hipler etwa 2.000 Mann zusammenhalten, die sie wieder auf Krautheim führten. Inzwischen war das fränkische Aufgebot, 5.000 Mann stark, herangekommen, aber durch einen von Götz offenbar in verräterischer Absicht angeordneten Seitenmarsch über Löwenstein nach Öhringen verfehlte es den hellen Haufen und zog auf Neckarsulm. Dies Städtchen, von einigen Fähnlein des hellen lichten Haufens besetzt, wurde vom Truchsess belagert. Die Franken kamen in der Nacht an und sahen die Feuer des bündischen Lagers; aber ihre Führer hatten nicht den Mut, einen Überfall zu wagen, und zogen sich nach Krautheim zurück, wo sie endlich den Rest des hellen lichten Haufens fanden. Neckarsulm ergab sich, als kein Entsatz kam, am 29. an die Bündischen, der Truchsess ließ sofort 13 Bauern hinrichten und zog dann sengend und brennend, plündernd und mordend den Haufen entgegen. Im ganzen Neckar-, Kocher- und Jagsttal bezeichneten Schutthaufen und an den Bäumen aufgehängte Bauern seinen Weg.
Mordbrennerhorden
Bei Krautheim stieß das bündische Heer auf die Bauern, die sich, durch eine Flankenbewegung des Truchsess gezwungen, auf Königshofen an der Tauber zurückgezogen. Hier fassten sie, 8.000 Mann mit 32 Kanonen, Position. Der Truchsess näherte sich ihnen hinter Hügeln und Wäldern versteckt, ließ Umgehungskolonnen vorrücken und überfiel sie am 2. Juni mit solcher Übermacht und Energie, dass sie trotz der hartnäckigsten, bis in die Nacht fortgesetzten Gegenwehr mehrerer Kolonnen vollständig geschlagen und aufgelöst wurden. Wie immer, trug auch hier die bündische Reiterei, „der Bauern Tod“, hauptsächlich zur Vernichtung des Insurgentenheers bei, indem sie sich auf die durch Artillerie, Büchsenfeuer und Lanzenangriffe erschütterten Bauern warf, sie vollständig zersprengte und einzeln niedermachte. Welche Art von Krieg der Truchsess mit seinen Reitern führte, beweist das Schicksal der 300 Königshofener Bürger, die beim Bauernheer waren. Sie wurden während der Schlacht bis auf 15 niedergehauen, und von diesen 15 wurden nachträglich noch vier enthauptet.
Der Truchsess, der schon gleich nach dem Sieg von Königshofen den Belagerten auf dem Frauenberg Nachricht gegeben hatte, rückte nun auf Würzburg. Der Rat verständigte sich heimlich mit ihm, so dass das bündische Heer in der Nacht des 7. Juni die Stadt nebst den darin befindlichen 5.000 Bauern umzingeln und am nächsten Morgen in die vom Rat geöffneten Tore ohne Schwertstreich einziehen konnte. Durch diesen Verrat der Würzburger „Ehrbarkeit“ wurden der letzte fränkische Bauernhaufen entwaffnet und sämtliche Führer gefangen. Der Truchsess ließ sogleich 81 enthaupten. Hier in Würzburg trafen nun nacheinander die verschiedenen fränkischen Fürsten ein; der Bischof von Würzburg selbst, der von Bamberg und der Markgraf von Brandenburg-Ansbach. Die gnädigen Herren verteilten unter sich die Rollen. Der Truchsess zog mit dem Bischof von Bamberg, der jetzt sofort den mit seinen Bauern abgeschlossenen Vertrag brach und sein Land den wütenden Mordbrennerhorden des bündischen Heeres preisgab. Der Markgraf Kasimir verwüstete sein eigenes Land. Deiningen wurde verbrannt; zahllose Dörfer wurden geplündert oder den Flammen preisgegeben; dabei hielt der Markgraf in jeder Stadt ein Blutgericht ab. In Neustadt an der Aisch ließ er 18, in Bergel 43 Rebellen enthaupten. Von da zog er nach Rothenburg, wo die Ehrbarkeit bereits eine Konterrevolution gemacht und Stephan von Menzingen verhaftet hatte. Die Rothenburger Kleinbürger und Plebejer mussten jetzt schwer dafür büßen, dass sie sich den Bauern gegenüber so zweideutig benommen, dass sie ihnen bis ganz zuletzt alle Hilfe abgeschlagen, dass sie in ihrem lokalbornierten Eigennutz auf Unterdrückung der ländlichen Gewerbe zugunsten der städtischen Zünfte bestanden und nur widerwillig die aus den Feudalleistungen der Bauern fließenden städtischen Einkünfte aufgegeben hatten. Der Markgraf ließ ihrer 16 köpfen, voran natürlich Menzingen. – Der Bischof von Würzburg durchzog in gleicher Weise sein Gebiet, überall plündernd, verwüstend und sengend. Er ließ auf seinem Siegeszug 256 Rebellen hinrichten und krönte sein Werk, bei seiner Rückkehr nach Würzburg, durch die Enthauptung von noch 13 Würzburgern.
Von sämtlichen Haufen blieben jetzt nur noch zwei zu besiegen: die Hegau-Schwarzwälder und die Allgäuer. Mit beiden hatte der Erzherzog Ferdinand intrigiert. Wie Markgraf Kasimir und andere Fürsten den Aufstand zur Aneignung der geistlichen Ländereien und Fürstentümer, so suchte er ihn zur Vergrößerung der österreichischen Hausmacht zu benutzen. Er hatte mit dem Allgäuer Hauptmann Walter Bach und mit dem Hegauer Hans Müller von Bulgenbach unterhandelt, um die Bauern dahin zu bringen, sich für den Anschluss an Österreich zu erklären, aber obwohl beide Chefs käuflich waren, konnten sie bei den Haufen weiter nichts durchsetzen, als dass die Allgäuer mit dem Erzherzog einen Waffenstillstand schlossen und die Neutralität gegen Österreich beobachteten.
Die Hegauer hatten auf ihrem Rückzug aus dem Württembergischen eine Anzahl Schlösser zerstört und Verstärkungen aus den markgräflich-badischen Ländern an sich gezogen. Sie marschierten am 13. Mai gegen Freiburg, beschossen es vom 18. an und zogen am 23., nachdem die Stadt kapituliert hatte, mit fliegenden Fahnen hinein. Von dort zogen sie gegen Stockach und Radolfzell und führten lange einen erfolglosen kleinen Krieg gegen die Besatzungen dieser Städte. Diese, sowie der Adel und die umliegenden Städte, riefen kraft des Weingartner Vertrags die Seebauern um Hilfe an, und die ehemaligen Rebellen des Seehaufens erhoben sich, 5.000 Mann stark, gegen ihre Bundesgenossen. So stark war die Lokalborniertheit dieser Bauern. Nur 600 weigerten sich, wollten sich den Hegauern anschließen und wurden massakriert. Die Hegauer jedoch hatten bereits die Belagerung aufgehoben und waren meist auseinandergegangen.
Das Ende
Die Allgäuer hatten seit dem Abzug des Truchsess ihre Kampagne gegen Klöster und Schlösser wieder aufgenommen und für die Verwüstungen der Bündischen energische Repressalien geübt. Sie hatten wenig Truppen sich gegenüber, die nur einzelne kleine Überfälle unternahmen, ihnen aber nie in die Wälder folgen konnten. Im Juni brach in Memmingen, das sich ziemlich neutral gehalten hatte, eine Bewegung gegen die Ehrbarkeit aus, die nur durch die zufällige Nähe einiger bündischer Truppen, welche der Ehrbarkeit noch zur rechten Zeit zu Hilfe kommen konnten, unterdrückt wurde. Schappeler, der Prediger und Führer der plebejischen Bewegung, entkam nach Sankt Gallen. Die Bauern zogen nun vor die Stadt und wollten eben mit dem Brescheschießen beginnen, als sie erfuhren, dass der Truchsess von Würzburg heranzog. Am 27. Juli marschierten sie ihm in zwei Kolonnen über Babenhausen und Obergünzburg entgegen. Der Erzherzog Ferdinand versuchte nochmals die Bauern für das Haus Österreich zu gewinnen. Gestützt auf den Waffenstillstand, den er mit ihnen abgeschlossen, forderte er den Truchsess auf, nicht weiter gegen sie vorzurücken. Der Schwäbische Bund jedoch befahl ihm, sie anzugreifen und nur das Sengen und Brennen zu lassen; der Truchsess war indes viel zu klug, um auf sein erstes und entscheidendstes Kriegsmittel zu verzichten, selbst wenn es ihm möglich gewesen wäre, die vom Bodensee bis an den Main von Exzess zu Exzess geführten Landsknechte im Zaum zu halten. Die Bauern fassten Position hinter der Iller und Leubas, an 23.000 Mann stark. Der Truchsess stand ihrer Front gegenüber mit 11.000 Mann. Die Stellungen beider Heere waren stark; die Reiterei konnte auf dem vorliegenden Terrain nicht wirken, und wenn die Landsknechte des Truchsess an Organisation, militärischen Hilfsquellen und Disziplin den Bauern überlegen waren, so zählten die Allgäuer eine Menge gedienter Soldaten und erfahrener Hauptleute in ihren Reihen und hatten zahlreiches, gut bedientes Geschütz. Am 19. Juli eröffneten die Bündischen eine Kanonade, die von beiden Seiten am 20. fortgesetzt wurde, jedoch ohne Resultat. Am 21. stieß Georg von Frundsberg mit 3.000 Landsknechten zum Truchsess. Er kannte viele der Bauernhauptleute, die unter ihm in den italienischen Feldzügen gedient hatten, und knüpfte Unterhandlungen mit ihnen an. Der Verrat gelang, wo die militärischen Hilfsmittel nicht ausreichten. Walter Bach, mehrere andere Hauptleute und Geschützmeister ließen sich kaufen. Sie ließen den ganzen Pulvervorrat der Bauern in Brand stecken und bewegten den Haufen zu einem Umgehungsversuch. Kaum aber waren die Bauern aus ihrer festen Stellung heraus, so fielen sie in den Hinterhalt, den ihnen der Truchsess nach Verabredung mit Bach und den anderen Verrätern gelegt hatte. Sie konnten sich um so weniger verteidigen, als ihre Hauptleute, die Verräter, sie unter dem Vorwand einer Rekognoszierung verlassen hatten und schon auf dem Wege nach der Schweiz waren. Zwei der Bauernkolonnen wurden so vollständig zersprengt, die dritte, unter dem Knopf von Leubas, konnte sich noch geordnet zurückziehen. Sie stellte sich wieder auf dem Kollenberg bei Kempten, wo der Truchsess sie einschloss. Auch hier wagte er nicht, sie anzugreifen; er schnitt ihr die Zufuhr ab und suchte sie zu demoralisieren, indem er an 200 Dörfer in der Umgegend niederbrennen ließ. Der Hunger und der Anblick ihrer brennenden Wohnungen brachten die Bauern endlich dahin, dass sie sich ergaben (25. Juli). Mehr als 20 wurden sogleich hingerichtet. Der Knopf von Leubas, der einzige Führer dieses Haufens, der seine Fahne nicht verraten hatte, entkam nach Bregenz; aber hier wurde er verhaftet und nach langem Gefängnis gehängt.
Damit war der schwäbisch-fränkische Bauernkrieg beendet.
Worterklärungen
Plebejer: städtische Unterschichten
Truchsess von Waldburg: Heerführer. Seit 1525 Statthalter des Kaisers im Herzogtum Württemberg
Bündisch / Schwäbischer Bund: Zusammenschluss der schwäbischen Fürsten, Grafen und kirchlichen Würdenträger sowie der Freien und Reichsstädte
disponibel: verfügbar
Insurrektion: Aufstand
Borniertheit: Engstirnigkeit, Beschränktheit
Provinzialismus: nur auf lokale Interessen bedacht
Konzession: hier Zugeständnis
Ehrbarkeit: städtische Oberschicht
Graf von Helfenstein: Hingerichtet von den Bauern nach dem Fall von Weinsberg. Siehe Teil 6 vom 11. April
Bresche: Lücke in einer Festungsmauer
Fähnlein: militärische Formation mit etwa 400 Landsknechten
Erzherzog Ferdinand: Erzherzog von Österreich und Bruder des Kaisers Karl V.
Repressalien: Vergeltungsmaßnahmen
Rekognoszierung: Erkundung









