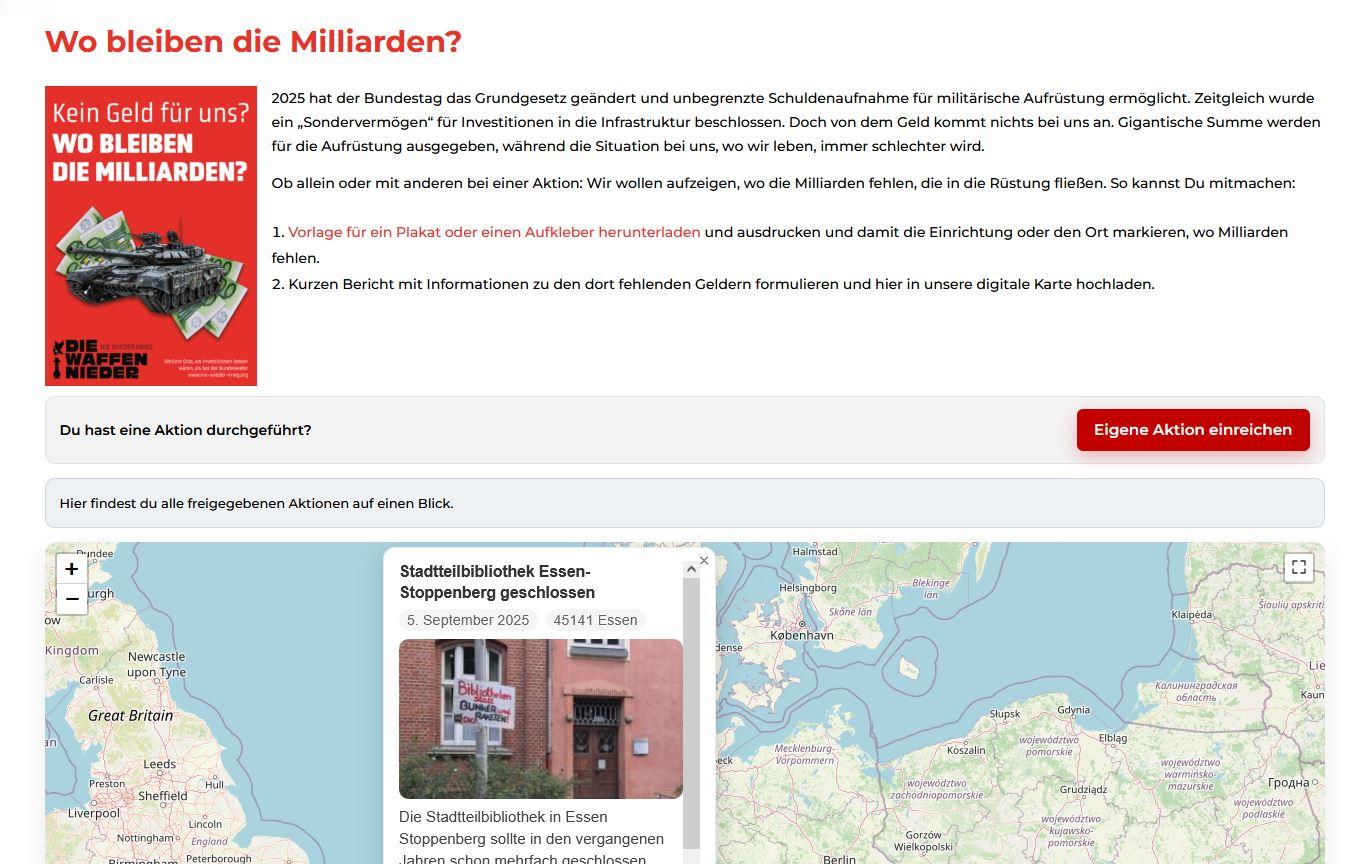An monatelanges Warten auf Facharzttermine, überarbeitetes Krankenhauspersonal und Untersuchungen von fragwürdigem medizinischen Nutzen haben sich viele Menschen in Deutschland gewöhnt. Immer schwerer wird es, sich Alternativen zum real existierenden Gesundheitssystem vorzustellen. Eine Veranstaltung des Dortmunder Bündnis für mehr Personal im Gesundheitswesen zusammen mit dem Verein zur Förderung eines solidarischen und öffentlichen Gesundheitswesens NRW hat sich am Donnerstag in Dortmund der Frage gewidmet, wie ein Gesundheitssystem beschaffen sein müsste, das konsequent am Gemeinwohl ausgerichtet ist – statt dem Zwang unterliegt, Profite zu erwirtschaften.
Der Krankenpfleger und ver.di-Aktive Jan von Hagen berichtete aus seiner beruflichen Praxis, und Matthew Read stellte eine Alternative zum Status quo vor: Das Gesundheitssystem der DDR. Read arbeitet für die Internationale Forschungsstelle DDR in Berlin.
Wie katastrophal die Zustände im Gesundheitssystem der BRD sind, klang in Jan von Hagens Schilderungen eingangs an. Der Krankenpfleger arbeitet auf einer geschlossenen psychiatrischen Station. Ein intensives Arbeitsfeld sei das, mit einer jungen Belegschaft. Als er eine Pflegeschülerin einarbeiten sollte, habe er sich nicht eine Minute lang mit ihr beschäftigten können, seiner Arbeitsbelastung wegen. Als er sich nach Ende der Schicht bei ihr entschuldigte, habe die Auszubildende ihm gesagt, das kenne sie seit dem ersten Tag ihrer Ausbildung. Am Schlimmsten sei gewesen, dass sie das bar jeglicher Empörung gesagt habe. Pflegekräfte in Deutschland kämen auf ein Drittel mehr Krankheitstage pro Jahr als der Durchschnitt, die Burnout-Quote sei doppelt so hoch, erklärte von Hagen. Wer sein ganzes Arbeitsleben als Pfleger verbringe, dessen Lebenserwartung sei signifikant geringer. 54 Prozent der Pfleger könnten sich nicht vorstellen, bis zur Rente in ihrem Beruf zu arbeiten. 50 Prozent der Auszubildenden in diesem Bereich wüssten schon während ihrer Ausbildung, dass sie später nicht Vollzeit arbeiten. 20 Prozent von ihnen, dass sie nach der Ausbildung die Branche wechselten. Besserung sei nicht in Sicht: Karl Lauterbachs Krankenhausreform verschärfe die Bedingungen weiter, und Angriffe auf die Arbeitszeit nähmen zu. „Ich bin hier, um Mut zu bekommen“, schloss von Hagen.
Anders als die BRD habe die junge DDR mit der Geschichte gebrochen, erläuterte Matthew Read. Die Vergesellschaftung des Eigentums an Produktionsmitteln im Sozialismus habe die Grundlage für den Umbau des Gesundheitswesens gebildet und ermöglicht, medizinische Bedürfnisse von privatwirtschaftlichen Interessen zu trennen.
Dabei waren die Ausgangsbedingungen in der DDR schwieriger als in der BRD. Dort habe es nach dem Krieg prozentual mehr zerstörte Krankenhäuser gegeben als in der BRD, und es habe an Medikamenten gefehlt. 45 Prozent der Ärzte seien Mitglied der NSDAP gewesen, eine der höchsten Quoten aller Berufsgruppen. Viele Ärzte seien in die BRD ausgewandert aus Angst, für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Während ein niedergelassener Arzt in der BRD ein finanzielles Interesse daran habe, Patienten zu behandeln, habe in der DDR das Vorsorgeprinzip im Mittelpunkt des Gesundheitswesens gestanden. Gesundheitsschutz sei dort als gesellschaftliche Aufgabe verstanden worden. 1951 richtete die DDR das erste Gesundheitsministerium Deutschlands ein. An dessen Spitze standen in der DDR immer Ärzte, keine Berufspolitiker.
Ein zentrales Element dieses Gesundheitssystems war die Poliklinik. Dort habe es „alles unter einem Dach“ gegeben, berichtete Read. Durchschnittlich 18 bis 19 Ärzte je Poliklinik hätten längere Öffnungszeiten ermöglicht und Ärzten erlaubt, in den Urlaub zu fahren, ohne dass deren Patienten auf andere Praxen ausweichen mussten. Labor, physiotherapeutische Einrichtungen und moderne Diagnosetechnik machten Überweisungen zu anderen Ärzten überflüssig. Überdies waren Polikliniken auch mit Instanzen außerhalb ihrer Räumlichkeiten verknüpft: Apotheken und Beratungsstellen etwa. Diese holistische Herangehensweise habe geholfen, Krankheiten vorzubeugen, und stationäre Aufenthalte sowie Bürokratie minimiert, stellte Read fest. Die Beschäftigten der Polikliniken seien Staatsangestellte gewesen. Statt Ärzte als Chefs und Krankenpflegern und Arzthelfern als Angestellte seien alle Beschäftigten Kollegen gewesen.
Die Diskussion, die sich an die Vorträge von Jan von Hagen und Matthew Read anschloss, drehte sich vor allem um die Frage, wie Beschäftigte des Gesundheitswesens in der BRD eine bessere Versorgung erkämpfen können. Eine Phase, in der Beschäftigte Erfolge erzielen konnten, sei mit der Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG) zuende gegangen. Danach hätten sich die Bedingungen massiv verschlechtert. Von Hagen verwies auf die Entlastungsstreiks von Krankenpflegern, etwa an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen vor drei Jahren. Die habe ein Bündnis sich überschneidender Interessen möglich gemacht – überlastete Pfleger auf der einen Seite, auf der anderen Bürger, die unter der schlechter werdenden Versorgung leiden. Sein Eindruck sei, dass Bewusstsein dafür, dass Gesundheitsversorgung eine gesellschaftliche Aufgabe sei, gehe aktuell zurück.
Von Hagen ging auch auf Abwehrkämpfe gegen die Schließung von Krankenhäusern ein. Ein solcher sei im Essener Norden verloren gegangen. Eine Ursache liege in der Spaltung der Belegschaft, erläuterte der Krankenpfleger: Ärzte und Pfleger hätten sofort neue Jobs gefunden und deshalb nicht zusammen mit anderen Berufsgruppen im Krankenhaus für dessen Erhalt gekämpft.
Für erfolgreiche Arbeitskämpfe in Krankenhäusern gelte es, die Öffentlichkeit mit den Beschäftigten zusammenzubringen, unterstrich Jan von Hagen. Es sei notwendig, auf der Basis ökonomischer Kämpfe politische Kämpfe zu führen. „Wir müssen die 42-Stunden-Woche wieder weg kriegen, sonst verfestigt sich das“, sagte er mit Blick auf das Ergebnis nach der Tarifrunde öffentlicher Dienst. Das sieht die Möglichkeit vor, auf „freiwilliger Basis“ die Wochenarbeitszeit auf bis zu 42 Stunden zu erhöhen. Aktuell gebe es massive Angriffe auf Krankenhausbeschäftigte.
Zum Schluss ging Jan von Hagen noch auf ein Thema ein, das über den Fokus der Veranstaltung hinaus wies. Die laufende Militarisierung des Gesundheitswesens sei ein wichtiges Thema in Krankenhaus-Belegschaften. In den ersten drei Monaten des Vietnam-Krieges habe es dort 60.000 Verbrennungsopfer gegeben. In ganz Deutschland gebe es heute 180 Betten für Verbrennungsopfer. Es brauche Aufklärung darüber, was Krieg konkret bedeute in Krankenhäusern. „Wir müssen jede Münze in die Verhinderung des Krieges stecken!“
Die Internationale Forschungsstelle DDR hat hier mehr zum Gesundheitssystem der DDR geschrieben.