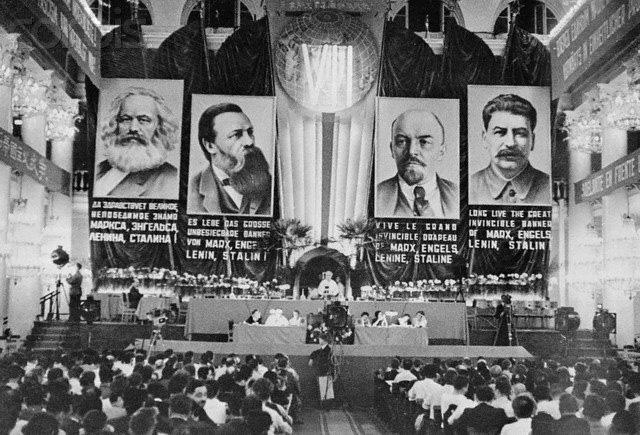Vom 25. Juli bis zum 20. August 1935 tagte in Moskau der VII. Weltkongress der Komintern (KI). Im Rahmen des Kongresses wurde die veränderte Lage nach der Übergabe der Macht an die Faschisten in Italien und Deutschland analysiert. Verschiedene in der kommunistischen Weltbewegung aufgetretene Fehler wurden korrigiert. Mit der Volksfront entwickelte die KI eine der Situation des Klassenkampfs angemessene Taktik auf der Grundlage der Einheitsfrontstrategie. Von „links“ und rechts werden die Ergebnisse des Kongresses immer wieder verkürzt und fehlinterpretiert und dadurch zu Quellen von Dogmatismus und Opportunismus. Für die DKP ordnete deren Vorsitzender Patrik Köbele auf dem 26. Parteitag im Juni ein: „Wir halten am VII. Weltkongress fest, wir sehen ihn als wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der marxistisch-leninistischen Theorie und Praxis. Wir sehen in den Dokumenten des VII. Weltkongresses eine große Anwendung des Marxismus auf die Analyse der damaligen Situation und einen wesentlichen Bestandteil der Weiterentwicklung unserer weltanschaulichen Instrumente. Wir verwenden sie nicht als Dogma, aber als schöpferische Quelle für unsere Strategie und Taktik.“ In der vergangenen Woche beschäftigten wir uns mit dem Referat von Georgi Dimitroff. In der kommenden Woche folgt ein Artikel zum Referat Palmiro Togliattis.
Wilhelm Pieck war 1934 der Parteivorsitz der KPD übertragen worden für die Zeit, in welcher der eigentliche Vorsitzende, Ernst Thälmann, durch seine Inhaftierung in Nazi-Deutschland an der Ausübung seines Amts gehindert war. Beim VII. Weltkongress der Komintern (KI) im Sommer 1935 gab er mit seinem Referat „Über die Tätigkeit des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale“ einen Überblick über den Entwicklungsstand der KI und ihrer wichtigsten Sektionen und verband dies mit einer Bewertung ihrer bisherigen Strategie sowie der politischen Weltlage.
Pieck stellt fest, dass die Weltwirtschaftskrise zum Ende der 1920er Jahre die Hoffnungen der Sozialdemokratie begraben hat, wonach der Kapitalismus nun in eine von technischen Neuerungen getragene Phase der Prosperität eingetreten sei. Die Erwartung, es nun mit einem „organisierten“ – gewissermaßen krisenresistenten – Kapitalismus zu tun zu haben, welcher die Perspektive eines friedlichen Hinüberwachsens in den Sozialismus eröffne, wurde im Zeichen des „Schwarzen Freitags“ blamiert. Pieck zitiert zustimmend Stalin, der bereits 1927 darauf verwiesen hatte, dass das aktuelle Wirtschaftswachstum des Westens bei ausbleibender Erweiterung der Weltmarktgrenzen das Vorspiel zur nächsten Krise darstelle. Als diese eintrat und die politischen Verhältnisse sich zuspitzten, sah die Führung der SPD ihre Aufgabe darin, die Werktätigen durch den Glauben an die Weimarer Verfassung und einen weltfremden Legalitätsfetischismus von entschlossenen Aktionen gegen die immer bedrohlichere Rechtsentwicklung abzuhalten. Ein dramatisches Beispiel bot der 20. Juli 1932, als der erzreaktionäre Reichspräsident Paul von Hindenburg im Zusammenspiel mit seinem Reichskanzler Franz von Papen in einer staatsstreichähnlichen Aktion die SPD-geführte Landesregierung in Preußen davonjagen ließ und die dortige Regierungsgewalt von Papen als Reichskommissar übertrug. Es war unübersehbar, wie morsch das Gebäude der Weimarer Demokratie bereits war. Und es waren keine Nazis, die hier auf Regierungsebene die Axt anlegten.
Pieck legt dar, dass die im Zeichen dieser Entwicklung von der KI entwickelte Linie „Klasse gegen Klasse“ – das heißt: Proletariat gegen Bourgeoisie – prinzipiell richtig war, aber in der Praxis durch sektiererische Fehler der KPD entstellt wurde. Es war notwendig, den opportunistischen Kurs der Klassenkollaboration durch SPD und ADGB zu bekämpfen. Die Gewerkschaftsbürokratie antwortete darauf mit dem Ausschluss kommunistischer Mitglieder. In ihrer Erbitterung ließen sich diese aber zu ultralinken Überspitzungen verleiten. So wurden einfache SPD-Mitglieder als „kleine Zörgiebel“ beschimpft unter Bezugnahme auf den sozialdemokratischen Polizeipräsidenten von Berlin, der 1929 die Mai-Demonstration in seiner Stadt hatte zusammenschießen lassen. Die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition (RGO) wurde von einer Strömung innerhalb des ADGB umgebaut zu einer kommunistischen Konkurrenzgewerkschaft. Dies und die Abkehr von den Mitgliedern der ADGB-Gewerkschaften führten mehr zur Isolation als dazu, sozialdemokratische Kollegen vom eigenen Programm zu überzeugen.
Auch die Widerstandskämpfe der Arbeitslosen hatten nicht den erhofften Erfolg gebracht. Pieck konstatiert ihr Abflauen um das Jahr 1932 herum. Die sabotierende Rolle der SPD-Führer war die eine Sache, eine andere aber war die Schwäche der KPD, wenn es darum ging, Erwerbslose ohne Ansehen der parteipolitischen Orientierung mit Forderungen zu mobilisieren, die unmittelbar an ihre Notlage anknüpften: Beschlagnahmung und Verteilung von Lebensmittelvorräten, Erhebung besonderer Kapitalsteuern, Konfiszierung stillgelegter Betriebe und so weiter. Dort, wo diese Forderungen erhoben wurden, geschah es vielfach ohne die nötige Energie und Ausdauer. Diese Kämpfe und auch Streikbewegungen waren vielfach spontan entstanden und brachten sozialdemokratische, kommunistische, christliche und parteilose Arbeiter zusammen. Aber es fehlte an organisatorischer Arbeit, um daraus eine dauerhafte proletarische Einheitsfront zu schmieden. Das kontraproduktive Wirken der Sozialdemokratie muss hier benannt werden, ist aber keine Entschuldigung für die Fehler auf kommunistischer Seite.
Kritisch blickt Pieck auch auf das Verhalten seiner Partei gegenüber der mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise sich entwickelnden Bauernbewegung. Besonders in Norddeutschland wehrten sich in Not geratene Landwirte gegen die Pfändung und Zwangsversteigerung ihrer Höfe. Rechte und faschistische Kräfte versuchten sich dabei ins Spiel zu bringen. Die KPD reagierte im Mai 1931 mit ihrem Bauernhilfsprogramm. Vereinzelt konnten damit Gruppen von Bauern aus dem Gefolge der Nazi-Partei herausgelöst werden, aber ein wirklicher Durchbruch auf dem Land gelang nicht. Pieck stellt fest, dass der Partei Kader fehlten, die in der Lage gewesen wären, in dieser Umgebung, die nicht zu ihren angestammten Hochburgen zählte, für die nötige Verankerung zu sorgen. Ähnliche Schwächen waren festzustellen im Kampf um die Sympathie des städtischen Kleinbürgertums, das ebenfalls von der Krise hart getroffen war und sich besonders anfällig dafür zeigte, dem demagogischen Geschrei der Nazis gegen die „Zinsknechtschaft“ Glauben zu schenken – wie auch anderen pseudosozialistischen Versatzstücken ihrer Propaganda. Pieck stellt dazu fest: „Unsere Aufgabe ist es, den Massen zu zeigen, dass im deutschen ‚Nationalsozialismus‘ kein Körnchen Sozialismus enthalten ist. Die faschistischen Demagogen suchen sich in die Toga von Volkstribunen zu hüllen, die die Belange der gesamten Nation wahren. Unsere Aufgabe ist es daher, sie als Agenten der mächtigen Truste der Kanonenkönige zu entlarven, den Massen aufzuzeigen, was hinter der Legende von der nationalen Einheit steckt, wie eine Handvoll Kapitalisten und faschistischer Führer sich auf Kosten des Volkes mästet.“
Dieses Zitat ist von brennender Aktualität, wenn auch mit einem Unterschied: Gegenwärtig hat Deutschland wieder eine Regierung, die sich den Interessen der „Kanonenkönige“ verpflichtet fühlt – nur dass diesmal keine Faschisten an ihr beteiligt sind. Das Kalkül der herrschenden Klasse lässt sie in dieser Rolle vorerst noch entbehrlich erscheinen. Zu schwach ist bisher die Gegenwehr von unten. Damit dies auch so bleibt, ist Leuten wie Björn Höcke die Aufgabe zugedacht, sich in die erwähnte „Toga des Volkstribuns“ zu hüllen, um so zur Desorientierung von Protestpotenzial beizutragen.
Es ist bemerkenswert, dass Pieck sich nicht zur Beschuldigung oder Beschimpfung derjenigen hinreißen lässt, die der Nazi-Propaganda Glauben schenken. Seine Orientierung basiert auf zwei als unabdingbar anerkannten Notwendigkeiten: zum einen der Frage nach den Fehlern der eigenen Partei – das heißt: gründliche Selbstkritik – und zum anderen der Pflicht zur „Verbindung mit den Massen“, die Pieck ein „Gesetz des Bolschewismus“ nennt. Eine aus Enttäuschung oder Verbitterung resultierende Massenfeindlichkeit ist keine Option. Pieck macht keinerlei Konzessionen an Angst oder Ablehnung gegenüber Menschen, die noch nicht für die Sache des Sozialismus gewonnen sind. Er kritisiert die „sektiererische Scheu“ seiner Genossen gegenüber Sozialdemokraten, die sich anschicken, in die Kommunistische Partei einzutreten. Stattdessen fragt er nach den Gründen für die hohe Mitgliederfluktuation der KPD und besteht darauf, dass mit neuen Mitgliedern intensiver im Sinn politisch-ideologischer Schulung gearbeitet wird. Für die Länder, in denen der Faschismus an der Macht ist – wie Deutschland und Italien –, stellt er die Forderung auf, dass die Kommunisten auch in den dortigen Pseudogewerkschaften wie der Deutschen Arbeitsfront aktiv werden, um so die herrschende Macht zu unterminieren.
Pieck betont die Notwendigkeit, einen klaren Begriff von dem zu entwickeln, was Faschismus eigentlich ist. Beliebigkeiten und das mechanisch-starre Auffassen getroffener Einschätzungen haben hier Schaden angerichtet. Er verweist darauf, dass die KPD bereits während der Weimarer Republik die Regierungen des Sozialdemokraten Hermann Müller (1928 bis 1930) und des Zentrumsmanns Heinrich Brüning (1930 bis 1932) als faschistisch qualifiziert hatte. Dies ging einher mit einer Unterschätzung der Nazi-Partei. Pieck folgert daraus: „Diese falschen Auffassungen vom Faschismus (…) führten dazu, dass die Kommunisten außerstande waren, rechtzeitig Losungen zur Verteidigung der Reste der bürgerlichen Demokratie vor dem zum Angriff übergehenden Faschismus herauszugeben und die Gegensätze innerhalb der Bourgeoisie auszunutzen.“ Es geht also darum, rechtzeitig zu erkennen, wann nicht mehr die Alternative „Kapitalismus oder Sozialismus?“ auf der Tagesordnung steht, sondern die Frage „Faschismus oder Reste bürgerlicher Freiheit?“ In jedem Fall geht es um eine nüchterne Analyse der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, um zu klären: Welche machtpolitische Option wird von der herrschenden Klasse favorisiert? Wie weit ist die Rechtsentwicklung fortgeschritten? Wer ist ihr hauptsächlicher Träger? Pieck merkt an, dass hier mit raschen Wechseln gerechnet werden muss, welche immer wieder die Überprüfung der bisherigen Strategie und Taktik verlangen.
Die Ausführungen von Pieck zum damaligen internationalen Kräfteverhältnis sind im Detail eher von historischem als aktuellem Interesse. Und dennoch erinnern sie in beklemmender Weise an die Verschärfung heutiger Konfliktlagen. So benennt Pieck die Errichtung von Zollschranken und die protektionistische Handelspolitik als Indikatoren für Krise und Kriegsgefahr. Er betont den untrennbaren Zusammenhang von Antifaschismus und Friedenskampf unter Einbeziehung der antikolonialen Bewegung, deren Bedeutung er an den Beispielen Indien und China hervorhebt. Es ist dieser organische Zusammenhang verschiedener Kampffelder, den Pieck anschaulich darzustellen weiß, den aber heute viele sich als „links“ verstehende Zeitgenossen nicht mehr zu sehen imstande sind. Die von Pieck hier als wesentlich benannten Eckpunkte verdienen es, auch endlich wieder in die heutige Debatte einzufließen.
Im Sommer 2020 veröffentlichte die KAZ eine Broschüre (PDF), in der sich Richard Corell mit rechten und linken Verfälschungen des VII. Weltkongresses beschäftigt.