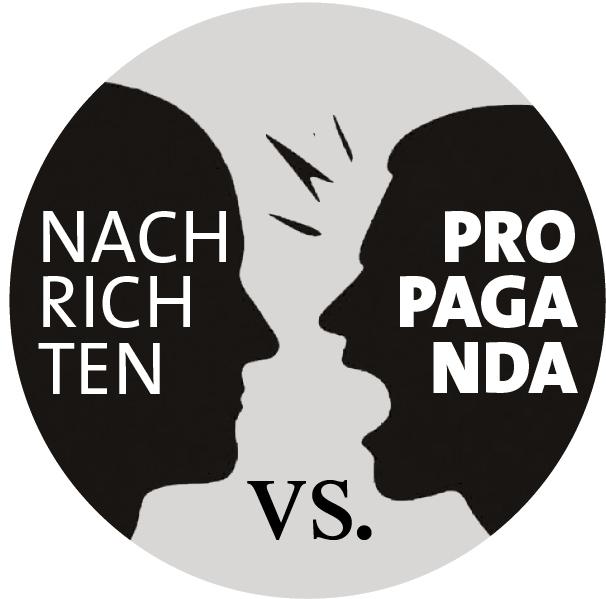Zugegeben: Fußball begeistert nicht alle, und wer sich nicht für ihn interessiert, kann schwer davor fliehen. „König Fußball“, wie ihn die bundesdeutsche Herrenauswahl im Vorfeld ihrer Heimweltmeisterschaft 1974 Fremdscham weckend besang, ist omnipräsent: Im Sommer auf den Parkwiesen genauso wie in den lokalpolitischen Debatten darum, ob Städte den Bau neuer Stadien befördern. Ob man sich dafür interessiert oder nicht, bekommt man Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit mit, ob der hiesige Verein mal wieder Murks gespielt hat. Entsprechend ist die Stimmung.
Entsprechend aber auch die Mobilisierung: Laut Veranstalter waren es rund 20.000 aktive und organisierte Fans, die an einem spielfreien Wochenende Mitte November durch die Leipziger Innenstadt liefen. Fragt sich, wer außerhalb des Fußballs hierzulande so etwas auf die Beine stellen kann: Mit nur einer Woche Vorlauf hatte das Netzwerk „Fanszenen Deutschlands“ bundesweit dazu aufgerufen, unter dem Motto „Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus – Ja zur Fankultur!“ gegen verschärfte Repression im und vor dem Stadion zu demonstrieren. Die Bedrohung ist konkret: Die Innenministerkonferenz bereitet für Anfang Dezember weitere Schikanen vor, darunter Gesichtserkennungstechnik und Stadionverbote auf Verdacht.
Raphael Molter und Lara Schauland zeigen mit ihrem Buch „Matchplan Meuterei“ auf, wie sich der Sport als Spielball der Besitzenden und Herrschenden zeigt, aber auch, welche Potenziale der Gegenwehr zu finden sind. Am Anfang war das Kuddelmuddel: Der florentinische Calcio Storico als ein Vorläufer des heutigen Fußballs war ein regelloses Kampeln der ganzen Stadt aus dem 15. Jahrhundert – durchaus auch mit Todesfolge. „Es waren vor allem die beherrschten Klassen“, die ihn spielten: „Bauern und Gesellen, aber auch Mägde“. Um die Kontrolle nicht zu verlieren und den Subalternen etwas der sich vielleicht ja auch nach oben richtenden Gewalttätigkeit abzugewöhnen, wurde der Fußball in England reglementiert und institutionalisiert: Fußball wurde Mitte des 18. Jahrhunderts zum Sport der Reichen auf den Privatschulen. 1863 wurde der noch heute existierende Verband „Football Association“ gegründet, der eine staatliche Kontrolle des Spielbetriebs ermöglichte.
Molter und Schauland zeigen anhand historischer und zeitgenössischer Beispiele Wege auf, sich gegen den ideellen Gesamtkapitalisten zu wehren: Als Rotsport der KPD in der Weimarer Republik oder indem sich Kickerinnen abseits der großen Öffentlichkeit ihren eigenen Spielbetrieb aufbauten, nachdem der seit je wenig für Fortschritt stehende Deutsche Fußball-Bund in den 1950ern den Frauenfußball in der BRD untersagte. Auch auf die systemische Alternative geht das Autorenduo mit der DDR und ihren Betriebssportgruppen ein. Aktuellere Beispiele von „Kommerz und Widerstand“, wie es im Untertitel des Buchs heißt, verweisen darauf, was Organisierungen im und vor dem Stadion erwirken können und was nicht: Um einen Investoreneinstieg bei der Deutschen Fußball-Liga zu verhindern, wurden bundesweit Profiligaspiele von den Kurven her unterbrochen; Tennisbälle flogen zu Hunderten auf den Rasen, ferngesteuerte Autos flitzten über das Spielfeld. Der Deal, der, wie etwa die britische Premier League zeigt, Fan-unfreundliche Anstoßzeiten für höhere TV-Geldeinnahmen zur Folge gehabt hätte, kam dadurch nicht zustande. Überhaupt erst angeleiert wurde der Ausverkauf durch eine Missachtung der 50-plus-1-Regel, wonach einzelne Anleger nicht die Mehrheit eines Vereins besitzen und diesen entsprechend diktieren dürfen: Martin Kind sprach sich, entgegen der Weisung von Hannover 96, als dessen Vereinsvertreter für den Investoreneinstieg aus. Das Kapital befolgt nur die Regeln, die ihm nützen. Es foult sonst gern und ungestraft.
Auch der Fall des 2024 verstorbenen Kay Bernstein zeigt auf, dass es Spielräume im kapitalistischen Betrieb gibt, die systemisch begrenzt sind: Mit Bernstein wurde 2022 einer Präsident von Hertha BSC, der einst als Vorsänger in der Kurve stand. Ein Ultra, der die Springer-Presse geifern ließ, den Verein aber den Marktregeln nach vor dem Ruin rettete: „Bernstein war als Unternehmer kein Fundamentalkritiker, das war den allermeisten von Beginn an klar“, schreiben Molter und Schauland. Bernstein handelte stattdessen in „sozialdemokratischer Manier“ und repräsentierte damit eine „gewisse Kommerzkritik“, die unter Fußballfans vorherrscht.
Dass ein Bernstein überhaupt möglich ist, liegt am kulturellen und Erlebniswert des Fußballs: „Der europäische Fußball unterläuft insofern den kapitalistischen Verwertungszwang, da für das Kapital kein relevanter Mehrwert produziert wird.“ Durch Reinheit verunreinigte Lehre wäre es, die Kämpfe, die, wie Molter und Schauland nicht müde werden zu erwähnen, primär symbolische sind, außen vor zu lassen. Fans verschiedener eigentlich verfeindeter Istanbuler Vereine, die die Proteste auf dem Taksim-Platz schützten, mögen ein Schlaglicht sein auf die Möglichkeit, Kämpfe zu verbinden und gegenseitig aus Erfahrungen zu lernen. Dazu braucht es jedoch eine politische Vermittlung, die vermittelt, wo die Verbindungen liegen zwischen steigenden Ticketpreisen und sinkenden Reallöhnen, zwischen dem Knüppel, der auf den Kopf der Demonstrantin saust, und dem Reizgas, das der Ultra am Zaun abbekommt. Sonst kippt die Stimmung und die Kurve bekommt mit Kapital und Staat selbst Fans; man denke da etwa an nicht seltene antimigrantische Blockfahnen in manchen Stadien Europas.
Wenn es auch der darin enthaltenen Imperialismusdefinition an Präzision mangelt und der Versuch gegen Ende, Walter Benjamin in die Argumentation einzubringen, einer tiefergehenden Ausführung bedurft hätte: Raphael Molter und Lara Schauland haben mit „Matchplan Meuterei“ einen lobenswerten Überblick über die fortschrittlichen Potenziale der Fußballkultur von unten geliefert.
Raphael Molter, Lara Schauland
Matchplan Meuterei
Fußballfans zwischen Kommerz und Widerstand
PapyRossa-Verlag, 212 Seiten, 17,90 Euro
Erhältlich unter uzshop.de