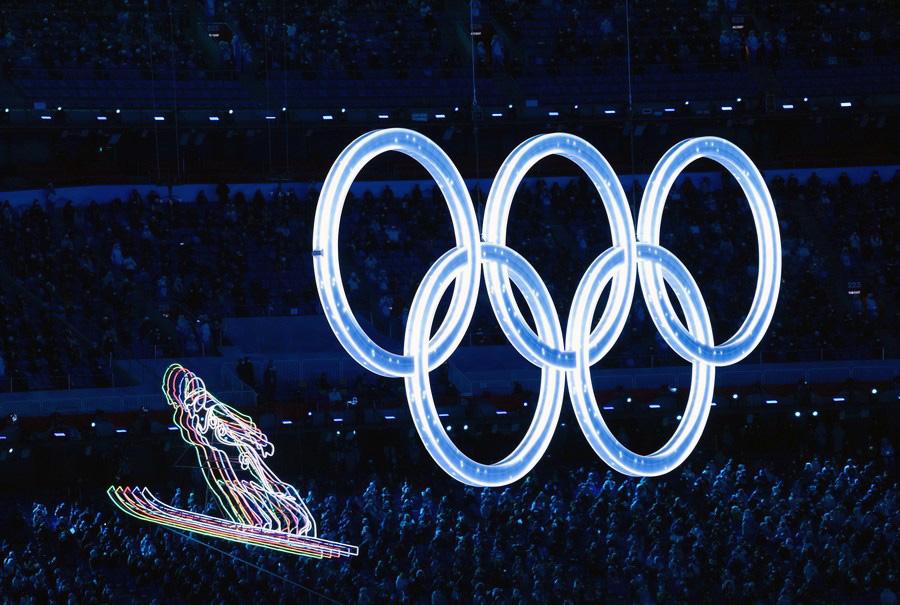Menschen gruseln sich gern. Das beweist nicht nur der Erfolg von Autoren wie Stephen King („Carrie“, „Es“, „Friedhof der Kuscheltiere“ und zahlreiche weitere – King ist einer der kommerziell erfolgreichsten Autoren der Gegenwart) oder Filmregisseuren wie John Carpenter (gefühlt unzählige Teile von „Halloween“, „The Fog – Nebel des Grauens“ und vieles mehr). Schon frühe Erzählungen der Menschheit kennen Geschichten über den personifizierten Tod, über Sterben auf fiese Art, über Werwölfe, Dämonen, Hexen und all die Gestalten, die neben Zombies und Serienmördern zur Stammbesetzung des modernen Horrors gehören.
Auch bei den alten Griechen waren Texte, die man heute zum Horror-Genre zählen würde, verbreitet. Euripides schrieb über die Wiederbelebung von Toten, und durch Plutarchs „Parallelbiografien“ geistert ein ermordeter Mörder. Und so zog sich das Ganze über die Jahrhunderte, wurde ausgefeilt als Teil der Romantik und der Gothic-Literatur, um im 19. Jahrhundert zum Genre zu erblühen. Da schrieb Mary Shelley ihren „Frankenstein“, bei dem man sich vielleicht gar nicht mehr so über die Kreatur gruselt, sondern über das, wozu Menschen fähig sind. Robert Louis Stevenson schenkte den Lesern die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde und Bram Stoker schockte mit dem Blutsauger „Dracula“.
Charakteristisch für den Horror ist, dass er in der realen Welt spielt – und es (anders als in anderen Unterarten der Phantastik) keinerlei Legitimation für noch die brutalste Gewalt braucht.
Und so sitzt der moderne Mensch dann gern nach Einbruch der Dunkelheit auf dem heimischen Sofa, Knabbereien neben sich, die Decke bis kurz unter die Augen gezogen, um stets bereit zu sein, die Sehorgane vor dem schlimmsten Schrecken zu beschützen, und gruselt sich, dass es eine Wonne ist. Immer schön nah an den Urängsten, immer schön nah an der Realität.
Doch manchmal überfällt einen das Horror-Genre-Gefühl mitten im Alltag. Wenn einem bewusst wird, wie sehr Teile der herrschenden Klasse einen Atomkrieg in Kauf nehmen, zum Beispiel. Oder welche Pläne hinter dem stehen, was einem wie die pure Absurdität eines Clowns in der Politik vorkommt (wobei Clowns auch im Horror-Geschäft eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen). Wenn man also zum Beispiel einen Podcast hört. Über Peter Thiel.
Der Deutschlandfunk begibt sich in seinem sechsteiligen Podcast „Die Peter Thiel Story“ auf die Spuren des deutschstämmigen Unternehmers aus dem Silicon Valley. Er ist einer der „Tech Bros“, mit denen Trump sich umgibt (oder die Trump umgeben), wie Elon Musk, nur mit deutlicherer Agenda. Er steckt hinter dem Bezahlsystem Paypal genauso wie hinter der Überwachungssoftware „Palantir“ (siehe UZ vom 8. August). Er ist ein „Contrarian“, also ein ewig Andersdenkender, egal, ob es um Investitionen oder Politik geht. Er ist ein Libertärer, ein Frauenfeind. Er hält Demokratie in jeglicher Form für überflüssig, ist ein Staatsfeind im wahrsten Sinne des Wortes, denn wer einen Staat hat, braucht auch Steuern, und die will Thiel nicht zahlen. Er ist beeinflusst von Ayn Rand und Carl Schmitt. Und wer sich gefragt hat, woher Trump die absurde Truppe hat, die seine Regierung darstellt: Peter Thiel hatte für Trumps erste Amtszeit vorgeschlagen, konträr vorzugehen: ein Wissenschaftsfeind fürs Bildungsministerium zum Beispiel. Damals wurde er belächelt. Heute sind seine Vorschläge Realität. Und Thiel steckt mit anderen hinter „Hallow“, der katholischen Gebets-App. Er argumentiert mit Begriffen wie „Satan“ und „Apokalypse“, und, wie man im Podcast von einem mit ihm befreundeten Theologen erfährt, er glaubt auch daran. Satan, so Thiel, sind die, die heute Frieden versprechen.
Gruselig. Anders kann man es nicht nennen. Aber wenigstens bleibt es im Moment noch lange hell.
Die Peter Thiel Story
Deutschlandfunk-Podcast mit 6 Folgen
Von Jasmin Körber, Fritz Espenlaub, Klaus Uhrig und Christian Schiffer
Abrufbar auf deutschlandfunk.de