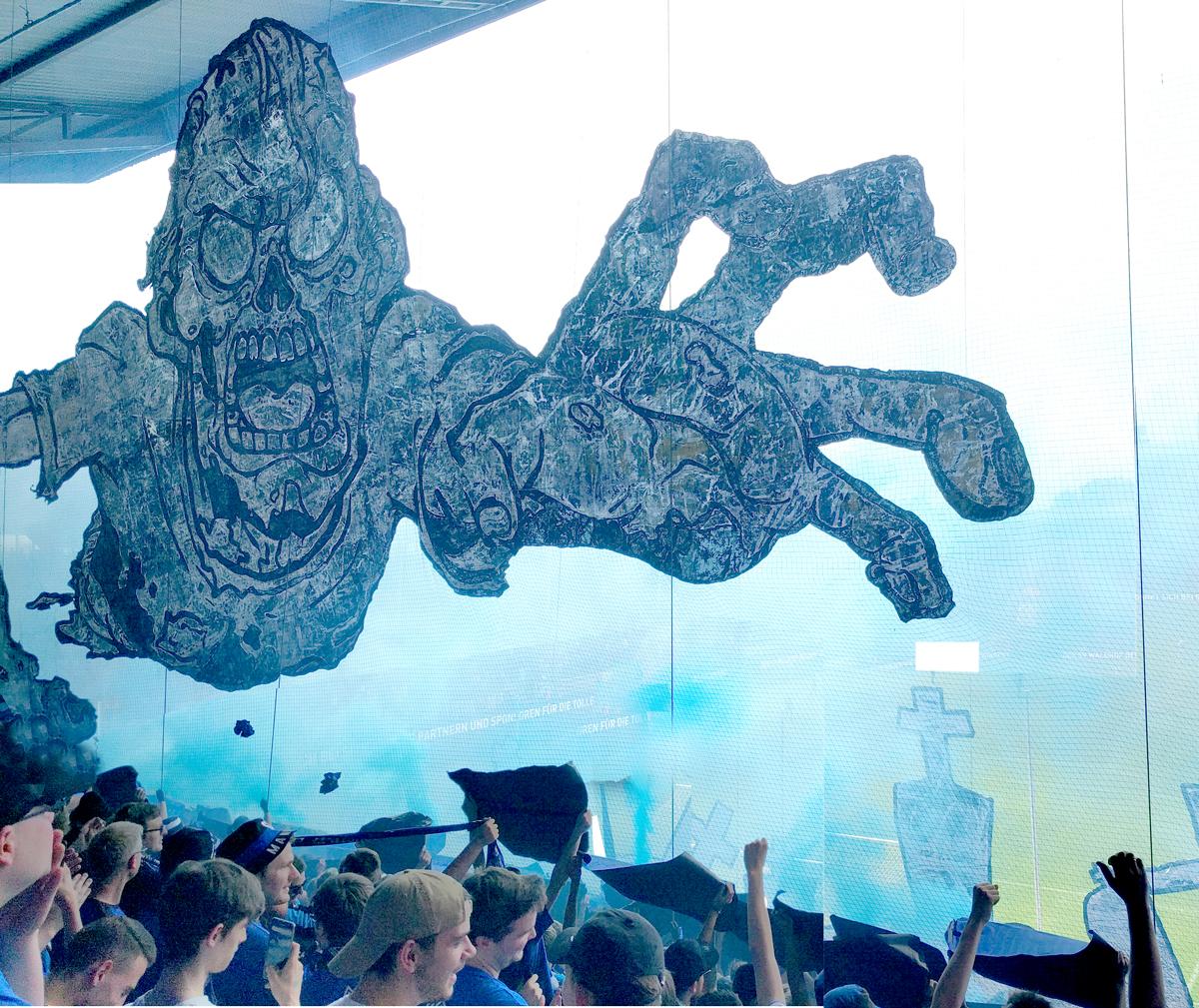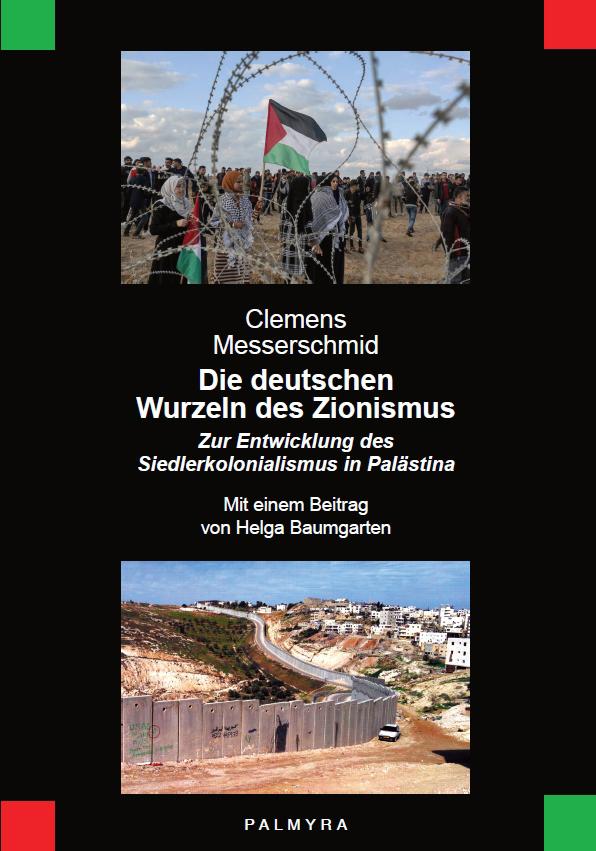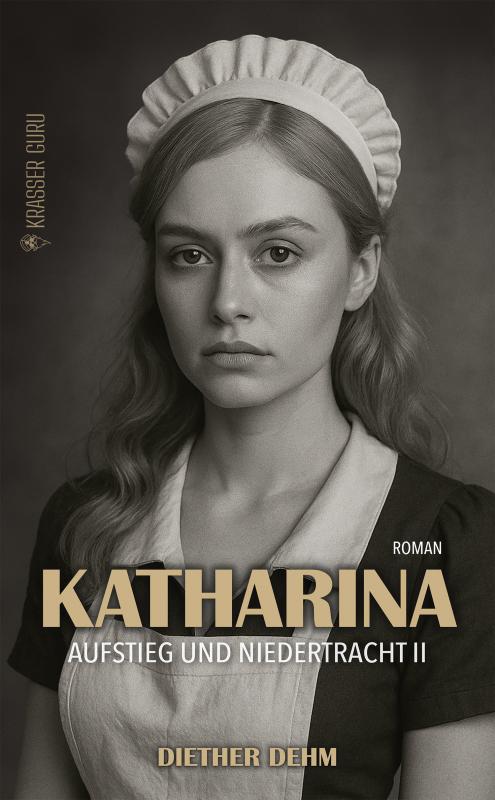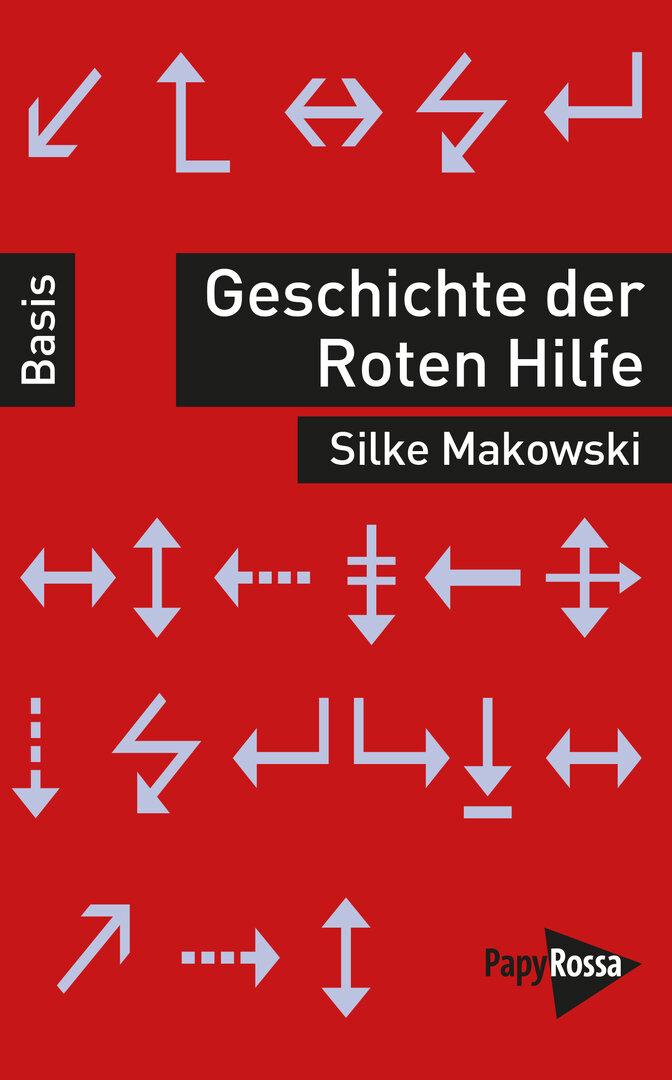Auf dem 26. Parteitag der DKP, die im Juni stattfand, wurden Differenzen in der Analyse des Imperialismus deutlich. Sie beziehen sich auf die Anwendung unserer wissenschaftlichen Weltanschauung auf die widersprüchlichen Veränderungen der Welt. Sie kommen damit im Ergebnis auch zu einer unterschiedlichen Bewertung des internationalen Klassenkampfes. Im Mittelpunkt dabei steht die Einschätzung und Bedeutung der Herausbildung einer multipolaren Welt für die fortschrittlichen Kräfte. Wir dokumentieren in dieser Ausgabe von UZ vier Diskussionsbeiträge, die geeignet sind, Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu erkennen und die Debatte damit nachvollziehen zu können. Eine Debatte zu dem Thema ist in der UZ nicht vorgesehen. Der Parteivorstand der DKP wird sich auf einer seiner nächsten Sitzungen mit der Auswertung und Fortführung der Debatte beschäftigen.
Das Referat des Parteitages sowie die Leitgedanken, auf die sich Beiträge beziehen, sind hier zu finden.
Zur Bedeutung des antikolonialen Kampfes • Von Renate Koppe, DKP Bonn
Im Kampf gegen den Imperialismus ist die Überwindung der neokolonialen Ausbeutung ein zentrales Element. Lenin sagte beim II. Kongress der Komintern im Sommer 1920 zu verschiedenen Formen des Kolonialismus: „Was ist der wichtigste, der grundlegende Gedanke unserer Thesen? Die Unterscheidung zwischen unterdrückten und unterdrückenden Völkern. (…) In der Epoche des Imperialismus ist es (…) besonders wichtig, die konkreten wirtschaftlichen Tatsachen festzustellen und bei der Lösung aller kolonialen und nationalen Fragen nicht von abstrakten Leitsätzen, sondern von den Erscheinungen der konkreten Wirklichkeit auszugehen.
Das charakteristische Merkmal des Imperialismus besteht darin, dass sich, wie wir sehen, gegenwärtig die ganze Welt in eine große Zahl unterdrückter Völker und eine verschwindende Zahl unterdrückender Völker teilt, die über kolossale Reichtümer und gewaltige militärische Kräfte verfügen. Die große Mehrheit der Bevölkerung unseres Erdballs (…) gehört zu den unterdrückten Völkern, die sich entweder in direkter kolonialer Abhängigkeit befinden oder halbkoloniale Staaten sind, wie zum Beispiel Persien, die Türkei, China, oder aber von der Armee einer imperialistischen Großmacht besiegt worden und auf Grund von Friedensverträgen in starke Abhängigkeit von ihr geraten sind.“

Zu diesem Zeitpunkt war weit über die Hälfte der Erde von wenigen imperialistischen Großmächten kolonisiert. Auch 1945 lebte noch fast ein Drittel der Weltbevölkerung in Kolonien, heute gibt es nur noch 17 kolonialisierte Territorien. Die übrigen Kolonien haben inzwischen ihre – zumindest formale – staatliche Unabhängigkeit erkämpft. Wir sehen aber, dass bereits Lenin sich mit dem befasste, was wir heute Neokolonialismus nennen.
Auch heute sprechen Zahlen und Fakten dafür, dass immer noch eine kleine Zahl von imperialistischen Räubern neben der Arbeiterklasse in den imperialistischen Ländern auch eine große Zahl unterdrückter Völker ausbeutet. Seit den 1960er Jahren gibt es in diesem Zusammenhang den Begriff des nicht äquivalenten Austausches. Es gibt Untersuchungen, dass der Abfluss, der aus den abhängigen Ländern an die Hauptländer des Imperialismus durch nicht äquivalenten Tausch erfolgt, um ein Vielfaches größer ist als die Flüsse in die umgekehrte Richtung und bis zu einem Viertel des Bruttoinlandsprodukts dieser Länder ausmacht. Bei diesen Ländern, die von neokolonialen Verhältnissen profitieren, handelt es sich zum größten Teil um NATO-Länder und eben nicht um Länder wie Russland und China. Verstärkt wird dies durch die Währungspolitik, politischen und militärischen Druck und Sanktionen, wenn abhängige Länder beginnen, ihre nationale Souveränität durchzusetzen. Ein aktuelles Beispiel sind hier Länder in Westafrika wie Niger, Mali und Burkina Faso. Diese versuchen, sich von der ökonomischen Dominanz des Imperialismus – hier mit der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich an der Spitze – zu befreien. Dazu gehören nicht nur Nationalisierungen, sondern auch die Absage an die währungspolitische Dominanz durch Frankreich mithilfe des CFA-Franc. Ein weiteres Beispiel sind Venezuela und Nicaragua.
Dieser Kampf gegen die neokoloniale Abhängigkeit vom Imperialismus bedeutet erst einmal, überhaupt eine wirkliche nationale Souveränität zu erkämpfen – also nationale Befreiung. Das ist noch keine sozialistische Entwicklung, aber dieser Kampf verbessert – wenn er erfolgreich ist – die Bedingungen für den Klassenkampf fortschrittlicher Kräfte in diesen Ländern.
Für diesen Kampf gegen neokoloniale Abhängigkeit ist es von großer Bedeutung, dass es mit der Herausbildung einer multipolaren Welt und mit dem Erstarken des sozialistischen China sowie mit der BRICS-Kooperation und der engen Zusammenarbeit von Russland und China nun Alternativen zu den neokolonialen Wirtschaftsbeziehungen zum Imperialismus gibt. Dies ist – neben der Gewinnung billiger Rohstoffquellen – auch ein Grund, warum es dem Imperialismus heute darum geht, nicht nur den Sozialismus in China zu schwächen und perspektivisch zu vernichten, sondern Russland, das derzeit für den Erhalt seiner nationalen Souveränität kämpft, wieder zu einem neokolonial abhängigen Land zu machen und am besten in zahlreiche vom Imperialismus abhängige kleine Staaten aufzuteilen.
Warum ist es für uns heute wichtig, die Frage des antikolonialen Kampfes zu betonen?
In der Diskussion in der kommunistischen Weltbewegung gibt es die These, dass koloniale Abhängigkeiten – auch in Form des Neokolonialismus – heute praktisch keine Rolle mehr spielen. Der Begriff des Neokolonialismus an sich wird abgelehnt und die These vertreten, dass alle kapitalistischen Länder, auch die an der Peripherie und die ehemaligen Kolonien, heute als imperialistische Staaten auf unterschiedlichen Niveaus einer Pyramide anzusehen sind. Die globale Arbeiterklasse werde von der globalen Bourgeoisie ausgebeutet. Dies steht in engem Zusammenhang mit einer Imperialismusanalyse, die darauf beruht, dass die Existenz von Monopolen bereits einen imperialistischen Staat ausmacht. Dabei wird weder die politische Macht im Staat noch die Frage berücksichtigt, ob es sich um Monopole ausländischer imperialistischer Staaten handelt. Damit wird nicht nur die oben skizzierte strukturelle neokoloniale Abhängigkeit geleugnet, auch die Frage der nationalen Befreiung stellt sich im Rahmen dieser These nicht mehr – und dies wird auch explizit so formuliert. Nationale Befreiungsbewegungen können im Rahmen dieser These – von wenigen Ausnahmen abgesehen – keine fortschrittliche Funktion mehr haben. Auch der Kampf um die Durchsetzung einer multipolaren Weltordnung ist dann nur noch ein Kampf zwischen imperialistischen Blöcken. Dies ist natürlich von großer Bedeutung für die Einschätzung der internationalen Entwicklung und der internationalen Bündnispolitik. Mit der Durchsetzung einer multipolaren Weltordnung, mit der Sicherung und Durchsetzung der nationalen Souveränität vieler bisher neokolonial abhängiger oder von solcher Abhängigkeit bedrohter Staaten wird die Welt nicht gleich friedlicher, der Kampf gegen den Imperialismus und für den Sozialismus ist trotz der zunehmenden Rolle Chinas noch nicht gewonnen – aber ein Schritt in Richtung Niederlage des Imperialismus wird getan sein.
Für uns ist es meines Erachtens wichtig, auf einem klaren antiimperialistischen und antikolonialen Standpunkt zu bleiben. Konkret heißt das, immer wieder eine Tatsache deutlich zu machen: Der Imperialismus, sei es der US-Imperialismus, die NATO oder auch die EU unter Führung des deutschen Imperialismus, ist der Aggressor, sowohl militärisch also auch in Wirtschaftskriegen. Gegen ihn muss unser Kampf für Frieden und für den Sozialismus geführt werden.
Falsche Ableitungen, falsche Praxis • Von Philippe Drastik, DKP Trier
Im Rechenschaftsbericht des Parteivorstands heißt es: „Der Imperialismus spitzte die Angriffe auf China zu (…)“. Dies impliziert, dass es sich beim Imperialismus nicht um das – wie von Lenin definiert – „höchste Stadium“ des Kapitalismus handeln würde, sondern um „den Westen“, also die NATO und ihre Verbündeten. Dies ist ein Imperialismusverständnis, das ich für grundlegend falsch halte und sich meiner Meinung nach nicht in der Gesamtpartei durchsetzen sollte. Denn eine falsche theoretische Analyse führt zu falschem praktischen Handeln, weshalb ich hier auf diesen Fehler eingehen möchte.
Korrekterweise müsste es im PV-Bericht heißen: „Der westliche Imperialismus spitzte die Angriffe auf China zu (…)“. Ich halte die Einschätzung, dass es lediglich einen Imperialismus der USA und ihrer Verbündeten gibt, für falsch.
Aber unabhängig davon, ob man nun Länder wie Russland als imperialistisch einschätzt oder eben nicht, ergibt der Satz ohne die Ergänzung „westlichen“ keinen Sinn. Würde der Imperialismus als Ganzes zurückgedrängt werden, würde dies aus marxistischer Sicht einen der beiden folgenden Fälle bedeuten:
Die Welt entwickelt sich zurück zu einem kapitalistischen Stadium der freien Konkurrenz – wie vor dem Imperialismus.
Die Welt entwickelt sich weiter zum Sozialismus.

Ersteres können wir ohne Frage schnell als Unsinn entlarven. Es gibt kein Zurück in der Weltgeschichte und das Stadium des Imperialismus bereitet den Weg für den Sozialismus. Der Satz des PV suggeriert, dass wir schon in einem Stadium sind, in dem der Imperialismus an sich zurückgedrängt wird, was nur den Schluss übrig lässt, dass der sozialistische Aufbau bevorsteht.
Das halte ich für die falsche Schlussfolgerung. Es ist vielmehr so, dass in dem Status der multipolaren Weltordnung der westliche Imperialismus an Bedeutung verliert und andere kapitalistische Staaten anstreben werden, diesen Platz einzunehmen. Nur weil kapitalistische Staaten derzeit nicht im imperialistischen Stadium sind, heißt das nicht, dass sie dieses Stadium nicht anstreben, sofern sich die Möglichkeit für das jeweilige nationale Kapital ergibt.
Dass die Aufteilung der Welt abgeschlossen ist, wie Lenin sagte, ist nicht so zu verstehen, dass sich im imperialistischen Stadium des Kapitalismus die Machtverhältnisse nicht verändern können. Zu Lenins Lebzeiten gab es weniger imperialistische Länder, als es sie heute gibt. Die Machtverhältnisse haben sich deutlich verschoben – zuungunsten des britischen und zugunsten des US-amerikanischen Imperialismus. Der sich anbahnende Untergang des heute bedeutendsten imperialistischen Staates, der USA, sollte nicht zu dem Fehlschluss führen, der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus wäre am Beginn des Zusammenbruchs. Keiner der BRICS-Staaten ist ein sich im Sozialismus befindliches Land, lediglich China bezeichnet sich selbst als „in der Anfangsetappe des Sozialismus“ befindlich, auch wenn der PV das in seinem Rechenschaftsbericht anders sieht. Dort wird klar vom „sozialistischen China“ gesprochen – eine Einschätzung, die meiner Meinung nach auf dem unscharfen Imperialismusverständnis beruht. Wenn es „den Imperialismus“ lediglich durch „den Westen“ verkörpert gibt, dann sind in der Schlussfolgerung alle Länder, die einen Gegenspieler oder einen Ausgebeuteten des Westens darstellen, objektiv antiimperialistisch. Dann kommt man auch zu der Einschätzung, dass Russland in der Ukraine einen nationalen Befreiungskampf führt. Dem möchte ich widersprechen. Dass etwa China einen großen Teil kapitalistischer Marktelemente eingeführt hat und auch infrage gestellt wird, ob die Abschaffung von Privateigentum an Produktionsmitteln überhaupt noch notwendig sei, lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Entweder ist China noch nicht sozialistisch und wir können darüber streiten, ob es sich auf diesem Weg befindet, oder aber wir lassen unsere bisherige Sozialismusdefinition fallen. Auf dem Festival der Jugend resümierte Björn Blach, dass die Einschätzung, China befinde sich auf dem Weg zum Sozialismus, davon abhänge, ob man der KPCh glaube, dass sie eine echte kommunistische Partei ist oder eben nicht.
Diese Aussage ist wahr. Wir sollten als Kommunisten jedoch keine Debatten führen, indem wir Dinge glauben oder nicht glauben, sondern unsere Hypothesen mit Fakten belegen. Der Marxismus ist eine Wissenschaft und wenn uns die Vergangenheit und die Gegenwart eines gelehrt haben sollten, dann das, dass wir nicht einzelne Elemente aus diesem geschlossenen System herauspicken können, um unsere Thesen zu belegen. Zu oft führte diese Herangehensweise zu einem falschen Marxismusverständnis und zu falschen theoretischen Ableitungen, die eine falsche Praxis nach sich zogen. Das Hoffen darauf, dass es bei dem immer aggressiveren Agieren der niedergehenden imperialistischen Staaten einen Gegenpol gibt, der die Flamme des Sozialismus weiterträgt, und in einer Weltlage, die einen zunehmend negativ stimmen kann, eine Kraft existiert, die eine ähnlich positive Rolle für die Entwicklung der weltweiten Klassenkämpfe spielen kann wie früher die Sowjetunion, halte ich für nachvollziehbar.
Aber so sehr ich dieses Bedürfnis verstehen kann, halte ich es für trügerisch. Eine multipolare Weltordnung mag den ökonomischen Aufschwung des nationalen Kapitals bisher stärker ausgebeuteter Länder bedeuten und damit auch eine Verbesserung der Lebenssituation der Arbeiterklasse in den jeweiligen Staaten. Es bedeutet aber keinesfalls, dass die Epoche des Sozialismus eingeläutet wird beziehungsweise der Imperialismus an sich zurückgedrängt wird. Im Gegenteil kann es heißen, dass Länder, die bisher keine Chance auf imperialistische Machtansprüche hatten, diese nun geltend zu machen versuchen, was die Gefahr eines Weltkriegs nicht senkt, sondern erhöht. Die Zeiten mögen trübe sein und wir uns einen einfachen Ausweg, einen starken Gegenpol wünschen. Aber wenn dieser nicht existiert, dann müssen wir ihn eben selbst schaffen. Denn:
„Trotz Misstraun, Angst und alledem, es kommt dazu trotz alledem, dass sich die Furcht in Widerstand verwandeln wird trotz alledem!“
Konkret analysieren • Von Kurt Baumann, DKP Kassel
Eine Genossin unterstellte auf dem Parteitag die Position, die BRICS-Staaten als (objektiv) antiimperialistische Kraft zu verstehen bedeute, dass sie das sozialistische Lager unserer Zeit seien und wir uns auf ihren Erfolgen ausruhen und quasi in ihrem Windschatten zum Sozialismus segeln würden – sogar die Leitgedanken würden das behaupten. Zunächst einmal steht das so nicht in den Leitgedanken, sondern nur dann, wenn man es hineinlesen will. Das an sich ist schon kein sauberer Umgang mit den Dokumenten unserer Partei. Dann hat sich Patrik Köbele, der Vorsitzende der DKP, in einem der letzten PV-Referate von dieser vereinfachenden, einseitigen, undialektischen Formulierung abgegrenzt.
In der hessischen Vorbereitung des Parteitags wurde durch einen Frankfurter Genossen „der Imperialismus“ zum neuen Produktionsverhältnis, in den Anträgen spukt der Begriff des „Weltsystems“ herum, das weist auf die erste Differenz hin: Das marxistisch-leninistische Imperialismusverständnis geht nicht aus von den (notwendigen) Abstraktionen, sondern wurde von Lenin sehr konkret mit der Analyse der ökonomischen Basis begonnen –konkret: mit dem Monopol. Die Entwicklung von kleineren Kapitaleinheiten zu Monopolen setzt die Anhäufung immer größerer Mengen fixen Kapitals voraus, um immer auf dem neuesten technischen Stand der Produktivkraftentwicklung und in der entsprechenden Menge zu entsprechenden Preisen produzieren zu können. Für diese Schritte in der Vergesellschaftung der Arbeit ist der inländische Monopolprofit nicht ausreichend und daher Kapitalexport notwendig.

Wird dieser Kapitalexport verhindert, werden Märkte geschlossen, werden Währungstricks und weiteres angewandt – kurz: die Welt aufgeteilt. Nach Lenin ist das eines der notwendigen Kriterien des imperialistischen Stadiums des Kapitalismus. Eine Neuaufteilung kann sich nur auf politischem Gebiet vollziehen: Die Märkte müssen gewaltsam geöffnet werden. Geschieht das nicht, können sich kleinere Kapitale nicht zu Monopolen entwickeln, sie verlieren ihre Stellung. Die erste Differenz ist also eine methodische: Wir sollten bei der Theoriebildung vom ökonomischen Wesen und gleichzeitig von etwas ausgehen, das wir empirisch überprüfen können.
Gehen wir weiter: Ist die Entwicklung hin zu einem Staat der Monopole – einem imperialistischen Staat – von den internationalen Verhältnissen abhängig, so ist die Bildung kapitalistischer Nationalstaaten, die keine imperialistischen werden können, eine Notwendigkeit. Die Ergebnisse der zweiten Phase der Entkolonialisierung, etwa die Antwort der antiimperialistischen Kräfte darauf in der Konferenz von Bandung mit der Bildung der Bewegung der Blockfreien, stehen hier als historischer Beweis.
Die Differenz an dieser Stelle ist wieder eine methodische: In der Analyse müssen wir – wie Lenin sie fordert – die Einheit von Ökonomie und Politik anwenden. Ökonomie und Politik als Einheit zu sehen bedeutet, nicht einseitig vom ökonomischen Wollen auszugehen, sondern die Fähigkeit und die objektive Notwendigkeit der Entwicklung eines Landes hin zum Imperialismus mit in Betracht zu ziehen. Einen nationalen Befreiungskampf – der immer seinerseits eine ökonomische Basis hat, nämlich den Kampf der nationalen Bourgeoisie und der Volksmassen um eine eigenständige, nationale produktive Basis der Produktion und der Versorgung der Bevölkerung – gilt es für uns als Ausbrechen zu unterstützen. Wer hier nur Bestandteile des Weltsystems Imperialismus sieht, ignoriert den konkreten Kampf wegen der abstrakten Empirie.
Aus dem oben geschilderten notwendigen Nebeneinander von kapitalistischen und imperialistischen Staaten, aus der Ungleichzeitigkeit der technischen Entwicklungen und der Umsetzung dieser in Produktivkräfte, aus dem inneren Kampf zwischen den Kapitalfraktionen und dem Klassenkampf sowie aus der Krisenhaftigkeit des Kapitalismus ergibt sich das Gesetz der ungleichmäßigen Entwicklung des Kapitalismus. Dieses Gesetz negiert, wer davon spricht, dass es keine kapitalistischen Staaten gebe, die nicht imperialistisch seien.
Für die weitere Diskussion sollten wir von folgenden Punkten ausgehen:
- Der Kern unseres Imperialismusverständnisses sollte das Monopol sein und die Analyse vor allem der deutschen Monopole immer wieder auch die Rückbindung an die Empirie leisten. Die zunehmende Vergesellschaftung der Produktion, Konzen-tration und Zentralisation des Kapitals und die Rolle der Monopole sind der Kern, der notwendige Ausgangspunkt, nicht abstrakte Monopole.
- Die Monopole verschmelzen mit dem Staat, der staatsmonopolistische Kapitalismus entsteht und parallel dazu – und nur, insofern das passiert – auch die heute weitverbreitete neokoloniale Form der imperialistischen Unterdrückung.
- Monopole können sich nur durch Kapitalexport in der internationalen Konkurrenz durchsetzen. Gelingt das nicht, bleiben sie Kapitale, die Länder kapitalistisch, sind eine weitere Vergesellschaftung der Produktion und eine weitere Steigerung der Produktivkräfte nicht möglich. Was dabei ein einzelner Kapitalist anstrebt oder auch nicht, ist unerheblich – es geht um objektive Gesetzmäßigkeiten und wie sie sich durchsetzen.
- Nur diejenigen Staaten, die dazu fähig sind, diese Gesetzmäßigkeiten zu unterdrücken, die Entwicklung von Staaten zu unterbinden, indem Kapitalexport und teilweise die innere Entwicklung unmöglich gemacht werden, können sinnvollerweise als Teil des „Weltsystems Imperialismus“ oder als „der Imperialismus“ verstanden werden. Die NATO-Staaten sind damit die Materialisierung des Imperialismus.
- In den notwendigerweise entstehenden kapitalistischen, aber nicht-imperialistischen Staaten wird der Kampf zwischen der nationalen und der Kompradorenbourgeoisie geführt. Die nationale Bourgeoisie ist mitunter der zentrale Bündnispartner der Arbeiterklasse im nationalen Befreiungskampf. Die nationalen Befreiungsbewegungen derzeit brauchen die Unterstützung der Arbeiterklasse in den imperialistischen Ländern. Hier sehe ich unsere internationalistische Verpflichtung in Übereinstimmung mit der Mehrheit der kommunistischen Parteien in aller Welt.
Zum Hegemonieverlust des Imperialismus • Von Andrea Hornung, DKP Frankfurt am Main
Im ersten Leitgedanken wird festgestellt: „Dem US-geführten Imperialismus droht ein ökonomischer und politischer Hegemonieverlust.“ Hier ist nicht gemeint: Der von den USA geführte imperialistische Block verliert seine Vormachtstellung an einen anderen imperialistischen Block. Gemeint ist: Der Imperialismus, der als Ganzes von den USA geführt wird, verliert seine Vormachtstellung. Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele hat das zum Beispiel im Referat für die PV-Tagung im Februar deutlich gemacht: Es gehe um den „Hegemonieverlust des Imperialismus in seiner Gesamtheit“.
Wenn man diese Formel vom Hegemonieverlust des Imperialismus zu Ende denkt, steht sie im Widerspruch zu einer leninistischen Auffassung vom Imperialismus.
Wir wissen: Der Imperialismus ist gekennzeichnet von Aggressivität, Gewaltpolitik und kolonialer beziehungsweise neokolonialer Unterdrückung. Diese Aggressivität entsteht nicht einfach durch Entscheidungen der imperialistischen Regierungen, sie entsteht aus der Entwicklung des Kapitalismus selbst. Weil die kapitalistische Wirtschaft ab einem bestimmten Entwicklungsstand der Zentralisation und Konzentration zu dieser neuen Art von Aggressivität drängt, nennt Lenin den Imperialismus das höchste Stadium des Kapitalismus.

In den entwickelten kapitalistischen Ländern war das Monopol zum prägenden Produktionsverhältnis geworden, die Monopole beherrschen die Zentren und durchdringen die abhängigen Länder. Letztlich ist die Monopolisierung die Ursache für die Widersprüche zwischen den Großmächten und zwischen Großmächten und unterdrückten Ländern.
Das bedeutet auch: In unserer Epoche gibt es keinen nicht-imperialistischen Kapitalismus – was es natürlich geben kann, sind kurze, instabile Übergangsphasen –, der Imperialismus ist der Kapitalismus unserer Zeit. Vor diesem Hintergrund ergibt es wenig Sinn, von einer Hegemonie „des Imperialismus“ zu sprechen (es würde dasselbe bedeuten wie „Hegemonie des Monopolkapitalismus“) – einzelne Staaten können hegemonial sein, aber dort, wo kapitalistische Produktionsverhältnisse vorherrschen, sind sie Teil des imperialistisch gewordenen Kapitalismus.
Denn die Verhältnisse des Monopolkapitalismus durchdringen das gesamte Leben der Länder, in denen das Kapital die Macht hat, der Zentren wie der abhängigen Länder – mit den bekannten Folgen für die Unterdrückten. Natürlich kann es innerhalb des Imperialismus Fortschritte und positive Entwicklungen geben – wie aktuell in Westafrika oder in erfolgreichen Reformkämpfen hierzulande –, die für unsere Kampfbedingungen nicht zu unterschätzen sind. Aber es ändert erstmal nichts an den Produktionsverhältnissen.
Die Hegemonie des Imperialismus zu überwinden bedeutet, die Produktionsverhältnisse des Kapitalismus zu überwinden, sie durch andere Produktionsverhältnisse zu ersetzen – und das ist nur denkbar durch die Weiterentwicklung des Monopols zu gesellschaftlichem Eigentum, durch die Überwindung des mit den Monopolen verflochtenen Staates, durch den Übergang zum Sozialismus. Lenin nennt den Imperialismus den Vorabend der sozialistischen Revolution, weil die Verhältnisse zum Sozialismus drängen – also die Widersprüche des Kapitalismus, die sich bis zum Weltkrieg zuspitzen können, nur durch den Sozialismus gelöst werden können.
Gerade davon lenkt die Formel vom Hegemonieverlust des Imperialismus ab. Die Leitgedanken gehen davon aus, dass eine multipolare Weltordnung entsteht, in der kapitalistische und (angeblich) sozialistische Länder friedlich und freundlich miteinander kooperieren. Sie setzen die Verschiebungen im imperialistischen Weltsystem, die wir beobachten, mit einem Ende dieses Weltsystems gleich. In dieser Vorstellung einer multipolaren Weltordnung würde es mächtige kapitalistische Länder geben, die nicht imperialistisch sind. Dabei bleibt unklar: Wirken in den BRICS-Ländern nicht dieselben Gesetze der Monopolbildung wie in den alten imperialistischen Zentren? Oder: Wieso wirkt sich die Monopolbildung in den BRICS-Staaten weniger zerstörerisch aus?
Diese Vorstellung einer multipolaren Weltordnung führt – konsequent verfolgt – zu der Auffassung, dass es doch von der Entscheidung der jeweiligen Regierung abhängt, ob ein Land imperialistisch ist oder nicht. Die Parteiführung vertritt diese Position nicht – aber die Imperialismusanalyse der Leitgedanken läuft, zu Ende gedacht, darauf hinaus.
Wie wir den Imperialismus analysieren, wirkt sich darauf aus, welche Strategie wir für unsere Partei für richtig halten. Im Leitgedanken 10 wird zur strategischen Perspektive betont, dass Veränderungen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft möglich seien. In diesem Rahmen sei eine „Umkehr“ des „verheerenden Kurses“ möglich. Es sei möglich, die „Politikausrichtung“ Deutschlands so zu verändern, dass es „zu einer konstruktiven Mitarbeit an der Neugestaltung der internationalen Beziehungen“ übergehe. Es gebe also bestimmte Bedingungen, unter denen das kapitalistische Deutschland nicht mehr imperialistisch handelt. So wird der Eindruck erweckt, es sei nicht nötig, die Macht der Monopole zu brechen, damit dieser Staat nicht mehr imperialistisch agiert und konstruktiv mitarbeitet. Auch Patrik Köbele hat im Parteitagsreferat gesagt, dass man dem deutschen Imperialismus eine neue Entwicklungsrichtung im Interesse der Menschen geben könne. Das ist aber im Imperialismus nicht möglich.
Diese praktische Konsequenz ergibt sich aus der Formel vom Hegemonieverlust: Wenn es in einer multipolaren Weltordnung kooperative Beziehungen auch zwischen kapitalistischen Großmächten geben kann, dann wollen wir natürlich, dass Deutschland dabei mitmacht. Leitgedanke 10 zeigt, was im Leitgedanken 1 angelegt ist:
Die Vorstellung,
- dass die schärfsten Widersprüche unserer Gesellschaft im Rahmen des Kapitalismus mindestens deutlich abgeschwächt werden können;
- dass unter den Bedingungen monopolkapitalistischer Konkurrenz ein friedliches Zusammenleben der Staaten möglich wäre;
- dass wir unsere Hoffnungen auf ein Bündnis aufstrebender kapitalistischer Staaten setzen sollten;
- dass wir in unserer politischen Praxis anstreben, neue Parteien- und Regierungskonstellationen zu ermöglichen, die dann (unter kapitalistischen Bedingungen!) ihrerseits so etwas wie eine nicht-imperialistische Politik machen könnten;
- dass der deutsche Imperialismus auf die Interessen des Monopolkapitals verzichten und im Interesse der Menschen handeln könne.
Das ist illusionär und falsch. Stattdessen ist der einzige Garant für Frieden eine starke Friedens- und Arbeiterbewegung – und die Überwindung der Hegemonie des Imperialismus erfordert die Überwindung des Kapitalismus, dessen höchstes Stadium eben der Imperialismus ist.