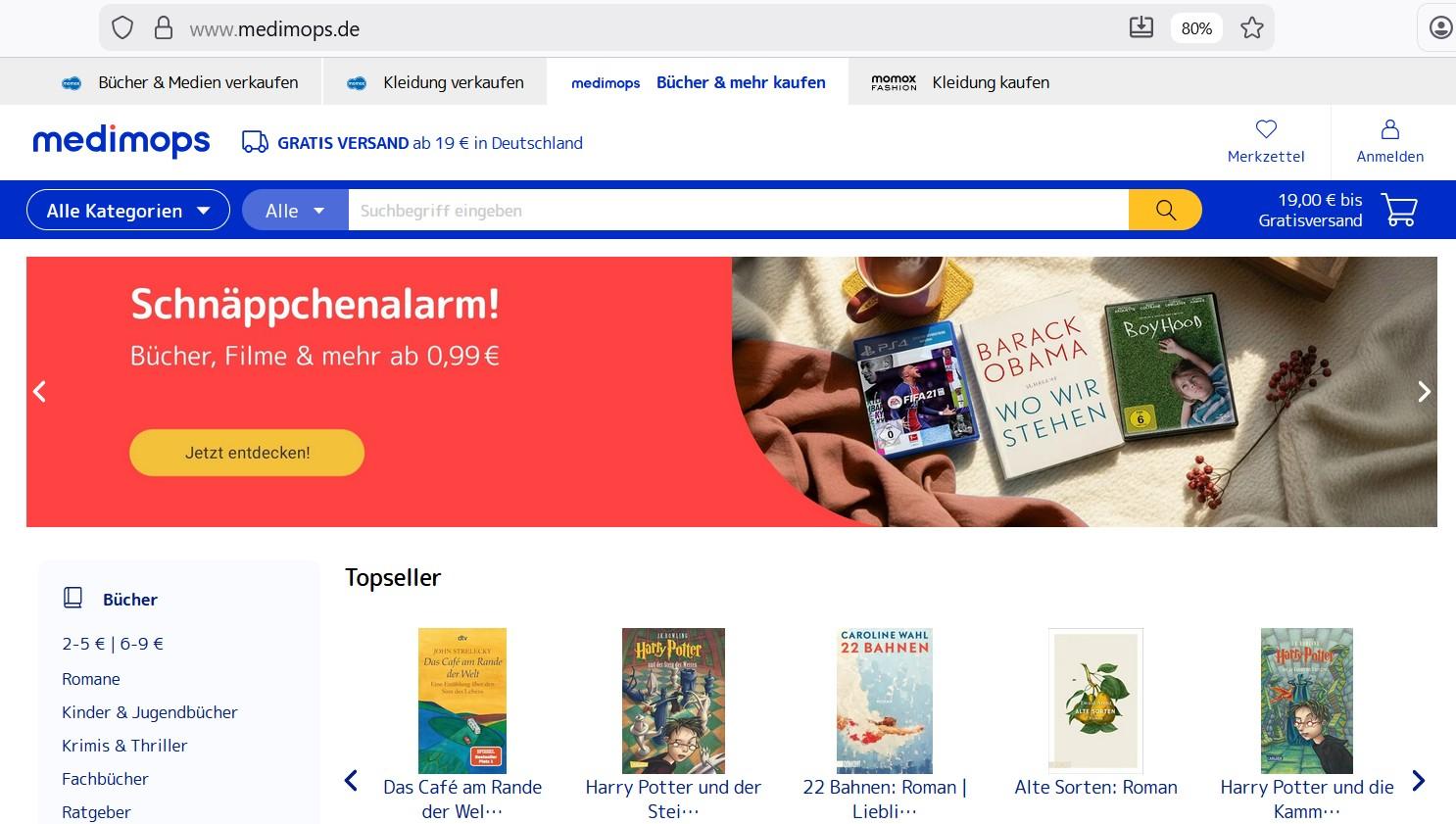Sowohl bei den Automobilkonzernen als auch bei ihren Zulieferern ist es immer das gleiche Schema: Sogenannte Zukunftsvereinbarungen, Sparprogramme beziehungsweise Beschäftigungssicherungsabkommen werden abgeschlossen. VW, Porsche, Mercedes, Daimler Truck, Ford oder auch ZF, Bosch, Continental, Mahle und andere bitten die Beschäftigten zur Kasse. Im Gegenzug dafür sichern sie zu, dass Arbeitsplätze gesichert würden. Das Kapital saniert sich auf dem Rücken der Arbeiterklasse. Doch die vereinbarte Beschäftigungssicherung ist keine Garantie, denn es gibt immer Ausstiegsklauseln. Werden Arbeitsplätze abgebaut, dann erfolgt dieser Abbau „sozialverträglich“ abgefedert, also ohne betriebsbedingte Kündigungen. Manchmal geschieht dies still und heimlich, indem Stellen einfach nicht wieder besetzt werden, wenn Kollegen altersbedingt ausscheiden oder aus sonstigen Gründen ihren Arbeitsplatz aufgeben. Manchmal erfolgt der Arbeitsplatzabbau sehr geräuschvoll, mit klangvollem Geschwurbel über „Zukunft“ und lauten Verweisen auf vermeintlich hohe Abfindungen – die die eingebüßten Lohnzahlungen allerdings nicht annähernd ausgleichen. Manchmal werden die Kolleginnen und Kollegen auch rausgemobbt, mürbe gemacht, bis sie unterschreiben. Egal auf welchem Wege es geschieht: Die Arbeitsplätze sind weg. Sie fehlen der arbeitenden Generation wie der ihr nachfolgenden. Und sie fehlen in der Region.
Für die verbliebenen Beschäftigten bedeutet der Arbeitsplatzabbau, dass der Arbeitsdruck steigt. Zudem wird die Konkurrenz und Spaltung innerhalb der Belegschaft sowie gegenüber anderen Belegschaften geschürt. Darüber hinaus werden betriebliche und tarifliche Errungenschaften verkauft. Anstatt der Erholung zu dienen, werden Urlaubstage nun für Qualifizierungsmaßnahmen verwendet. Tariferhöhungen und Sonderzahlungen fließen in Fonds oder werden gänzlich kassiert, Jubiläumsgelder werden gestrichen und so weiter.
Sind die ersten Standards erst gefallen, fallen weitere ein paar Monate später. Ist der erste Arbeitsplatzabbau vereinbart, dann folgt schon die Ankündigung des nächsten. Zuerst wird ein Standort geschlossen, angeblich um die Beschäftigung an anderen Standorten zu sichern. Bald folgt aber schon der nächste, dann noch einer und noch einer. Die Produktion wird nicht eingestellt, sondern oftmals in Billiglohnländer verlagert. Das alles sind mittlerweile alltägliche Meldungen in den Medien.
Zusätzlich zu den Verzichtsvereinbarungen auf Konzernebene werden für jeden Standort jeweils eigene, weitere Verzichtsvereinbarungen geschlossen. Die Standorte sollen untereinander konkurrieren, wer am billigsten produziert. Weitere Standards werden abgesenkt.
Das zermürbt. Die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich hilflos, weil den ständigen Angriffen der Kapitalseite kein kontinuierlicher Widerstand entgegengesetzt wird. Meist gibt es nur vereinzelt Protest, manchmal nur eine Aktion, bei der die betroffenen Kolleginnen und Kollegen Dampf ablassen können. Aber dies bleibt ohne nachhaltige Wirkung.
Die Mutlosigkeit breitet sich immer weiter aus. Wo über Jahre und Jahrzehnte Stellvertreterpolitik betrieben wurde, da hieß es: Der Betriebsrat und die Gewerkschaft werden es mit ihrem Verhandlungsgeschick schon richten. Das war für die Kolleginnen und Kollegen zwar bequem, aber es hat keine Aussicht auf Erfolg. Das Kapital gibt seine Pläne nicht freiwillig und am Verhandlungstisch auf. Nur massiver Druck aus den Belegschaften könnte die Durchsetzung ihrer „Sparpläne“ verhindern. Doch bisher wird kaum Widerstand organisiert, weder in den jeweilig betroffenen Betrieben noch gemeinsam über einzelne Betriebe hinaus.
Zum Einsatz kommen dann noch vor Jahren bereits abgeschlossene Tarifverträge, wie der Tarifvertrag Beschäftigungssicherung (kurz: TV Besch) oder das Pforzheimer Abkommen. Der TV Besch von 1994 ermöglicht es beispielsweise, über freiwillige Betriebsvereinbarungen die Arbeitszeit vorübergehend zu senken, um Entlassungen zu vermeiden. Arbeitet jemand 10 Prozent weniger, erhält er oder sie auch 10 Prozent weniger Entgelt. Auch die Sozialversicherungsbeiträge verringern sich entsprechend und fehlen in den Sozialkassen. Manchmal sind Teillohnausgleiche vorgesehen – den größten Anteil zahlen die Beschäftigten über ihre Lohnverluste. Das Kapital wälzt Risiko und Kosten von Krisen auf sie ab. Das Pforzheimer Abkommen von 2004 erlaubt der Kapitalseite, von Tarifverträgen, vom Flächentarif befristet abzuweichen, wenn sie dadurch Arbeitsplätze „sichert“. So können zum Beispiel Weihnachts- oder Urlaubsgeld sowie tarifliches Entgelt befristet gekürzt werden. Dieses Abkommen folgt der Logik, dass Verzicht auf Seiten der Beschäftigten Arbeitsplatzabbau verhindern könne. Die Kosten der Krise werden auf die Belegschaften abgewälzt. Beide Abkommen machen die Belegschaften extrem erpressbar.
Auch der neue Tarifabschluss für die Stahlindustrie wirkt so – und dies für eine gesamte Branche in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Die tariflichen Regelungen zur Beschäftigungssicherung werden zu dem Preis verlängert, dass alle Stahlarbeiter große Reallohnverluste hinnehmen müssen. Ab Januar 2026 gibt es 1,75 Prozent mehr Geld, davor drei Nullmonate, die Laufzeit beträgt insgesamt 15 Monate.
Und wie bewertet die IG Metall den Abschluss? „Wir haben unser Ziel als IG Metall erreicht: Einkommen, Beschäftigung und Fachkräfte sind solide gesichert“, so Nadine Boguslawski, die im IG-Metall-Vorstand für Tarifpolitik verantwortlich ist. Wie realitätsfern kann man sein, bei 1,75 Prozent mehr Geld die Einkommen als „gesichert“ zu bezeichnen? Es ist zu befürchten, dass der Stahlabschluss zur Blaupause für die Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie wird, die im nächsten Jahr ansteht.
Die Beispiele zeigen deutlich, wie die Kapitalistenklasse die Krise nutzt, um ihre Interessen nach hohen Profiten abzusichern. Trotz oder auch wegen solcher Vereinbarungen können sie relativ frei agieren. Die Belegschaften sind in Krisensituationen erpressbarer, insbesondere wenn von Gewerkschaften keine Gegenwehr organisiert wird. Ein Kurswechsel in den Gewerkschaften ist nötig. „Solidarität macht stark“ darf keine leere Worthülse, sondern muss eine Anleitung zum Handeln sein.