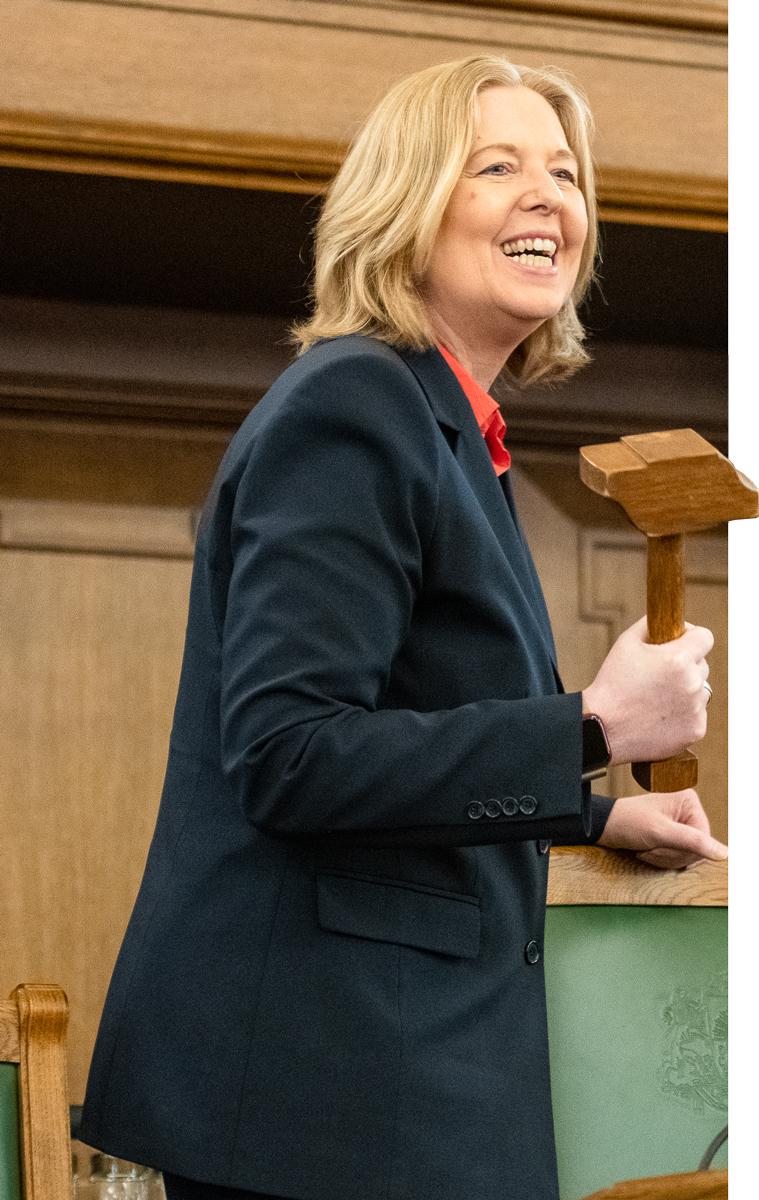Der aktuelle „Ausdruck“, das Magazin der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen (IMI), hat die „Zeitenwende“ in Bildung und Hochschule zum Schwerpunkt. Die Beiträge befassen sich unter anderem mit dem Kampf um die Köpfe, der Rolle von KI, den Rekrutierungsproblemen der Bundeswehr und Militärwerbung auf „TikTok“. Jenseits des Schwerpunktes gibt es Artikel zum Zusammenhang von Militarisierung und Sozialabbau und der wachsenden Atomkriegsgefahr. Mit freundlicher Genehmigung der IMI drucken wir an dieser Stelle den redaktionell leicht bearbeiteten Beitrag „(Re-)Militarisierung der Bildung“ von Reza Schwarz. Das ganze Heft gibt es online hier: uzlinks.de/ausdruck
Wenn über Militarisierungstendenzen gesprochen wird, werden oft klar mit Zahlen quantifizierbare Vorgänge herangezogen, wie die Aufstockung von Truppenstandorten, die Erhöhung der Militärausgaben als Anteil des Bruttoinlandsprodukts oder beispielsweise das Verhältnis von (para-)militärischem Personal gegenüber der Zivilbevölkerung. Dieser quantitative Grad der Militarisierung wird auch Globaler Militarisierungsindex (GMI) genannt. Dieser GMI umfasst aber nicht die Militarisierungstendenzen außenpolitischer Positionen von Staaten oder von gesamtgesellschaftlichen Vorgängen. Der Militarisierungsbegriff muss deshalb erweitert werden.
Eine geeignete Erweiterung stellt hierbei das Phänomen des „banalen Militarismus“ nach Thomas und Virchow dar. Dieser umfasst „die Veralltäglichung des Militärischen im Zivilen“, indem die Gesellschaft sich anhand vielfältiger Prozeduren an Denkmuster, Einstellungen und Verhaltensweisen gewöhnt, die mit einem „militärischen Habitus“ verbunden sein können. Ziel ist hierbei eine Hinwendung zu Prozessen, die weitestgehend in den Alltag eingelassen sind und somit zu einem selbstverständlichen Bestandteil gemacht werden sollen. Einige Beispiele für diese Prozesse sind die Verherrlichung von Kriegen, die Einordnung des Heeres als „Erziehungsinstitution“, Zapfenstreiche, Gelöbnisse, Social-Media-Kanäle der Bundeswehr oder auch die Kulturindustrie mit Filmen (zum Beispiel „Avengers“), Computerspielen (zum Beispiel „Call of Duty“, „Far Cry“, …) oder (Kinder-)Serien (beispielsweise „Paw Patrol“). Ein besonders erwähnenswerter Zusammenhang zwischen quantitativer Militarisierung und banalem Militarismus ist, dass die beschriebenen Militarisierungstendenzen in Bildung, Kultur und Unterhaltungssektor sowie innerhalb der Außenpolitik zunehmen können, während aber gleichzeitig rein quantitativ abgerüstet wird. Dieses Paradoxon war auch von 2011 bis zum Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 in Deutschland zu beobachten. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt und die Bundeswehr wurde unter der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zum Zwecke der Personalgewinnung als ein „familienfreundliches Unternehmen“ charakterisiert. Dabei wurde auch bald das Bild einer „kaputtgesparten Bundeswehr“ bemüht, um zusätzliche Gelder im Bundeshaushalt zu rechtfertigen. Gleichzeitig schloss sich Deutschland der Abschottungspolitik der EU an, setzte Forderungen rechter Parteien politisch um und befeuerte gesellschaftliche Spaltungsprozesse.
Die (Re-)Militarisierung des BRD-Bildungssektors
Die (Re-)Militarisierung des Bildungssektors innerhalb der BRD hat eine lange Tradition, die bis ins Jahr 1958 – gerade einmal 13 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs – zurückreicht: Die Institution der Jugendoffiziere wurde geboren. Diese ersten 17 Jugendoffiziere hatten den Auftrag, die Wehrdienstbereitschaft bei Jugendlichen zu steigern und somit den Bedarf an Soldaten wieder decken zu können. Da große Teile der Bevölkerung einer Wiederbewaffnung kritisch gegenüberstanden und einen potentiellen NATO-Beitritt ablehnten, war das kein allzu leichtes Unterfangen. Trotzdem schaffte es die Bundeswehr, eine engere Zusammenarbeit mit Kultusministerien zu erwirken, die ihnen mehr Besuche an Schulen, Austausch mit Lehrkräften und die Bereitstellung von „Unterrichtsmaterial“ ermöglichten. Zu diesem Zeitpunkt durften die Jugendoffiziere an den Schulen auch noch Werbung für eine Laufbahn bei der Bundeswehr machen. Erst drei Jahre später, ab 1961, wurde das offizielle Werbungsverbot für Jugendoffiziere erlassen. Trotz der Bemühungen von Staat und Militär, die Jugend wieder „kriegstüchtig“ zu machen, gab es in den 1960ern und -70ern eine große Welle von Kriegsdienstverweigerungen. Diese Welle wurde vor allem von der damaligen Studierendenbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition (APO) angeführt. Diese Entwicklungen führten innerhalb der damaligen Verteidigungsministerien zu Besorgnis, weshalb die Anzahl der Jugendoffiziere innerhalb weniger Jahre schlichtweg verdreifacht wurde. Um dem standzuhalten, wurde aus dieser neuen Friedensbewegung heraus damit begonnen, friedenspädagogische Strömungen zu schaffen.
In den 1980er Jahren war die Wehrdienstbereitschaft nach wie vor niedrig, die Angst aber, das angestrebte Wehrpflichtigen-Soll von über 200.000 nicht zu erreichen, hoch. Der „Spiegel“ schrieb im Jahr 1982 in seiner Recherche über vertrauliche Papiere zur Militärwerbung im Schulunterricht unter anderem: „Friedensfreunde, alternative und geburtenschwache Jahrgänge haben den Militärs Angst gemacht, das Soll von 200.000 bis 225.000 Wehrpflichtigen bald nicht mehr decken zu können. (…) Was die Truppe angesichts der ernsten Nachwuchslage von der Schule erwartet, hat der Oberst im Generalstab der Bundeswehr Karl Zimmer jüngst auf einer Sitzung der ‚Kontaktkommission Kultusministerkonferenz/ Bundesverteidigungsministerium‘ deutlich gemacht: Zackiger soll es zugehen. Die Bundeswehr, so der Oberst, erwarte ‚einen zum Gehorsam erzogenen jungen Mann‘. Die Schule müsse ‚nachdrücklich ihren Gehorsamsanspruch durchsetzen‘. Zu verlangen sei eine ‚Erziehung zum Dienen‘ – kurzum: Gefragt sind in den Kasernen keine Schlaffis mit ‚alles einbeziehender Kritikfähigkeit‘, die es nicht gewohnt sind, sich Autoritäten ‚ohne Vorbehalt unterzuordnen‘. Die Lehrer müssten, so auch die vertraulichen Rahmenrichtlinien aus dem Hause Apel, den Schülern ‚mehr Aufmerksamkeit und Hingabe an diesen Staat‘ einbläuen, eine ‚erlebbar gemachte Bindung an Geschichte, Heimat und Vaterland‘ (…) Im Freistaat (Bayern) war die Sicherheitspolitik letztes Jahr (1981) landesweit Abiturthema im Leistungskurs Sozialkunde. Der Themenvorschlag war der Zeitung ‚Information für die Truppe‘ entnommen. Schüler, die kein strammes Ja zum NATO-Doppelbeschluss abgaben, sollten, so ein Ukas aus dem Münchner Ministerium, schlechter benotet werden.“ 1983 schließlich verhängte beispielsweise der damalige Kultusminister Baden-Württembergs, Gerhard Mayer-Vorfelder, ein Verbot für Kriegsdienstverweigerer und Friedensorganisationen im Unterricht.

Trotz dieser Bemühungen, Friedenspositionen aus dem Unterricht zu halten und Uniformierte vor die Klassen zu stellen, ging die Bereitschaft der jungen Menschen, sich dem Wehrdienst auszusetzen, in den 1980er Jahren kontinuierlich zurück. Der Anteil an Zivil- beziehungsweise Ersatzdienstleistenden ging bis zur Wiedervereinigung drastisch nach oben. Die Limitierung der Truppenzahlen durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag verschaffte der Bundeswehr eine Atempause in der Notwendigkeit der Rekrutierung, wobei auch schon in den 1990er Jahren die Gewinnung von Nachwuchs für die Truppe mehr und mehr zum Problem wurde. Jenseits der 2000er Jahre versuchte die Bundeswehr erneut, das Interesse an ihrem Beruf durch die verstärkte Präsenz im Unterricht zu erhöhen. Mit neuen Kooperationsvereinbarungen, geschlossen ab 2010 zwischen Bundeswehr und den Kultusministerien einzelner Bundesländer, wurde der Bundeswehr ein privilegierter Zugang zu den Schulen und Lehrkräften geschaffen. Allerdings nicht ohne Protest und Debatte. Die Bundeswehr konnte ab diesem Zeitpunkt für die Bewerbung des Angebots ihrer Jugendoffiziere andere staatliche Stellen nutzen, wie sie auch einen Zugang in die Ausbildungseinrichtungen neuer Lehrkräfte erhielt. Und auch wenn es den Lehrkräften hier freistand, einen Jugendoffizier in den Unterricht zu holen, so wurde der Druck dazu doch erhöht. In einzelnen Bundesländern führte der öffentliche Protest jedoch auch dazu, dass Lehrkräfte eher weniger von dem „Angebot“ Gebrauch machten beziehungsweise sogar, wie in Baden-Württemberg, parallel zur Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr auch die friedenspolitischen Sichtweisen institutionell verankert wurden.
Politische Sozialisation als Rekrutierungsinstrument
Seit Februar 2022 ist mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs „die Zeitenwende“ nun auch in Deutschland angekommen. Mit dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen hat auch wieder eine Rückkehr zur quantitativen Aufrüstung des Staats stattgefunden. Die weitreichenden Folgen, wie beispielsweise das Drücken der Sozialleistungsquote von 30,3 Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, inklusive. Zum Vergleich: Ähnlich niedrige Leistungsquoten fanden sich nur in den Jahren 2003 und 2019. Obwohl soziale Ungleichheiten das gesamtgesellschaftliche Klima vergiften und viele Menschen generationsübergreifend leiden lassen, zählt vor allem im medialen Diskurs nur noch die „Kriegstüchtigkeit“. Da sich die Truppenstärke über die letzten knapp 25 Jahre hinweg fast halbiert hat und die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, hat die Bundeswehr ein „Personalproblem“. Um den Aufrüstungsambitionen wieder gerecht zu werden, muss vor allem um Kinder und Jugendliche geworben werden. Die Bundeswehr ist deshalb nicht nur in Schulen präsent, sondern auch immer deutlicher in Kitas. In Kitas kommen Soldatinnen und Soldaten in Uniform vorbei und spielen mit den Kindern oder zeigen ihnen stolz ihre Fahrzeuge, einige Kindergartengruppen besuchen sogar Kasernen, machen dort Laternenumzüge oder posieren mit Helm und Brille für ein Bild vor Kampfjets. Eine Kita im niederbayerischen Leiblfing schreibt in ihrem Weblog über den Besuch der Bundeswehr in ihrer Einrichtung: „Heute hatten unsere Kindergartenkinder Besuch von der Bundeswehr Mitterharthausen. Da sie sich derzeit mit dem Thema: ‚In welchen Berufen arbeiten eigentlich Superhelden?‘ beschäftigen, durften die Retter von der Bundeswehr natürlich nicht fehlen! Sie kamen mit zwei Einsatzfahrzeugen und nahmen sich viel Zeit, den Kindern zu erklären, wie diese ausgestattet sind und welche Aufgaben mit ihnen erledigt werden können. Ganz besonders begeistert waren alle vom ‚Eagle‘- Fahrzeug, weil es sogar Blaulicht und eine ganz besondere Antenne auf dem Dach hat! Am Ende der interessanten Vorführungen gab es sogar noch eine süße Überraschung für jedes Kind! (…).“ Bundeswehrsoldaten zum Anfassen also. Eins von vielen Paradebeispielen für banalen Militarismus und die Banalisierung staatlicher Gewalt.
Mittlerweile existieren um die 100 Kooperationen zwischen Bundeswehr und sozialen Einrichtungen, wie aus einer Anfrage der „Linken“-Fraktion im Bundestag 2023 hervorgeht. Diese reichen von Benefizkonzerten über gemeinsame Singnachmittage bis hin zu Unterstützungen von Sommerfreizeiten. Jugendoffizierinnen und -offiziere frequentieren, wie bereits im oberen Textabschnitt erwähnt, seit Jahrzehnten deutsche Schulen. Sie werden von Lehrerinnen und Lehrern eingeladen und zu „Experten für Sicherheitspolitik“ und „Staatsbürgerinnen in Uniform“ deklariert. Sie beantworten Fragen von Schülerinnen und Schülern und „erklären“ Außenpolitik stark vereinfacht anhand des Planspiels POL&IS (Politik und internationale Sicherheit). Bei diesem „Planspiel“ werden militärische Interventionen als Ausweg von Konflikten propagiert.
Besonders auffällig ist, dass Jugendoffiziere vor allem an Gymnasien präsent sind. Die ehemalige FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger forderte eine noch stärkere Präsenz von Jugendoffizieren und regelmäßige Katastrophenübungen an Schulen. Dagegen regte sich unter anderem von der „Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz“ öffentlicher Widerstand: „Noch mehr Bundeswehr an unseren Schulen?! Nein danke, Frau Stark-Watzinger! (…) Für uns treffen Schulbesuche der Bundeswehr und Übungen nicht den Sinn von Unterricht. Das sorgt nur für Angst und Panik. Zumal wir viele Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine haben, die das nur zusätzlich traumatisieren würde. Und das sehen wir als absolut nicht sinnvoll an.“ An der Humboldtschule in Leipzig gab es ebenfalls Schülerinnen und Schüler, die konsequent gegen Auftritte von Offizieren zum Beispiel mit „Die-iuns“ protestiert und Kundgebungen durchgeführt haben. Einem von ihnen wurde eine „Störung des Schulfriedens“ vorgeworfen, ihm drohte letztendlich sogar der Schulverweis. In Bayern soll zudem der Zugang der Bundeswehr zu den Schulen mit dem im Sommer 2024 verabschiedeten Bundeswehrgesetz massiv erleichtert werden.
In diesem Jahr startet außerdem der neue „Auswahlwehrdienst“, der anhand eines Online-Formulars die Wehrbereitschaft abfragen soll. Dieses Formular wird an alle 18-Jährigen versendet, die Beantwortung ist bisher nur für Menschen mit einem männlichen Geschlechtseintrag verpflichtend. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass nur Personen für den Wehrdienst ausgewählt werden, die „am fittesten und am besten geeignet sind“. Als „kleiner Anreiz“ winkt sogar die Finanzierung eines Führerscheins.