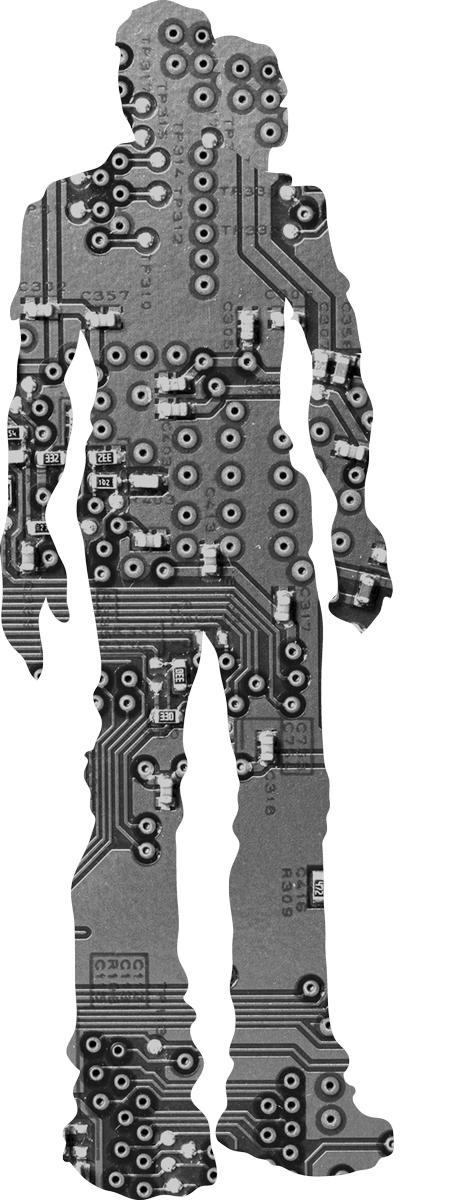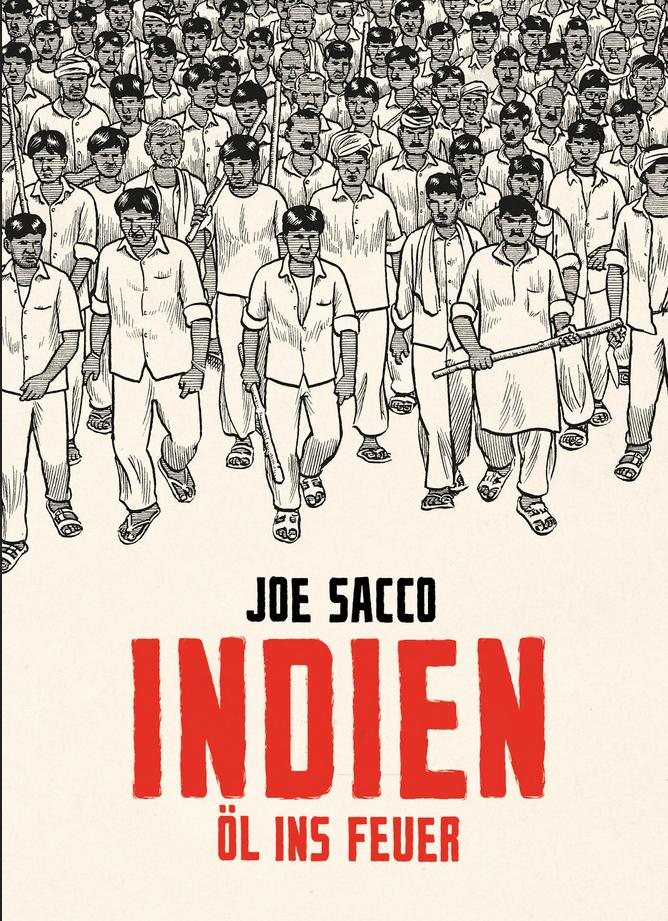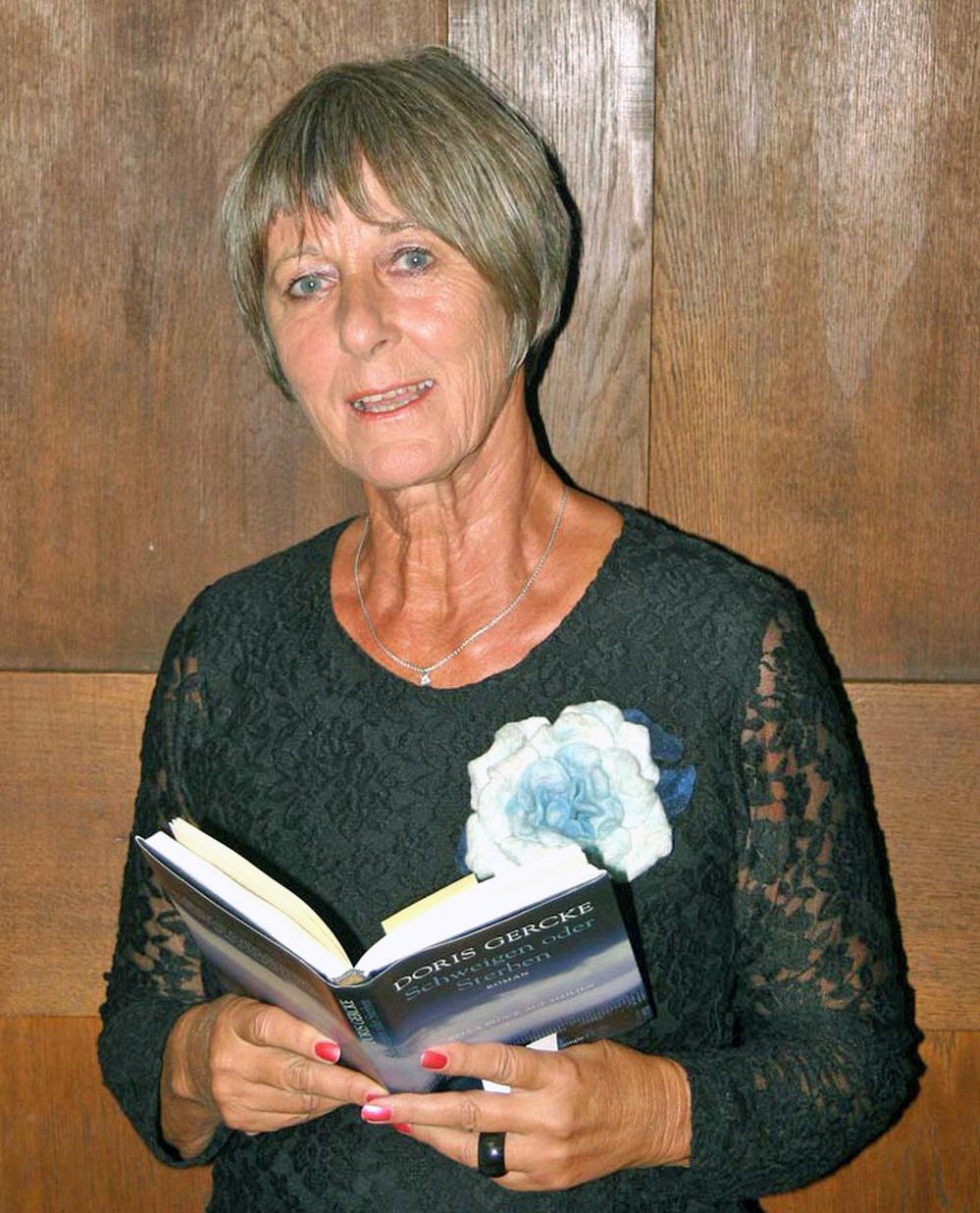Zwei Schrecken halten die Erinnerung an Mary Shelley wach. Beide hat sie in bleibenden Formen gestaltet. Der erste Schrecken: Wir müssen zwar unsere Biologie verstehen, wenn wir die Naturquellen unserer Leiden versiegeln wollen, aber das Verständnis der Biologie macht uns auch mit Ungeheuern bekannt, die wir andernfalls nicht kennengelernt hätten. Der zweite Schrecken: Eine Technik, die durch Biologie, Chemie und Physik hindurch ins Innerste des Kosmos greift, in Moleküle, Atome, Elektromagnetismus, Kernkräfte und Schwerkraft, bewahrt uns nicht vor Überraschungen, die uns auslöschen können, wenn wir unsere Gesellschaft nicht so einrichten, dass sie ihre Fortschritte erträgt.
Den ersten Schrecken hat Mary Shelley im 1818 erschienen Roman „Frankenstein; or, The Modern Prometheus“ auf die Literatur losgelassen. Das wichtigste Wort im Titel des Buches ist „Modern“. Denn das berühmte Monster, von dem das Buch erzählt, das nach seinem Schöpfer heißt, kommt ausdrücklich anders zustande als die überlieferten Monster der Mythologie und der älteren Kunst: Es ist technisch geboren, in Wissenschaft gezeugt.
Den zweiten Schrecken hat Mary Shelley im 1826 erschienenen Roman „The Last Man“ untersucht. Da ist das wichtigste Wort im Titel: „Last“: Der letzte Mensch überlebt eine Seuche, die ihn in die Einsamkeit stößt, in die Verzweiflung, die schlimmer ist als jeder Schrecken. Denn während der Schrecken sagt: „Es gibt etwas Neues, das ist furchtbar“, sagt Verzweiflung: „Dieses Furchtbare ist das Ende, nie mehr kommt etwas Neues.“
Ohne Gesellschaft und ohne das Vermögen, je wieder eine zu gründen, ist der Mensch keiner. Mary Shelley lebte von 1797 bis 1851, in einer Epoche, in der angesichts der neuesten technischen und sozialen Entwicklungen die Fortschrittsidee plausibler war als je zuvor, aber in „The Last Man“ steht: Wer den Fortschritt nur als Lösung bereits bekannter Probleme sehen kann, wird von unbekannten gefressen.
Die Menschengattung stürzt in „The Last Man“ ins Nichts, aus sehr großer Höhe – es gibt eine euphorisch-utopische Passage im Roman, in der Shelley einen persönlichen Bekannten, den Dichter und Politiker Lord Byron, als Mann des Fortschritts namens Lord Raymond fiktionalisiert, dessen Trockenlegung uralter natürlicher und sozialer Sümpfe auf einem staunenswert glücklichen Stand der Produktivkräfte in Angriff genommen wird: „Inzwischen ging es in London gut voran. Die Neuwahlen waren beendet; das Parlament tagte, und Raymond war in tausend wohltätige Programme eingebunden. Kanäle, Aquädukte, Brücken, staatliche Gebäude und verschiedene Bauwerke für die öffentliche Versorgung wurden im Zuge dessen entworfen; er war ständig von Projektleitern und Projekten umgeben, die England zu einem Schauplatz der Fruchtbarkeit und Großartigkeit machen sollten; der Zustand der Armut sollte abgeschafft werden; Menschen sollten von Ort zu Ort befördert werden, fast mit derselben Leichtigkeit wie die Prinzen Houssain, Ali und Achmed in ‚Tausendundeiner Nacht‘. Der physische Zustand der Menschen würde bald nicht mehr hinter der Schönheit der Engel zurückstehen; Krankheit sollte verbannt, die Arbeit ihrer schwersten Last entledigt werden. Das erschien auch gar nicht überspannt. Die Lebenskünste und die Entdeckungen der Wissenschaft hatten in einem Verhältnis zugenommen, das alle Hochrechnungen übertraf; inzwischen entstand Nahrung sozusagen spontan – es existierten Maschinen, die jeden Bedarf der Bevölkerung mit Leichtigkeit versorgten.“
Was der letzte Mensch in diesem Buch verliert, ist also nicht irgendein soziales Umfeld, sondern geradezu ein wahrgewordenes Ideal von Gesellschaft überhaupt.
Der Absturz der Titelfigur von „Frankenstein“ ist genauso tief: Er hat die Mittel bei der Hand, Leben zu erschaffen, aber was er hervorbringt, ist stattdessen ein wandelnder Tod. Der muss als verfluchte Kreatur am Romanende von sich sagen: „Ich habe die Liebenswürdigen und die Hilflosen ermordet; ich habe die Unschuldigen im Schlaf erwürgt und ihm, der weder mir noch einem Mitmenschen je etwas zuleide getan hat, die Kehle zugedrückt, bis er tot war. Ich habe meinen Schöpfer, die Verkörperung alles dessen, was unter Menschen der Liebe und Bewunderung wert ist, dem Elend preisgegeben; ich habe ihn sogar bis zum endgültigen Untergang verfolgt.“
Weil der bürgerliche Kulturbetrieb eine verständliche Scheu vor allzu deutlichen künstlerischen Interventionen ins Gesellschaftliche hat – er repräsentiert schließlich eine ungerechte, verrückte und falsche Gesellschaft – und deshalb dazu neigt, soziale Visionen zu subjektiven und privaten Befindlichkeiten zu verengen (sogar „Hamlet“, Shakespeares unsterbliches Drama vom Zwiespalt zwischen Theorie und Praxis im politischen Bewusstsein der absolutistischen Intelligenz, soll neuerdings eine therapeutische Familienaufstellung des Dichters gewesen sein), ist „Frankenstein“, ein Buch, dessen Handlung sich in einem überschaubaren Personenkreis zuträgt, in diesem Betrieb besser gelitten und daher berühmter als „The Last Man“.
Bei „Frankenstein“ kann man so tun, als ginge das, was drinsteht, nicht die ganze Menschheit an, sondern nur diejenigen, die es mit Forschung und Technik übertreiben. Aber die Kunst weiß sowas besser, und so lassen sich Kunstschaffende von Shelleys berühmtestem Buch bis heute zu Werken anregen, die sagen, was die Bourgeoisie nicht gern hört. Im französischen Film „Titane“ (2021) von Julia Ducournau zum Beispiel ist die Hauptfigur Alexia, der man, als sie ein Kind war, nach einem Unfall eine Metallplatte in den Kopf gesetzt hat, zugleich Teil der natürlichen wie der technischen Welt, ein lebendes, bis kurz vor dem Zerreißen gespanntes Verbindungsstück zwischen einer Sorte Maschine, die Menschen brauchen könnten, und einer anderen Sorte, die ihnen das Kapitalverhältnis aufzwingt. Das macht sie zur Urenkelin von Frankensteins Geschöpf und der Film kann, weil sich Moral verändert hat, an manchen Stellen deutlicher werden als der Urtext. Sex zum Beispiel kann Alexia, die in der Lustindustrie ihren Körper zu Markte trägt, nur mit einem Apparat haben, nicht mit Menschen, so weit ist Entfremdung und Vergegenständlichung des Umgangs gediehen. Und zu sich selbst findet sie erst, als sie die soziale Rolle eines toten Jungen spielt. Die Klinge, auf der sie da tanzen muss, trennt den Tauschwert der natürlichen Körper vom Gebrauchswert der Tatsache, dass Menschen soziale Wesen sind. Am Ende kriegt sie ein Kind von der Technik – der Weg aus der verkehrten Lebensweise führt nicht hinter sie zurück in die verklärte Erinnerung an Natur, sondern nur durchs Verkehrte hindurch, ganz wie der eines anderen Erben des „Frankenstein“-Mythos, dem man im Kino 2025 begegnen konnte: Jared Leto als denk- und empfindungsfähiges Computerprogramm in Joachim Rønnings Science-Fiction-Actionthriller „Tron: Ares“.
Auf einer Menschenjagd durch gehackte Dateien begegnet ihm der komplette „Frankenstein“-Text, darin der vieldeutige Satz: „Beware; for I am fearless, and therefore powerful.“ Mit dieser Gleichsetzung von Furchtlosigkeit und Macht konfrontiert, erkennt sich das von Leto gespielte Wesen als eine Zerstörungskraft, in der eine Produktivkraft steckt. Das Erschrecken darüber weckt es aus dem blinden Funktionieren.
„Frankenstein“ hat nach so langer Zeit solche Effekte, weil das Buch mit der Weltgeschichte selbst einen finsteren, unauflöslichen Pakt geschlossen hat. Es ist eben keine subjektive Spinnerei einer Nervösen; Mary Shelleys Schrecken waren historische und politische.
Das englische Wort für Schrecken, „terror“, klang für ihre Ohren sehr nach dem französischen, „terreur“, das Shelleys Generation als revolutionären Begriff kannte.
Deutsch nennt man das, was dieser Begriff bezeichnet, „Schreckensherrschaft“: die Zeit der härtesten revolutionären Fraktions- und Machtkämpfe in Frankreich während der Jahre 1793 und 1794. Mary Shelleys Mutter, die frühe radikalbürgerliche Feministin Mary Wollstonecraft, brachte die ältere Halbschwester der Dichterin, Fanny Imlay, am 14. Mai 1794 in Le Havre auf die Welt, mitten in jenem Schrecken, an seinem Schauplatz.
Sie erlebte, was Marx später lehrte: Die Eroberung der Macht durch eine neue Klasse beendet die Klassenkämpfe nicht, sondern verschärft sie. Mary Shelleys Eltern bekannten sich zu Überzeugungen, die diesen Kämpfen viele Stichworte schenkten; ihr Vater William Godwin lehnte die alte ständische Welt, gegen die Frankreichs revolutionäres Bürgertum aufgestanden war, radikal ab, nannte sich einen Anarchisten und wich nicht davor zurück, auch dann noch als Franzosenfreund zu gelten, als sein Vaterland England bereits im reaktionären Kriegsbündnis alter Mächte gegen den neuen Staat in die Schlacht zog.
Mary war also Tochter zweier Fundamentaloppositioneller. Kurz nach ihrer Geburt am 30. August 1797 starb die Mutter an deren Folgen. Ihr emanzipatorischer Geist sollte nach dem Willen des Vaters in Mary weiterleben, so erzählte er ihr etwa von dem Kometen, dessen Bahn er am Himmel beobachtet hatte, als das Kind zur Welt kam: Das Objekt war nach einer Frau benannt, Caroline Herschel, Astronomin und Sängerin aus Deutschland, eine Schutzheilige der Vereinigung von Naturerkenntnis und Kunst.
Auch von Napoleon hat er zu ihr gesprochen, dem Diktator, der eine Gesetzgebung in Europa verbreitete, die ihre Herkunft aus der Revolution nicht verleugnen konnte. Die Autorität des Kriegshelden war denen, die aus diesem Grund mit ihm sympathisieren, nicht geheuer, und als er im Krieg unterlag, stieß das seine Leistungen auch für viele derjenigen ins Dunkel.
Godwin sank in tiefe Niedergeschlagenheit. Die Haltung zu Napoleon war damals die große Probe auf den Fortschrittswillen der ganzen Kunst- und Gelehrtenwelt, von Beethoven über Goethe bis zu den schwärmerischen Köpfen des zeitgenössischen Linksradikalismus, die Napoleons Selbstüberhebung die Schuld am Debakel gaben – sie standen zu dem Mann wie später der von Perry Anderson (ambivalent bis skeptisch) wie von Domenico Losurdo (kritisch bis ablehnend) untersuchte „westliche Marxismus“ zu Stalin stand: Der Mann war ihnen ein Unglück, das ihre ganze Analyse der Kräfteverhältnisse zwischen Fortschritt und Reaktion färbte und verzerrte, ins rein Moralische nämlich.
So sah das beispielsweise auch Mary Shelleys Ehemann, der Dichter Percy Bysshe Shelley, während beider Freund Lord Byron aus der Widersprüchlichkeit des damals vorherrschenden Napoleonbildes immerhin noch tragisch-heroische Züge herauszulesen verstand. Rechtschaffen stabile politische Positionen sind schwer zu erringen und zu halten, wo eine Zeit dermaßen unter Strom steht wie jene Epoche – man darf das mit dem Strom sogar wörtlich nehmen: Napoleon ließ 1803 den Elektrizitätspionier Alessandro Volta zu sich kommen und führte unter dessen Anleitung persönlich Versuche durch, bei denen Funken sprühten. Auch Percy Shelley machte sich bereits als junger Mann am „Galvanismus“, an Bio-Elektrik zu schaffen; er war davon überzeugt, an dieser Front müsse dereinst der Tod besiegt werden.
Bei der Geburt der solche Ansichten verarbeitenden „Frankenstein“-Geschichte im Jahr 1816 waren außer dem Dichter und seiner Frau, die „Frankenstein“ erfand, auch der Arzt und Schriftsteller John Polidori sowie Lord Byron und Marys Stiefschwester Claire Clairmont in der Villa Diodato am Genfersee anwesend. Man wird nicht glauben dürfen, dass Politik und Zeitgeschichte in den Gesprächen dieser denkwürdigen Begegnung nicht zur Sprache gekommen sind.
Neues Leben aus Leichenteilen, die Gewalt von Technik und Wissenschaft: Wie sollten die davon Faszinierten nicht an die Revolution gedacht haben dabei, nicht an Napoleon, der den modernsten, wissenschaftsfreundlichsten Staat der Epoche schuf, per Straffung der Verwaltung, die ihm unter anderem der Chemiker, Förderer chemischer Industrie und starke Propagandist des metrischen Systems Jean-Antoine Chaptal als Innenminister organisierte, in einer Front mit dem Mathematiker und Physiker Joseph Fourier, der im Hauptberuf einige der stabilsten Verfahren neuzeitlich exakter Naturforschung entdeckte?
Vor diesem Zeithintergrund allein zeigt sich Mary Shelleys Format vollständig: Während eingefleischte Fortschrittsmänner um sie her sich in Katzenjammer wälzten, als Napoleons Konzeption des neuen Zeitalters mit seiner Militärmacht zusammenbrach, erkannte sie, dass die Verstetigung revolutionärer Gewalt zur Staatsmacht als zur Produktivkraft gewandelte Zerstörungswucht des Neuen aus dem Fortschritt nicht wegzudenken geht. Sie stellt ihr Publikum deshalb bis heute vor die Frage, welche Kraft im Schrecken steckt und wie das Neue lernen kann, sich im Spiegel seines Wissens, seiner Künste und seiner Macht selbst zu begreifen. Wagt ihr’s? Oder frisst euch das, was ihr geschaffen habt, weil ihr’s nicht dazu gebrauchen könnt, euch selbst genauso neu zu machen, wie diese Schöpfung ist?