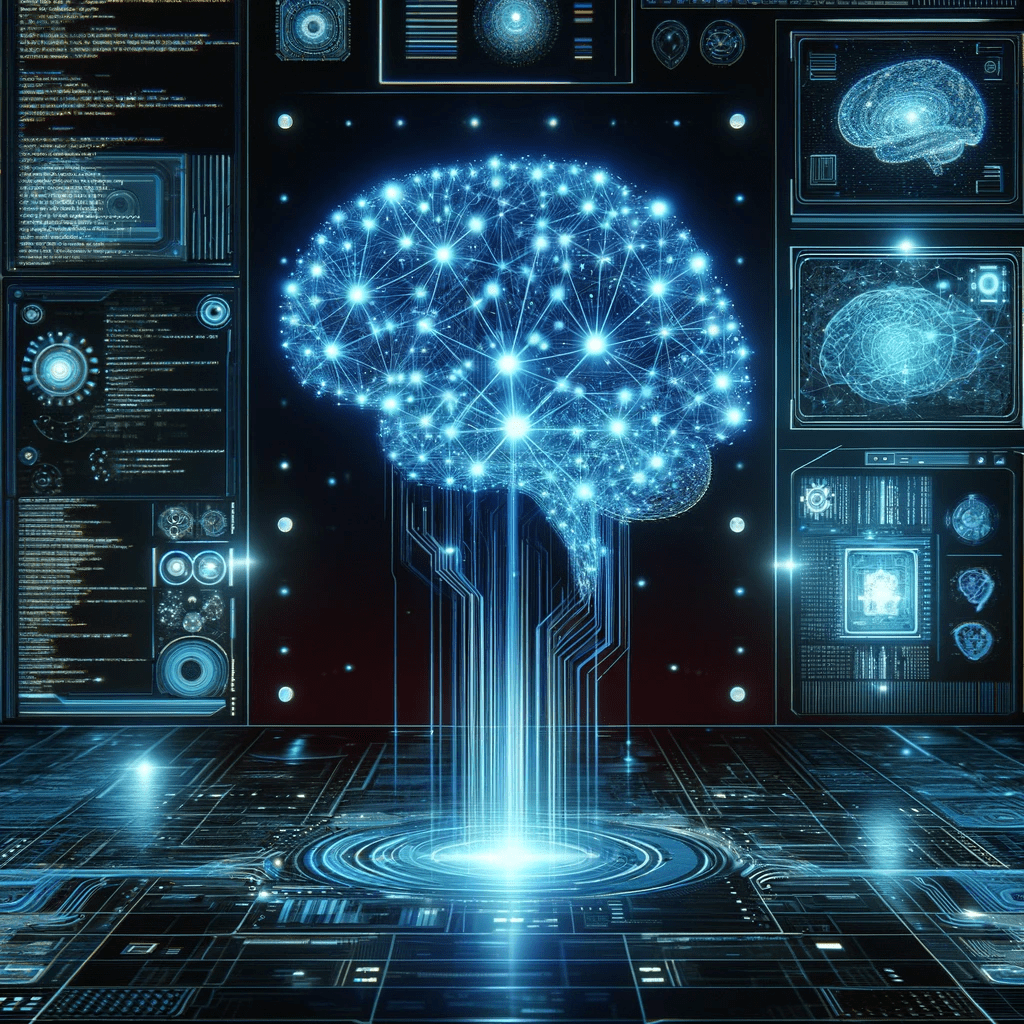Die Bundesregierung bemüht sich nach Kräften, die Gewerkschaften in ihren Kurs auf Kriegsvorbereitung und Sozialabbau einzubinden. Die Friedensbewegung muss diese Einbindungsstrategie entschleiern und zurückdrängen. Dafür plädierte Ulrike Eifler, Mitglied im Bundesvorstand der Partei „Die Linke“, in ihrem Beitrag im Eröffnungsplenum des 32. Bundesweiten Friedensratschlags in Kassel am 8. November. Wir dokumentieren ihre Rede in voller Länge:
Aus meiner Sicht ist der Aufbau einer in den Gewerkschaften verankerten Friedensbewegung die zentrale strategische Herausforderung, vor der wir als Friedensbewegung aktuell stehen. Dafür gibt es mindestens drei Gründe:
Erstens: Die Friedensbewegung gewinnt dann an gesellschaftlicher Breite und an Stärke, wenn es gelingt, soziale und Friedensfragen miteinander zu verbinden. Die beiden Generalstreiks gegen den Genozid, die vor einigen Wochen in Italien stattfanden, kamen auch deshalb zustande, weil sich die Hafenarbeiter nicht länger zum Komplizen des Völkermords machen lassen wollten durch die Verladung von Rüstungsgütern. Aber auch deshalb, weil das Arbeiten an Containern mit Munition und Sprengstoff gefährlich ist und explizit Fragen der Arbeitssicherheit aufgeworfen hat. Elementare Friedensfragen und soziale Fragen sind zusammengeführt worden. Das Beispiel zeigt: Durchsetzungsstärke gewinnt die Friedensbewegung, wenn sie die Menschen in den Betrieben für ihr Anliegen gewinnt.
Zweitens: Die Kriegsvorbereitung der Bundesregierung ist mit gravierenden Angriffen auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften verbunden. Dabei ist klar: Diesmal geht es an die Grundfeste gewerkschaftlicher Errungenschaften: Streichung von Feiertagen, Angriff auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Abschaffung des Achtstundentags, Rente mit 70, 72 oder 73, Vorleistung bei Arztbesuchen, und so weiter und so fort. Merz und Klingbeil holen sich das Geld für ihren Krieg bei der arbeitenden Mehrheit. Sie sprechen ganz bewusst vom „Epochenbruch in der Sozialpolitik“ und davon, die „Verrechtlichung ganzer Lebensbereiche endlich zu beenden“. Diese Angriffe stehen mit der Kriegsvorbereitung der Bundesregierung in Verbindung, deshalb müssen die Bewegung für Frieden und die Bewegung gegen den Sozialabbau zusammengeführt werden.
Und drittens: Die Bundesregierung versucht, die Gewerkschaften in ihren Kurs auf Aufrüstung und Sozialabbau einzubinden, um den notwendigen Klassenprotest gegen diese Politik still zu stellen. Dahinter steckt die Überlegung, dass eine Regierung, der es gelingt, ihre wahren Kriegsabsichten zu verschleiern und den Zusammenhang von Sozialabbau und Aufrüstung aus dem öffentlichen Bewusstsein zu tilgen, den Legitimitätsdruck erzeugt, der nötig ist, um Krieg führen zu können. Deshalb ist es an uns, alternative Orientierungsangebote zu machen und Räume für kritisches Denken und kritische Debatten zu öffnen.
Tun wir das mit der unversöhnlichen Ungeduld gegenüber diesen Verhältnissen, aber auch mit der größtmöglichen Geduld gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen. Denn es ist aus meiner Sicht wichtig, anzuerkennen, dass die Gewerkschaften aktuell unter großem Druck stehen und zuallererst unsere Unterstützung und erst im zweiten Schritt unsere solidarische Kritik brauchen.
Die Strategie der Bundesregierung besteht darin, den Krieg vorzubereiten und die Gewerkschaften dabei nicht gegen sich aufzubringen. Dabei bietet sie vermeintliche Lösungen für die bestehenden Deindustrialisierungsprobleme an. Diese Lösungen sind allerdings nicht einmal mehr Scheinlösungen, sondern werden die Probleme und die dahinterstehende Krise weiter vertiefen: Aus der Rezession herauszuklettern, indem man die Rüstungsindustrie expandiert, erhöht die Kriegsgefahr und setzt die Gewerkschaften weiter unter Druck. Die Zeiten des Rüstungskeynesianismus unter Hitler in den frühen 1930er Jahren waren bei weitem keine arbeiterparadiesischen Zustände. An der Tagesordnung waren 70-80 Arbeitsstunden in der Woche. Es gab kein Recht auf Streik, kein Recht auf Mitbestimmung, kein Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Im Gegenteil: Die Gewerkschaften wurden zerschlagen und viele aktive Gewerkschafter in die Zuchthäuser und Konzentrationslager verschleppt.
Auf welchen Weg uns diese Weichenstellungen führen, zeigt die Forderung des EVP-Fraktionschefs Manfred Weber. Er sagt, Europa müsse endlich auf Kriegswirtschaft umstellen – „notfalls mit Mehrheiten von rechts“ – und damit einen Zustand herbeiführen, in dem der Staat entscheidet, was ein Unternehmen produziert und ob am Wochenende Überstunden gemacht werden. Das Beispiel zeigt: Durch Aufrüstung und Kriegsvorbereitung kommt auch die betriebliche Mitbestimmung unter die Räder. Deshalb muss diese Entwicklung in den Gewerkschaften offen diskutiert und besprochen werden.
Eine weitere Nebelkerze, die das Ziel hat, die Gewerkschaften einzubinden, ist das „Sondervermögen Infrastruktur“. Hier ist klar, dass die schuldenfinanzierte Aufrüstung dem Versuch dient, den frontalen Angriff auf die arbeitende Mehrheit zu vermeiden. Um nicht falsch verstanden zu werden: Es geht Merz und Klingbeil keineswegs darum, den Angriff auf die Menschen zu vermeiden, sondern lediglich darum, den frontalen Angriff zu vermeiden und dadurch möglichem Protest der Gewerkschaften aus dem Weg zu gehen.
Wenn die schuldenfinanzierte Aufrüstung dann auch noch als Infrastrukturpaket getarnt wird und in einer Größenordnung daher kommt, die die Gewerkschaften seit einigen Jahren gefordert haben, dann ist es Aufgabe der Friedensbewegung, auch hier alternative Orientierungsangebote zu machen und Räume für die kritische Debatte über den eigentlichen Charakter des Infrastrukturpakets zu eröffnen.
Kein einziger Euro wird in den Aufbau der sozialen Infrastruktur fließen. Denn „Zeitenwende“ bedeutet die Unterordnung aller gesellschaftlicher Bereiche unter die Kriegsvorbereitung. Das gilt auch für die Investitionspolitik. Unterirdische Lazarette, tragfähige Brücken, breitere Straßen, Spurweitenanpassungen in Osteuropa, Bunkerbau und möglicherweise die Anschaffung von Handgranatenattrappen für den Sportunterricht – das wird der Beitrag sein, den wir von dem Infrastruktur-Programm erwarten dürfen.
Natürlich ist die Verankerung der Friedensbewegung in den Gewerkschaften leichter gesagt als getan. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass Kriege und Kriegsvorbereitungen die Arbeiter- und die Gewerkschaftsbewegung stets in große Krisen und immer auch in Widerspruchskonstellationen gedrängt haben. Denken wir beispielsweise an die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten oder die Burgfriedenspolitik der Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg.
Aber denken wir auch daran, dass es streikende Arbeiter waren, die den Ersten Weltkrieg beendeten. Die 750.000 Frauen in den Berliner Munitionsfabriken, die die Arbeit niederlegten, weil sie ihre Kinder nicht mehr satt bekamen und weil sie nicht länger erdulden wollten, dass ihre Männer in den Schützengräben starben. Oder die Kieler Matrosen, die den Befehl verweigerten und die Gewehre umdrehten, weil sie sich nicht in die letzte Schlacht mit der völlig überlegenen britischen Flotte hineintreiben lassen wollten. Die Tatsache, dass die großen Klassenorganisationen der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung erst zerschlagen wurden, ehe der Zweite Weltkrieg begonnen wurde, hatte auch etwas mit dieser Erfahrung zu tun. Hier zeigt sich am aller deutlichsten, dass es die Kraft und Stärke der organisierten Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ist, die Kriege verhindern oder beenden kann.
Wenn wir über Widerspruchskonstellation reden, dann müssen wir fragen, welchen Widersprüchen die Gewerkschaften heute ausgesetzt sind. Die ganz große Herausforderung ist, insbesondere für die Industriegewerkschaften, die Deindustrialisierung. Sie setzt die Gewerkschaften einem enormen Druck aus. Allein 2024 sind 100.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen. Und an jedem Industriearbeitsplatz hängen drei bis vier weitere Arbeitsplätze. Denn da, wo Arbeitsplätze in der Industrie entstehen, werden auch Kindergärten, Grundschulen, Krankenhäuser, Supermärkte und Sparkassen gebraucht.
Wir sollten den Druck, unter dem die Gewerkschaften in der aktuellen gesellschaftlichen Krisensituation stehen, also nicht unterschätzen. Und wir sollten verstehen, dass die Durchsetzungsstärke der Industriebelegschaften ganz wesentlich zur Ausgestaltung des Sozialstaates in der Nachkriegszeit beigetragen hat. Denken wir beispielsweise an die Werftarbeiter in Schleswig-Holstein, die 1956 in einem sechzehnwöchigen Streik die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchsetzten. Denken wir an die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie und natürlich auch in der Druckindustrie, die 1984 die Tür zur 35-Stunden-Woche aufstießen. Oder denken wir an die Kollegen bei Daimler in Untertürkheim, die 1997 mit vier Tagen Streik das Sparpaket von Kohl und Waigel verhinderten.
Mit dem Rückblick auf die Sozialstaatsgeschichte müssen wir zur Kenntnis nehmen: Deindustrialisierung und der Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie bedeuten zugleich Verlust von Kampfkraft – in der Tarifpolitik, in sozialen Fragen, aber eben auch in der Friedensfrage. Und wir sollten nicht vergessen, dass die Friedensbewegung in den 1980er Jahren auch deshalb stark war, weil die Gewerkschaften ein Teil von ihr waren.
Die Gewerkschaften stehen heute vor der Herausforderung, die Durchsetzungsstärke in den Betrieben zu bewahren oder neu aufzubauen. Unter diesem Druck setzen sie inhaltliche Prioritäten und räumen der Arbeitsplatzfrage zugunsten der Friedensfrage den Vorrang ein. Sie stehen zugleich vor der Herausforderung, dass sie sich trotz der erodierenden Machtressourcen ihrer prinzipiellen Stärke wieder bewusst werden müssen – dass Millionen stärker sind als Millionäre, wie Willi Bleicher es einmal formulierte.
Dafür brauchen sie die Unterstützung der Friedensbewegung, denn gewerkschaftliche Machtressourcen werden nicht nur durch Tarifflucht, Deindustrialisierung und leere öffentliche Kassen angegriffen, sondern auch durch die Sozialkürzungen der Bundesregierung. Diese Sozialkürzungen sind nicht nur das Ergebnis davon, dass mit Friedrich Merz ein ehemaliger BlackRock-Manager Bundeskanzler geworden ist. Diese Sozialkürzungen sind auch das Ergebnis der Kriegsvorbereitungen. Wer jährliche Rüstungsausgaben in der Größenordnung der Hälfte des Bundeshaushalts tätigen will, der muss sich das Geld bei Bürgergeldempfängern und Rentnern holen und den Sozialstaates radikal abbauen.
Klar ist: Eine Bundesregierung, die sagt, wir hätten alle über unsere Verhältnisse gelebt und müssten jetzt alle miteinander den Gürtel enger schnallen, greift die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften an. Die Abschaffung des Acht-Stunden-Tages und damit die Rückkehr zur 70-Stunden-Woche unterminiert den gewerkschaftlichen Kampf für Arbeitszeitverkürzungen. Ein Tariftreuegesetz, das sämtliche Ausgaben zur Deckung der Bedarfe der Bundeswehr ausnimmt, unterminiert den gewerkschaftlichen Kampf um die Stärkung der Tarifbindung. Die Sanktionierung von Bürgergeldempfängern führt nicht zu mehr Mut und Offensivität in den Betrieben, sondern diszipliniert zuallererst die Belegschaften. Wenn die Alternativen zu einem schlecht bezahlten Job Sanktionen, Druck und Leistungsverzicht sind, dann wächst die Bereitschaft, eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen hinzunehmen.
Aus diesen drei Gründen sage ich: Es ist die zentrale Aufgabe der Friedensbewegung, ganz grundsätzlich, aber auch im gemeinsamen Dialog mit und in den Gewerkschaften deutlich zu machen: Es gibt keine rechtere und gefährlichere Politik als die Vorbereitung eines Krieges. Wer die Interessen der arbeitenden Mehrheit schützen und wer die voranschreitende Rechtsentwicklung stoppen will, der muss sich klar und deutlich für eine Kehrtwende in der deutschen Außenpolitik aussprechen. Krieg und Klassenkampf hängen miteinander zusammen. Über den Krieg zu sprechen heißt, über Klasseninteressen zu sprechen. Wer nicht über Klasseninteressen sprechen will, der vermeidet es, über den Krieg zu sprechen.
Deshalb ist der Dialog der Friedensbewegung mit und in den Gewerkschaften so wichtig. Der Kampf um die Köpfe der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben ist dabei zentral. Die extreme Rechte hat das im übrigen verstanden. So sagte Björn Höcke auf einem der letzten Parteitage der AfD: Wir werden nicht durchbrechen, wenn wir nicht die Mehrheit in den Betrieben haben. Auch die Bundesregierung hat das verstanden. Deshalb bemüht sie sich nach Kräften, die Gewerkschaften in den Kurs auf Kriegsvorbereitung und Sozialabbau einzubinden. Die Friedensbewegung muss das auch verstehen und diese Einbindungsstrategie entschleiern und zurückdrängen.
Dafür gibt es aktuell zwei politische Anknüpfungspunkte. Der eine ist das Thema Wehrpflicht. Die Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung laufen über, und auch in der Gewerkschaftsjugend wird das breit diskutiert. Auch, wenn Boris Pistorius zuweilen so tut, als handele es sich um eine Fachkräftedebatte, auch, wenn die Bundeswehr mit ihren Werbekampagnen den Eindruck erweckt, der Kriegsdienst sei ein lebenslanges Abenteuercamp – immer mehr junge Menschen, immer mehr Eltern und Großeltern haben verstanden, dass es darum geht, uns in einen gefährlichen und sinnlosen Krieg zu schicken. Und weil auf den Grabsteinen der im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten nicht die Namen von Rüstungsfabrikanten, Kriegsministern und Militärexperten stehen, sondern die Namen von Straßenbahnfahrern, Industrieschlossern und Elektrikern, gehört dieses Thema in die Gewerkschaftshäuser und in die gewerkschaftliche Debatte. Wir brauchen im Rahmen der arbeits- und sozialrechtlichen Beratung für Gewerkschaftsmitglieder wieder eine Beratung zur Verweigerung des Kriegsdienstes.
Ebenso wie die Wehrpflicht bietet auch der angekündigte Sozialkahlschlag eine Chance, die Friedensfrage in die gewerkschaftliche Debatte zu tragen und aus der aktuellen strategischen Schwäche in eine Position der Stärke zu kommen. Das gilt für die Gewerkschaften ebenso wie für die Friedensbewegung. Dazu müssen wir die Verbindung zwischen Sozialabbau und Aufrüstung herstellen und mit den Kolleginnen und Kollegen darüber diskutieren. Um diesen Zusammenhang herzustellen, reicht es häufig schon aus, die Funktionseliten zu zitieren – ifo-Chef Clemens Fuest beispielsweise, der sagte: „Kanonen und Butter – das ist Schlaraffenland“, natürlich werde die Aufrüstung Sozialabbau nach sich ziehen. Oder Boris Pistorius, der in der vorletzten Tarifrunde des Öffentlichen Dienstes geäußert hat, ein guter Abschluss im Öffentlichen Dienst minimiere die Ausstattung der Bundeswehr. 11,5 Milliarden Euro will die Bundesregierung im nächsten Jahr für den Krieg in der Ukraine aufwenden – während man hierzulande die Streichung von Feiertagen, die Rente mit 73 oder Leistungskürzungen für Bürgergeldempfänger ankündigt. Die Themen gehören zusammen, und es ist an uns, die künstlich auseinandergehaltenen Diskussionen wieder zusammenzuführen.
Was mich optimistisch stimmt: Dass die Diskussion in unseren Gewerkschaften zum Thema Krieg und Frieden bereits in Bewegung gekommen ist und mehr geschieht, als wir in unserer politischen Ungeduld häufig vermuten. So hat die GEW Bayern eine Popularklage gegen das „Bundeswehrförderungsgesetz“ auf den Weg gebracht. Der ver.di-Landesbezirk Bayern und der GEW-Landesbezirk Bayern haben die Initiative „Soziales rauf, Rüstung runter“ ins Leben gerufen und im letzten Jahr eine erste Demonstration gegen Aufrüstung und Sozialabbau in München organisiert.
Die IG Metall Hanau-Fulda, der ver.di-Bezirk Stuttgart und die IG Metall Salzgitter haben große gewerkschaftliche Friedenskonferenzen organisiert. Die Gewerkschaftsjugend hat sich gegen die Wehrpflicht ausgesprochen – und mit ihr die GEW Berlin, die GEW Hamburg und der DGB Köln. „Nein zu Aufrüstung und Sondervermögen“ fordern die GEW Berlin, der DGB Köln, die Frauenkonferenz des DGB-Bezirks Baden-Württemberg, die DGB-Jugend Hessen-Thüringen, die GEW Hamburg, die GEW Bayern und die Jugend-Vertrauensleute im Volkswagen-Werk Kassel.
Die Junge BAU Hamburg und die EVG-Jugend Baden-Württemberg fordern „Ausbildung statt Aufrüstung“. Der ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg hat zur Friedenskonferenz am 3. Oktober in Stuttgart aufgerufen, und die Landesbezirksvorsitzende hat dort auch gesprochen. Die Betriebsrätevollkonferenz der H&M-Betriebsräte hat vor einigen Monaten ein kraftvolles Statement gegen den Krieg abgegeben – ebenso wie die drei mutigen Straßenbahnfahrer in München, die sich weigern, die Menschen in tarnfleckfarbenen Straßenbahnen durch die Innenstadt zu chauffieren.
Die Delegierten der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm haben einen Beschluss gefasst, in dem sie den Vorstand der IG Metall auffordern, sich wahrnehmbar intern und öffentlich zur Friedensfrage zu positionieren und entsprechende Friedensinitiativen zu unterstützen. „Schluss mit dem Krieg in Palästina“ sagen die GEW Berlin, die DGB-Jugend Hessen-Thüringen, die GEW Hamburg, der GEW-Hauptvorstand und auch der DGB-Bundesvorstand. Last but not least: In einer Presseerklärung des ver.di-Bundesvorstands wird das Fünf-Prozent-Ziel der NATO mit folgenden Worten kritisiert: „Es ist in keiner Weise akzeptabel, dass sich die neue Bundesregierung gemeinsam mit der Mehrheit der NATO-Staaten der Forderung von Donald Trump unterwirft. Noch unverständlicher ist, dass die Bundesregierung auf Grundlage der aktuellen Einigung zum neuen Bundeshaushalt dieses Ziel sogar noch vorzeitig erreichen will (…) Das ist eine Summe, die nicht aus dieser Welt ist“.
Mit all diesen Beschlüssen bewegen wir uns auf dem Boden der Satzung des DGB. Denn dort heißt es: „Der Bund und die in ihm vereinigten Gewerkschaften (…) treten für eine allgemeine und weltweite kontrollierte Abrüstung, für die Verwirklichung und Erhaltung des Friedens und der Freiheit im Geiste der Völkerverständigung ein“.
Mit diesen Beschlüssen können wir arbeiten. Sie zeigen: Es bewegt sich etwas in unseren Gewerkschaften. Die Debatte über Krieg und Frieden hat Fahrt aufgenommen. Natürlich bläst uns der Gegenwind der Kriegstreiber noch immer kalt ins Gesicht. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, der jammernde Rufer im Wind zu sein. Unsere Aufgabe ist es, wenn Sturm aufkommt, die Segel richtig zu setzen, um mit dem Rückenwind unserer Geschichte die Vorbereitung des nächsten großen Krieges zu verhindern.