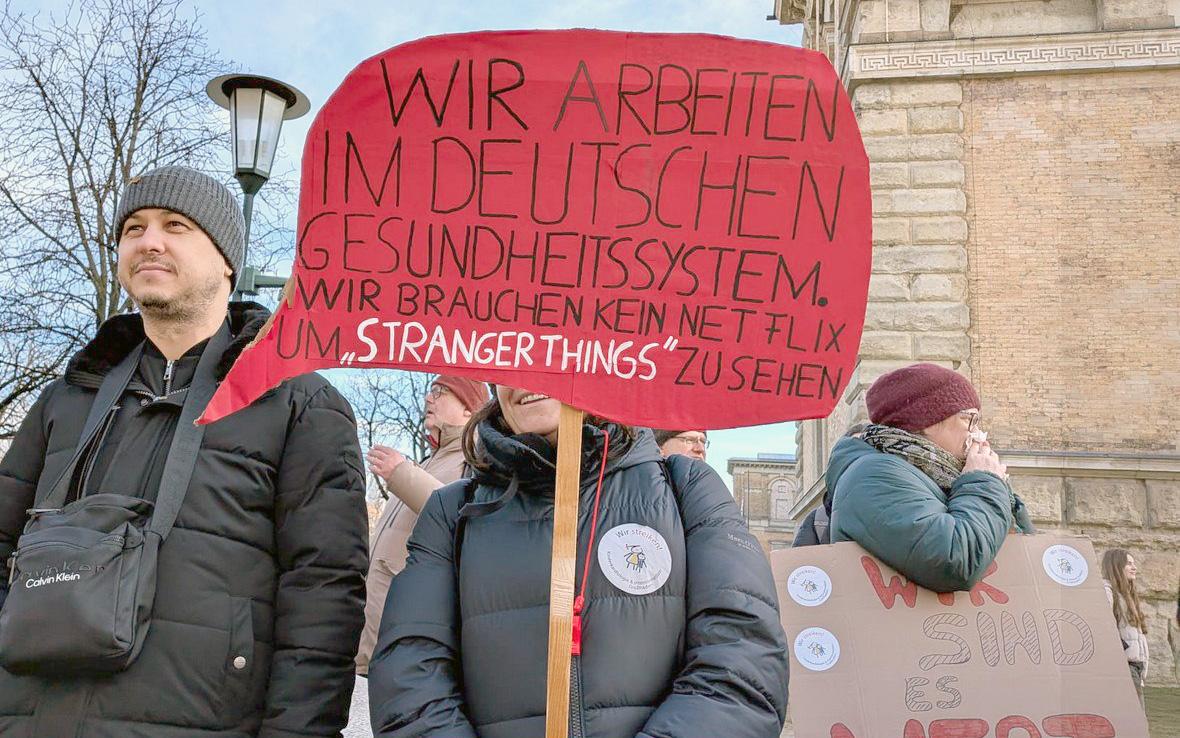Ist Deindustrialisierung ein Hirngespinst und sind Massenentlassungen und Werksschließungen nur Panikmache der Gewerkschaften? Auf den ersten Blick könnte man angesichts der jüngsten Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) diesen Eindruck gewinnen: So ging die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen im April gegenüber dem Vormonat um 36.000 auf 2,931 Millionen zurück. Die Arbeitslosenquote sank von 6,4 auf 6,3 Prozent.
Doch die Statistik ist trügerisch: Betrachtet man den Arbeitsmarkt nach Branchen, so zeigt sich, dass die Entwicklung der Gesamtzahl der Arbeitslosen in den letzten Monaten nur durch die Schaffung neuer Jobs im Dienstleistungssektor – im Öffentlichen Dienst und Gesundheitswesen sowie in der Pflege und Sozialberufen – relativ moderat blieb. Ganz anders in der Industrie: Hier wurden im Dezember 2024 im Jahresvergleich 105.000 Stellen abgebaut. Im Januar 2025 waren es bereits 121.000 und im Februar 125.000 Stellen. Zum Vergleich: Im Februar 2024 hatte die Zahl der Industriearbeitsplätze im Vergleich zum Vorjahr „nur“ um 32.000 abgenommen.
Ein Trend, der durch eine im Februar veröffentlichte Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) bestätigt wird. Demnach wurden allein 2024 rund 70.000 Industriearbeitsplätze abgebaut. Weitere 100.000 dürften im laufenden Jahr hinzukommen. Neben den Elektrotechnik- und Maschinenbau-Unternehmen ist vor allem die Automobil-Industrie betroffen. Dort wird sich der Stellenabbau im laufenden Jahr auf rund 40.000 Stellen verdoppeln, so die Prognose der Studie.
Neben Massenentlassungen und Standortschließungen bringt die Kapitalseite in jüngster Zeit vermehrt Produktionsverlagerungen ins Spiel. So hatte Mercedes-Benz im Februar angekündigt, die Kapazitäten in Deutschland auf insgesamt 900.000 Fahrzeuge zu reduzieren und dafür mehr Autos im ungarischen Werk in Kecskemét zu bauen. Dort seien die Kosten um rund 70 Prozent günstiger als in Deutschland, begründete Finanzchef Harald Wilhelm die Pläne des Autobauers.
Dies ist nur die Spitze des Eisbergs. Laut einer Studie des Finanzinstitutes A&M im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) plant jedes fünfte Industrieunternehmen für dieses Jahr weitere Verlagerungen. Im Chemie- und Pharmasektor ist es sogar ein Viertel aller Betriebe. Dabei werden nicht nur Produktionskapazitäten ins Ausland verlagert: „Auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden künftig eher in andere Länder fließen, wo es eben auch qualifizierte Fachkräfte gibt, aber die Rahmenbedingungen deutlich besser ausfallen“, so die A&M-Analysten.
Die dahinterstehende Strategie der Kapitalseite ist klar: Zum einen soll so der Druck auf die Belegschaften und ihre Gewerkschaft erhöht werden, Zugeständnisse bei Löhnen und Arbeitszeit zu machen. Zum anderen wird das neue Personal im Berliner Regierungsviertel angehalten, bei dem von Friedrich Merz angekündigten „Politikwechsel“ mehr Tempo vorzulegen.
Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes „Die Familienunternehmer“, hat die Erwartungshaltung auf den Punkt gebracht: Der Koalitionsvertrag enthalte zwar einige Lichtblicke – etwa die Digitalisierung der Verwaltung oder den Plan, Personal in der Verwaltung abzubauen. Große Vorhaben wie die Reduzierung der Körperschaftsteuer kämen jedoch nur in Trippelschritten und letztlich viel zu spät.
Auch Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, drängt zur Eile: „Wenn jetzt schnell das Lieferkettengesetz aufgehoben wird und ebenso schnell was bei den Abschreibungsregelungen sowie beim Industriestrompreis passiert – dann könnte das Land noch vor der Sommerpause einen Kurswechsel einläuten. Auch ein Moratorium bei den Sozialbeiträgen wäre ganz einfach zu beschließen. Das alles würde schnell Verlässlichkeit liefern.“ Danach müsse man an die Strukturen ran: „Pflege, Rente, Krankenkassen, demografischer Wandel – da bleiben große Herausforderungen.“ Widerspruch hierzu ist wohl weder von Merz noch von Klingbeil zu erwarten.