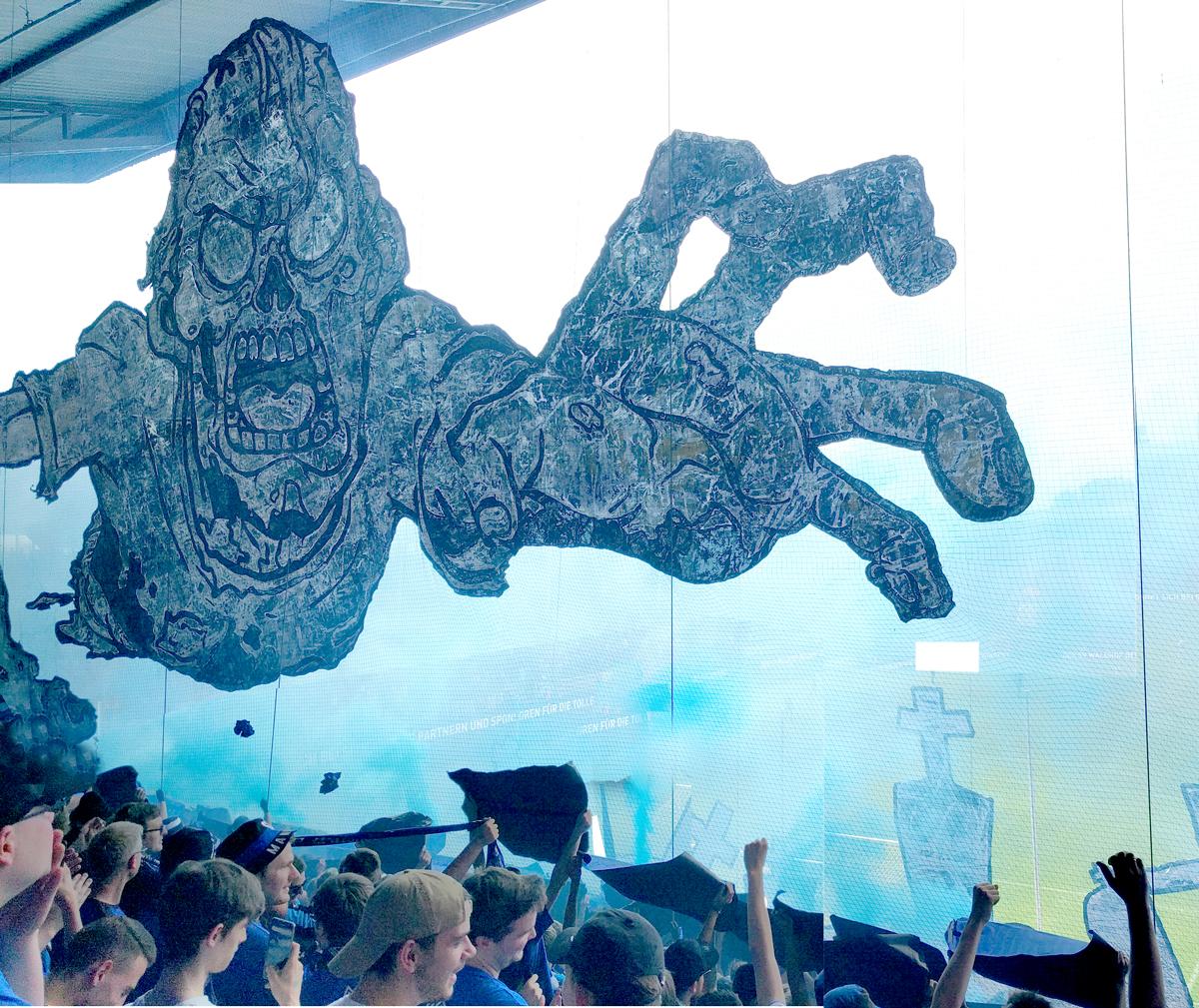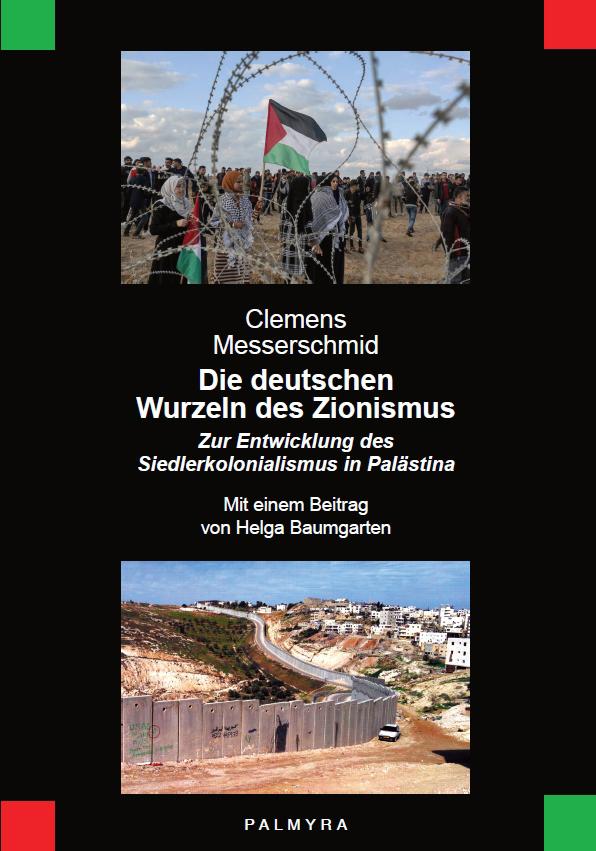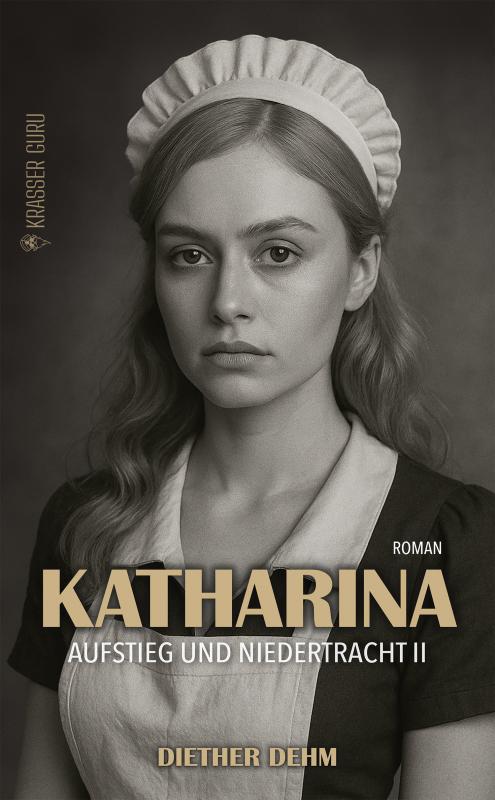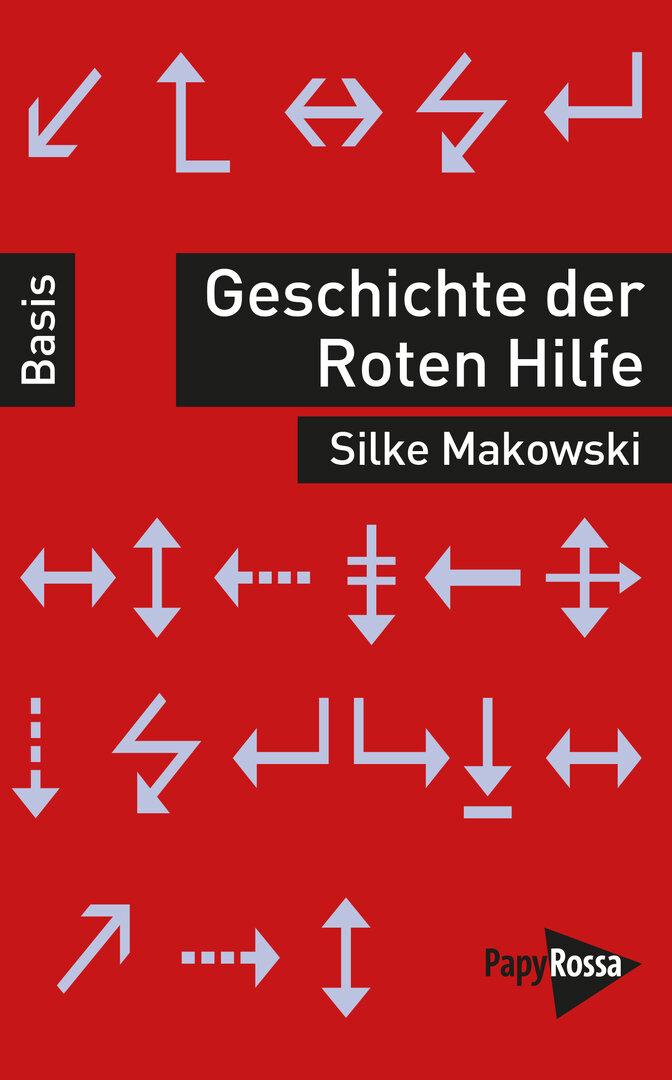Regierungsoffiziell heißt es: „Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein.“ Im Mittelpunkt stehen dabei die Land-, Luft- und Seestreitkräfte der Bundeswehr. „Kriegstüchtigkeit“ geht aber deutlich über sie hinaus. Im äußersten Fall mit unmittelbaren Konsequenzen für Teile der Bevölkerung unseres Landes. Das hat mit der Heimatschutzdivision zu tun.
Sie wurde mit Wirkung vom 1. April 2025 in Dienst gestellt. Sollstärke: 6.000 Mann. Eine ihrer wesentlichsten Aufgaben ist in den Darstellungen meist nur versteckt zu finden: Der Einsatz im Innern bei angespannten oder gewaltsamen Auseinandersetzungen größeren Maßstabs. Diese Aufgabe ist nicht neu. Sie kann aber bei sich zuspitzenden sozialen Verwerfungen im Lande in der Folge der ansonsten nicht bezahlbaren Hochrüstung durch die „Kanonen statt Butter“-Politik ein höheres Maß an Aktualität gewinnen.
Die Heimatschutzdivision ist mit den früher so bezeichneten „Territorialstreitkräften“ vergleichbar. Ihre Einheiten bestehen ganz überwiegend aus gedienten Reservisten. Die militärische Ausrüstung ist in speziellen Depots eingelagert, weswegen oft von „Geräteeinheiten“ gesprochen wird. Zu den Aufgaben der Heimatschutzdivision formuliert das Bundesverteidigungsministerium unter anderem:
- Unterstützung ziviler Behörden bei Naturkatastrophen oder anderen Notlagen;
- Aufmarschunterstützung für NATO-Kräfte in einem Krisenfall;
- Erhalt der inneren Sicherheit durch verstärkte Kooperation mit Polizei und Katastrophenschutz im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten.
Für ein ruhiges Hinterland
Früher fasste man den Gesamtkatalog unter „Gewährleistung der Operationsfreiheit für die auf dem Territorium der BRD stationierten NATO-Streitkräfte“ zusammen. Die NATO-Streitkräfte sollten an der Front so frei und unterstützt wie möglich handeln können. Dafür sollte das Territorialheer sorgen, indem es in ihren rückwärtigen Räumen militärisch alles Notwendige sicherstellt.
Ein wesentlicher Bestandteil war – und ist bis heute – die „Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsgewalt“ im Zusammenspiel mit dem Bundesgrenzschutz (BGS), heute Bundespolizei, den Polizeien der Länder, besonders den in geschlossenen Einheiten handelnden Bereitschaftspolizeien, und den Strukturelementen der Zivilverteidigung; all dies in einem System, das Zivil-Militärische Zusammenarbeit (ZMZ) genannt wird.
Als der frühere Hauptgegner Sowjetunion als Großmacht dauerhaft ausgeschaltet schien und sich der „Wertewesten“ als ökonomisch und politisch stabil wähnte, war all das in den Hintergrund getreten. Die NATO und ihre Hauptmächte, auch Deutschland, sahen den Schwerpunkt zur Durchsetzung ihrer Interessen weit über das Vertragsgebiet nach Artikel 6 des Nordatlantikvertrages hinaus. Für ihre Streitkräfte bedeutete das: „Out of area“. Dafür stehen unter anderem Jugoslawien, Afghanistan, Irak oder Libyen. Die „Landes- und Bündnisverteidigung“ rückte in den Hintergrund und das bundesdeutsche Territorialheer wurde de facto Schritt für Schritt aufgelöst.
Neuauflage des Kalten Krieges
Das änderte sich fundamental mit dem nationalistischen Putsch in der Ukraine Ende 2013/Anfang 2014, dem von Kiew im April 2014 mit dem Überfall auf die Donbassgebiete begonnenen Krieg in der Ukraine und dem Eingreifen Moskaus in den Krieg am 24. Februar 2022. All dies gerade auch vor dem Hintergrund des allseitigen, besonders auch militärischen Wiederaufstiegs Russlands, der immer engeren Allianz des Landes mit der Volksrepublik China als der mit den USA ebenbürtigen Weltmacht und eines zunehmend selbstbewussteren, in großen Teilen antiwestlichen globalen Südens.
Die Hoffnung im Westen auf eine gänzliche Wiederherstellung seiner unter Führung der USA dominierten unipolaren Welt schwand. Sie gegen die weltweite Multipolarität doch noch durchzusetzen, verlangte eine entschiedene – auch militärische – Frontstellung gegenüber (zunächst) Russland, was sich im Ukraine-Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland niederschlägt. Das war der Ausgangspunkt dafür, dass der Nordatlantikblock sein neues „Strategisches Konzept der NATO 2022“ beschloss. Es bedeutete die komplette Neuauflage des Kalten Krieges und massive Hochrüstung.
Vorrang für die „Ostfront“
Von der neuen NATO-Militärstrategie ausgehend gab es auch für die Bundeswehr einschneidende Konsequenzen. Sie stehen in den „Verteidigungspolitischen Richtlinien 2023“: „Die Bundeswehr wurde auf weltweite Einsätze … ausgerichtet. (…) Das müssen wir umkehren. (…) Damit ist zeitgemäße Landes- und Bündnisverteidigung für die Bundeswehr strukturbestimmend.“ Das bedeutet für die NATO-unterstellten Truppen, dass die Einsatzorientierung für die „Ostfront“ absoluten Vorrang genießt. „Out of area“ ist nachrangig geworden.
Die nun wieder absolut prioritäre Orientierung gegen den Feind auf der anderen Seite der NATO-Ostgrenzen, also Russland und mit ihm Belorussland, hat auch die Konsequenz der umfassenden Wiederherstellung der „Territorialverteidigung“, nunmehr in Gestalt der Heimatschutzdivision. Die oben skizzierte Gewährleistung der Operationsfreiheit für die Feldstreitkräfte erhält wieder ihre frühere Bedeutung für die Kriegführung an der Front – durch entsprechendes militärisches Handeln in den rückwärtigen Räumen. Damit hat auch die innere Funktion der Streitkräfte wieder an Gewicht gewonnen. Sie ordnet sich ein in ein Gesamtkonzept, das unter dem teilweise auch heute noch gebräuchlichen Begriff „Gesamtverteidigung“ gefasst wird.
Operationsplan Deutschland
Die Ausführung dieses Konzepts findet sich heute in dem 1000-seitigen geheimen „Operationsplan Deutschland“ (OPLAN DEU) wieder. Zu seinen Zielen heißt es dort unter anderem: „Er trifft damit die planerische Vorsorge dafür, dass im Krisen- und Konfliktfall nach erfolgter politischer Entscheidung zielgerichtet und im verfassungsrechtlichen Rahmen gehandelt werden kann.“
Zur Umsetzung dessen wurde zum 1. Oktober 2024 das Operative Führungskommando der Bundeswehr gebildet mit Standorten in Berlin und Potsdam-Geltow. Ihm nachgeordnet sind für die Bundesländer 16 Landeskommandos. Die Aufgaben des Operativen Führungskommandos werden offiziell wie folgt zusammengefasst: „Der Schwerpunkt liegt in der Planung, Führung und Koordination von Operationen der Bundeswehr innerhalb Deutschlands. Der OPLAN DEU umfasst den Einsatz der Bundeswehr in Deutschland in Frieden, Krise und Krieg und damit die Bandbreite von Heimatschutz bis zur nationalen territorialen Verteidigung.“

Diese Aufgabe kann durch die territorialen Truppen, also die Heimatschutzdivision, nicht allein bewältigt werden. Es werden dazu auch die Formationen der Zivilvereidigung herangezogen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Technische Hilfswerk mit seinen etwa 90.000 Mitarbeitern. Hinzuzurechnen sind vor allem die Feuerwehren und die Hilfsdienste wie das DRK, der Arbeiter-Samariter-Bund, der Malteser Hilfsdienst, die Johanniter-Unfall-Hilfe oder die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Für die Zivilverteidigung gibt es mit der „Konzeption Zivile Verteidigung (KZV)“ vom 24. August 2016 das Grundsatzdokument.
Zivil-Militärische Zusammenarbeit
Entscheidend für die Umsetzung des engen Zusammenspiels zwischen den Streitkräften und den Formationen im zivilen Bereich im Inland ist das Konzept der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit (ZMZ). Zu deren Aufgaben heißt es bundeswehroffiziell: „Die maximale zivile Unterstützung ist beim OPLAN DEU ein entscheidender Faktor.“ Im „Krisen- und Verteidigungsfall“ sei die Bundeswehr „auf zivilgesellschaftliche und zivilgewerbliche Hilfe angewiesen.“ Der OPLAN DEU bündele die zentralen Anteile der Landes- und Bündnisverteidigung in Deutschland mit den dafür erforderlichen zivilen Unterstützungsleistungen.
Grundlage dafür wiederum ist das „GRÜNBUCH ZMZ 4.0“ zur „Zivil-Militärischen Zusammenarbeit 4.0 im militärischen Krisenfall“ vom 30. Januar 2025. Es verankert noch einmal ganz klar, dass die „Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen“ die Hauptaufgabe der Zivilverteidigung und der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit ist.
Ausgangspunkt für die Bundeswehr und konkret für die Heimatschutzdivision bei der „Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen“, das heißt für den Einsatz nach innen, ist der Artikel 87a Absatz 4 Grundgesetz. Er lautet im Hauptsatz: „Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz (heute Bundespolizei – K. S.) nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen.“ Wie schnell man „militärisch bewaffnete Aufständische“ erkennen kann, muss hier sicher nicht skizziert werden.
Notstandsverfassung von 1968
Der genannte Grundgesetzartikel ist der Kern des Siebzehnten Gesetzes zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 24. Juni 1968, das 28 der 146 Artikel neu fasste und allgemein als Notstandsverfassung bekannt ist. Ergänzend sei eingefügt, dass es neben der Notstandsverfassung noch eine ganze Reihe sogenannter einfacher Notstandsgesetze gibt, wozu in über 40 geheimen „Schubladengesetzen“ auch Regelungen zu Internierungslagern für Oppositionelle gehört haben sollen. Mit ihren Bestimmungen sind die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der Bundeswehr im Innern gegeben, und zwar beim offiziell so bezeichneten Inneren Notstand. Und vor allem auch dies verbirgt sich hinter dem schon zitierten letzten Punkt der Aufgaben der Heimatschutzdivision: „Erhalt der inneren Sicherheit durch verstärkte Kooperation mit Polizei und Katastrophenschutz im Rahmen der verfassungsrechtlichen Möglichkeiten.“
Die Vorkehrungen für den inneren Einsatz der Streitkräfte sind nicht neu. Vielmehr wurden sie in den zurückliegenden Jahrzehnten in verschiedenen Übungen bereits erprobt. Hinzu kommt, dass der bundesdeutsche Staat eine sehr niedrige Schwelle eingezogen hat, bei deren Überschreiten seine Machtinstrumente schon zum Einsatz gelangen können. Gemeint ist: Spätestens seit 1952 sind politische und Generalstreiks in der Bundesrepublik Deutschland faktisch verboten. Welchen Spielraum man sich einräumte, zeigte das im Herbst 1963 geäußerte Wort von Innenminister Hermann Höcherl: „Die Beamten können nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen.“
Gegen die eigenen Landsleute?
Die politische Führung geht selbstverständlich davon aus, dass es zu einem Einsatz von Militär im Innern, besonders in Friedenszeiten, möglichst nicht kommen sollte: Streitkräfte sind in Auftrag, Ausbildung, Ausrüstung und psychologischer Verfasstheit auf den Kampf gegen den äußeren Gegner ausgerichtet; ihre Eignung gegen den „inneren Feind“ ist begrenzt und wird deshalb nur im äußersten Notfall in Betracht gezogen.
Die „erste Staffel“ gegen den inneren Gegner sind deshalb die Polizeikräfte. Erst wenn sie in ihrer Gesamtheit gewaltsame innere Konfliktfälle nicht beherrschen, soll auf das Potenzial der Heimatschutzdivision zurückgegriffen werden. Sie besteht aus sechs Heimatschutzregimentern mit Standorten in Roth (Bayern), Münster (Nordrhein-Westfalen), Nienburg (Niedersachsen), Alt Duvenstedt (Schleswig-Holstein), Ohrdruf (Thüringen) und Möckern/Altengrabow (Sachsen-Anhalt). Diese sind weiter untergliedert in Heimatschutzkompanien. Das Heimatschutzregiment 1 in Bayern besteht zum Beispiel aus sieben Heimatschutzkompanien mit verschiedenen Standorten.
Hoffentlich tritt nie ein, was der frühere Bundespräsident Lübke in anderem Zusammenhang am 11. Oktober 1961 in einer Rede äußerte: „Der Soldat der Bundeswehr kann in die Lage kommen, einmal gegen seine eigenen Landsleute kämpfen zu müssen.“
Zum Vergleich: Die NVA der DDR hatte ausschließlich einen Auftrag nach außen. Im Artikel 7 Absatz 2 der DDR-Verfassung vom 7. Oktober 1974 hieß es: „Die Nationale Volksarmee und die anderen Organe der Landesverteidigung schützen die sozialistischen Errungenschaften des Volkes gegen alle Angriffe von außen.“ Deshalb, getreu der Verfassung und in voller Übereinstimmung mit der politischen Führung des Landes, blieb die NVA 1989/90 in ihren Kasernen. Wie oft in der Weltgeschichte kam es vor, dass das mächtigste Machtinstrument des Staates nicht gewaltsam gegen die Liquidierung des eigenen Staats- und Gesellschaftssystems und von sich selbst einschritt? So viel zum Beitrag der einzigen deutschen Volks- und Friedensarmee zu dem von anderen nur für sich selbst beanspruchten Prädikat der „Friedlichen Revolution“.