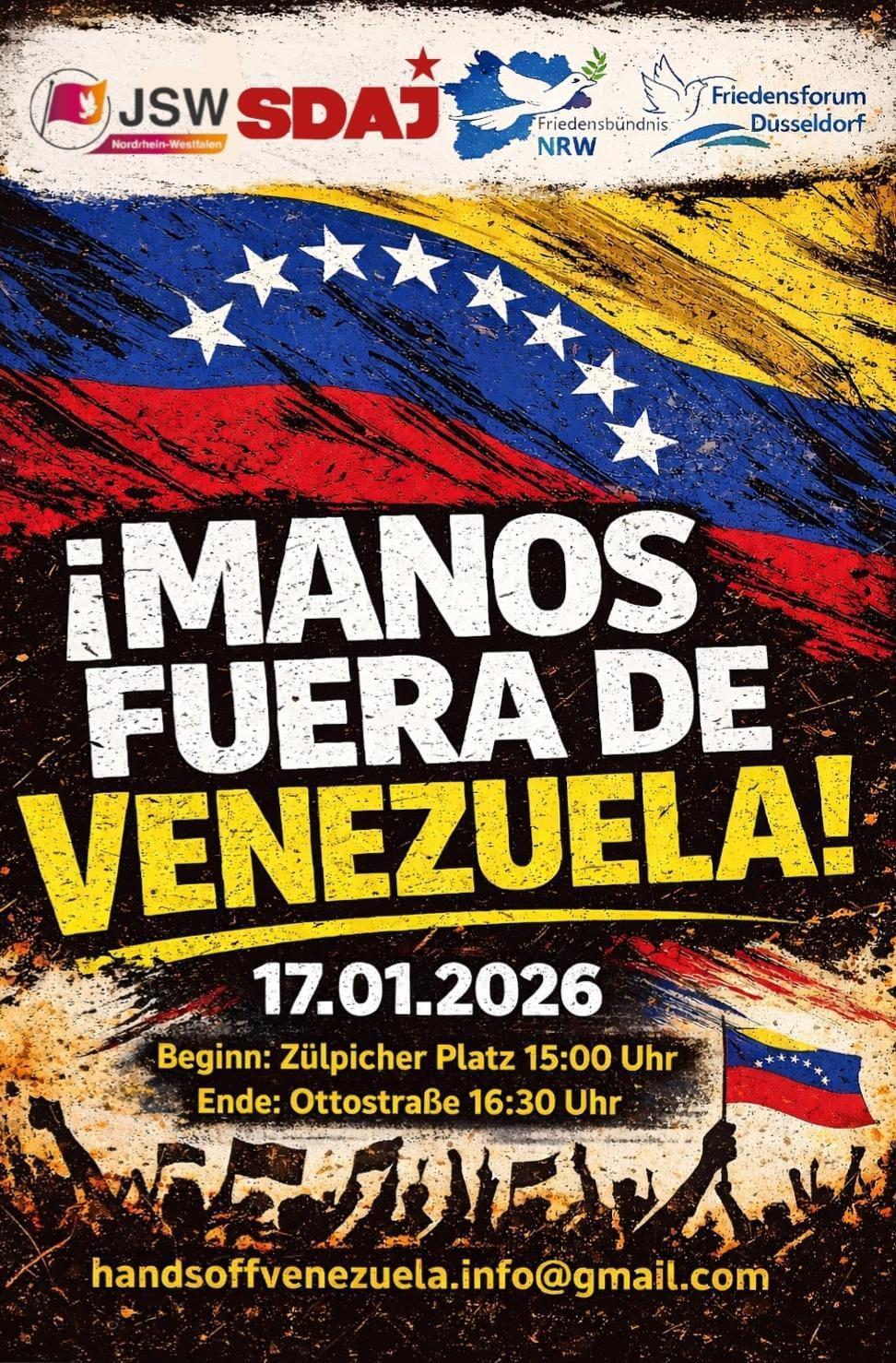Auf der Kundgebung zum Antikriegstag des DGB Mittelhessen am 1. September hat auch der DGB-Gewerkschaftssekretär Ulf Immelt gesprochen. Immelt ging darin auf die Angriffe der Regierung auf die Reste des Sozialstaats ein und widerlegte Totschlagargumente, die Politiker nutzen, um umgekehrte Rüstungskonversion als Fortschritt zu verkaufen. Wir dokumentieren seine Rede in voller Länge:
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich bin in der vergangenen Woche nach dem Fußball beim Bier gefragt worden: Warum engagierst du dich als Gewerkschafter am Antikriegstag? Habt ihr bei euren Hauptaufgaben Kampf für gute Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit nicht schon genug zu tun?
Tatsächlich geht uns die Arbeit dort nicht aus. Die Deindustrialisierung schreitet voran. Allein im vergangenen Jahr sind über 100.000 Arbeitsplätze in der Industrie vernichtet worden, auch in unserer Region. Die Schließungen des Continental-Standorts und des Stahlwerks in Wetzlar sind die prominentesten, aber nicht die einzigen Beispiele.
Hinzu kommen der Kampf um Tarifbindung, die Angriffe von Politik und Wirtschaft auf den 8-Stunden-Tag und die Infragestellung des Sozialstaats. Doch was hat das alles mit Aufrüstung und Krieg zu tun?
Von Clemens Fuest stammt das Zitat: „Kanonen und Butter – das wäre schön, wenn das ginge. Aber das ist Schlaraffenland. Das geht nicht. Sondern Kanonen ohne Butter.“ Ehrlicher kann man dreieinhalb Jahre „Zeitenwende“ nicht zusammenfassen. Die Logik, die hinter den Äußerungen des Präsidenten des arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstituts ifo steckt, ist unmissverständlich: Jeder Euro, der in Soziales, Gesundheit oder Bildung investiert wird, fehlt für Aufrüstung und Krieg. Jeder Cent, der in den Sozial- oder Bildungsetat fließt, schmälert die Profite von Rheinmetall und anderen Rüstungsschmieden.
Das bedeutet auch geringere Dividenden für diejenigen, die an den Börsen auf die Fortsetzung des Mordens in der Ukraine, in Palästina und an zahlreichen weiteren Kriegsschauplätzen wetten.
Das erklärt auch, warum neoliberale Think-Tanks und Parteien sowie die dahinterstehenden Kapitalverbände an der Legende vom ausufernden Sozialstaat und überbordender Bürokratie stricken. So behauptete beispielsweise schon 2024 Bernd Raffelhüschen, Lobbyist der Initiative „Neue soziale Marktwirtschaft“: Deutschland baue seinen Sozialstaat seit Jahrzehnten immer weiter aus. Daher sei es auch unproblematisch, im Sozialbereich zu sparen.
Ähnlich hatte sich auch der damalige Finanzminister Christian Lindner (FDP) geäußert und für ein dreijähriges Moratorium der Sozialausgaben und ein Einfrieren der Rente plädiert.
Mit der neuen Regierung aus Union und SPD ist es nicht besser geworden. Im Gegenteil: So soll das Bürgergeld in eine „neue Grundsicherung“ mit verbindlicheren Anforderungen und Sanktionen radikal umgebaut werden. Selbst 100-Prozent-Sanktionen sollen möglich sein. Der Beifall der Unternehmerverbände folgte prompt.
Friedrich Merz, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die sogenannten Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer und Veronika Grimm behaupten, der Sozialstaat sei „nicht mehr finanzierbar“. Die Liste der Totengräber des Sozialstaats ließe sich beliebig fortsetzen.
Von Hans Christoph Atzpodien, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, stammt das Zitat: „Anstatt einen volkswirtschaftlichen Schaden durch den Abschwung der Auto-Konjunktur zu beklagen, sollten wir versuchen, Produktionseinrichtungen und vor allem Fachkräfte aus dem Automobilsektor möglichst verträglich in den Defence-Bereich zu überführen.“ Im Klartext: Wenn Kolleginnen und Kollegen ihre Jobs in der Automobil- und Zulieferindustrie verlieren, sollen sie ihre Arbeitskraft stattdessen einfach in der Rüstungsindustrie verkaufen.
Der Rüstungsboom rettet aber keine industriellen Arbeitsplätze, und ein Jobwechsel in ein Rüstungsunternehmen stellt für einen relevanten Teil der über sieben Millionen Industriearbeiter keine reale Perspektive dar. Dafür ist die Rüstungs-Branche schlicht zu klein.
Um dies zu verdeutlichen: Aktuell sind laut Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft bei den Endherstellern an deutschen Standorten circa 60.000 Menschen beschäftigt. Einschließlich der Zulieferer kommt das arbeitgebernahe Institut auf rund 150.000 Beschäftigte.
Ganz nebenbei hat sich der gigantische Rüstungsetat bei Tarifauseinandersetzungen – nicht nur in Bund, Länder und Kommunen – im wahrsten Sinne des Wortes als „Totschlagargument“ erwiesen. Wenn das Geld in Aufrüstung gesteckt wird, fehlt es eben für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.
Insbesondere dann, wenn man gleichzeitig auf eine angemessene Besteuerung großer Vermögen verzichtet.
So werden die verteilungspolitischen Spielräume immer enger gemacht. 2028 werden die 100 Milliarden Euro aus dem ersten „Sondervermögen Bundeswehr“ vollständig ausgegeben sein. Anschließend müssen gemäß dem Zwei-Prozent-Ziel dann pro Jahr gut 20 Milliarden Euro zusätzlich aus dem regulären Bundeshaushalt in den Rüstungsetat gepumpt werden.
Ab 2031 steht dann auch die Tilgung des 100-Milliarden-Euro-Kredits auf der Tagesordnung. Diese Kriegskredite werden dann zulasten von allem anderen zurückgezahlt werden müssen.
Von der SPD war vor der Bundestagswahl zu hören, man dürfe die äußere und die soziale Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen. Spätestens mit der Modifikation des Zwei-Prozent-Ziels durch einen eigentlich schon abgewählten Bundestag zu einem Blankoscheck für Aufrüstung ohne Limit nach oben dürfte auch der fromme Wunsch endgültig wie eine Seifenblase geplatzt sein.
Um dies zu verdeutlichen: Auf dem NATO-Gipfel im Juni in Den Haag verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten, das Fünf‑Prozent‑Ziel zu erreichen. Der Fortschritt soll im Jahr 2029 überprüft und 2035 vollständig umgesetzt sein. Für die Bundesrepublik würde das bedeuten, dass fast 50 Prozent des gesamten Bundeshaushalts für Krieg und Rüstung ausgeben werden müssen. Die Folgen für den Sozialstaat, für Bildung und Gesundheit, aber auch für die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten kann man sich ausmalen.
Schon im Mai erklärte Kanzler Friedrich Merz hierzu bei der traditionellen Jahreskonferenz des Wirtschaftsrats der CDU unter Applaus der anwesenden Unternehmer und Manager, mit einer Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance lasse sich der Wohlstand nicht halten.
Ende Juli legte die frisch gebackene Wirtschaftsministerin Katherina Reiche nach. Die Lebensarbeitszeit müsse steigen. Der demografische Wandel und die weiter steigende Lebenserwartung machten das „unumgänglich“. Schon jetzt seien die sozialen Sicherungssysteme überlastet.
Daher reichen nach Meinung der Ministerin die im Koalitionsvertrag vereinbarten Reformen nicht aus. „Die Kombination aus Lohnnebenkosten, Steuern und Abgaben machen den Faktor Arbeit in Deutschland auf Dauer nicht mehr wettbewerbsfähig“, so die CDU-Politikerin.
Zuspruch erhielt sie umgehend von Rainer Dulger. Deutschland müsse wieder mehr arbeiten, damit unser Wohlstand auch morgen noch Bestand habe, so der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).
Darüber hinaus stehen „effizientere Verwendung von Sozialleistungen, der Abbau übermäßiger Bürokratie und eine spürbare Reduzierung der Sozialabgaben“ ganz oben auf der Wunschliste des Unternehmerverbands. „Wir müssen diesen Sozialstaat dringend reformieren. Wir können uns nicht mehr alles leisten, was wir uns wünschen“, lautet die unmissverständliche Botschaft Dulgers in Zeiten der „Kriegstüchtigkeit“ an das politische Personal.
Im krassen Gegensatz hierzu steht der jüngste Bericht des Europarats zur Sozialpolitik Deutschlands. Das hohe Maß an Armut und sozialer Benachteiligung stehe in keinem Verhältnis zum Reichtum des Landes. Es bedürfe größerer Anstrengung bei der Bekämpfung von Armut, Wohnungslosigkeit und Ausgrenzung, so das vernichtende Urteil der von der EU unabhängigen, 1949 zum Schutz von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaat in Europa gegründeten Institution.
Eine Analyse, die durch Untersuchungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung untermauert wird: Die Staats- und Sozialausgaben sind hierzulande – anders als behauptet – weder besonders hoch, noch zuletzt stark gewachsen.
Betrachtet man die preisbereinigte Entwicklung der öffentlichen Sozialausgaben in den vergangenen 20 Jahren im internationalen Vergleich, zeigt sich: Unter 27 Ländern der Industriestaatenorganisation OECD liegt Deutschland mit einem Zuwachs von insgesamt 26 Prozent auf dem drittletzten Platz.
Weit vorne rangieren Neuseeland mit einem Plus von 136 Prozent, Island mit 131 Prozent und Irland mit 130 Prozent. Selbst in Staaten wie den USA mit 83 Prozent oder Britannien mit 59 Prozent war der Anstieg der Sozialausgaben deutlich höher als in der Bundesrepublik.
Mit einem Anteil der staatlichen Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit aktuell 26,7 Prozent belegt Deutschland ebenfalls keinen Spitzenplatz, sondern liegt laut IMK nur auf Rang 7 der 18 reichen OECD-Länder in Westeuropa und Nordamerika.
Und auch die Staatsquote, die dem Verhältnis zwischen den gesamten staatlichen Ausgaben einschließlich der Sozialausgaben und dem BIP entspricht, ist hierzulande mit 48,2 Prozent geringfügig niedriger als der EU-Durchschnitt von 48,9 Prozent.
Spätestens mit der sogenannten „Zeitenwende“ spielen solche ökonomischen Fakten keine Rolle mehr. Schließlich erweisen sich Aufrüstung und (Stellvertreter-)Kriege als äußerst wirksame Instrumente zur Umverteilung von unten nach oben.
Während der militärisch-industrielle Komplex mit Milliardensummen subventioniert wird, bezahlen dies die Kolleginnen und Kollegen hierzulande mit längerer Arbeitszeit, geringeren Renten und schlechterer Absicherung von Arbeitslosigkeit und Armut – und die Menschen in den Kriegsgebieten häufig mit dem Leben.
Angesichts dieser Entwicklungen wird deutlich: Wer nichts gegen den Rüstungswettlauf tut, wird keine Tarif-, kein Sozial-, keine Industrie- und keine Arbeitsmarktpolitik im Sinne der Beschäftigten machen können. Anders formuliert: Wir dürfen uns die Butter nicht vom Brot nehmen lassen – erst recht nicht für Kanonen!