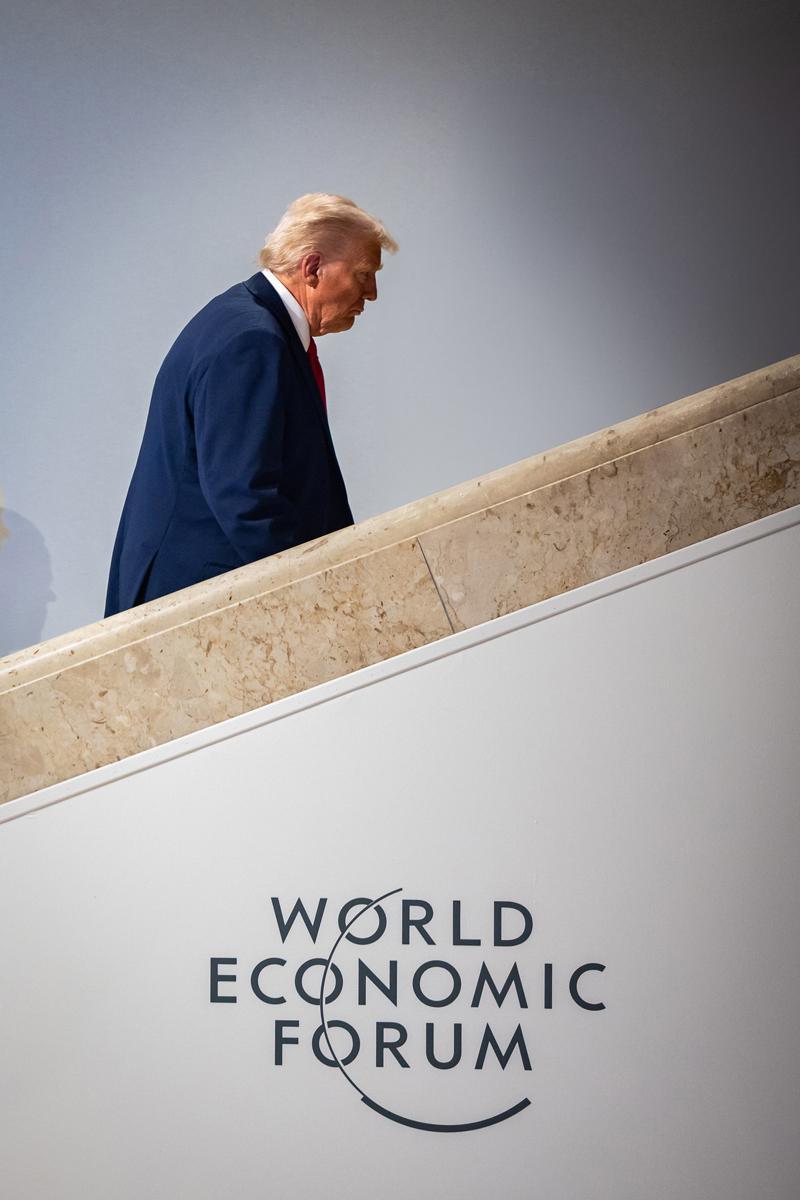Die versteinerten Gesichter während der Rede von US-Vizepräsident James David Vance auf der „Münchner Sicherheitskonferenz“ sagten alles. Die europäischen Zentralen wurden durch die abrupte Wende in der US-Ukraine- und US-Europapolitik kalt erwischt. Die Entsendung des Sondergesandten, General Keith Kellogg, und einige Äußerungen Donald Trumps hatten zunächst Kontinuität signalisiert. Doch dann hatte Trump Kellogg vom Spielfeld genommen und Kontakt zu Präsident Putin aufgenommen. Es war der erste Moskau-Kontakt eines US-Präsidenten seit ... Bitte hier anmelden
ZHJlaSBKYWhyZW4uCgoKClVTLVZlcnRlaWRpZ3VuZ3NtaW5pc3RlciBQZXRlIEhlZ3NldGggaGF0dGUgaW4gc2VpbmVyIGVyc3RlbiBSZWRlIHZvciBkZXIgTkFUTy1Lb250YWt0Z3J1cHBlIHdlc2VudGxpY2hlIE5hcnJhdGl2ZSBkZXIgVWtyYWluZS1GYWxrZW4gYWJnZXLDpHVtdC4gRWluZSBOQVRPLU1pdGdsaWVkc2NoYWZ0IGRlciBVa3JhaW5lIHdpcmQgZWJlbnNvIGF1c2dlc2NobG9zc2VuIHdpZSBlaW5lIFLDvGNra2VociB6dSBkZW4gR3JlbnplbiB2b3IgMjAxNC4gRmFsbHMgZXMgc28gZXR3YXMgd2llIGVpbmVuIOKAnmZyaWVkZW5zc2ljaGVybmRlbuKAnCBNaWxpdMOkcmVpbnNhdHogZW50bGFuZyBkZXIgS29udGFrdGxpbmllLCB3byBhdWNoIGltbWVyIGRpZSBkYW5uIHZlcmxhdWZlbiBtYWcsIGdlYmVuIHNvbGx0ZSwgc2VpIGRhcyBTYWNoZSBkZXIgRXVyb3DDpGVyLiBFaW5lbiBFaW5zYXR6IGRlciBOQVRPIGJlaSBkaWVzZW4g4oCeRnJpZWRlbnN0cnVwcGVu4oCcIGhhdHRlIEhlZ3NldGggZWJlbnNvIGF1c2dlc2NobG9zc2VuIHdpZSBkZW4g4oCeQsO8bmRuaXNmYWxs4oCcLCBhbHNvIGRpZSBBbndlbmR1bmcgZGVzIEFydGlrZWxzIDUgZGVzIE5BVE8tVmVydHJhZ2VzLCBiZWltIEFuZ3JpZmYgYXVmIGRpZXNlIFRydXBwZW4uCgoKCkRpZSBCb3RzY2hhZnQgdm9uIEhlZ3NldGgsIFZhbmNlIHVuZCBUcnVtcCBpc3QgbWVociBhbHMgZGV1dGxpY2guIEVzIHdhciBzbyBlaW5lIEFydCBWaWN0b3JpYSBOdWxhbmQgMi4wOiDigJ5GdWNrIHRoZSBFVeKAnC4gV2VubiBkaWUgZXVyb3DDpGlzY2hlbiBSdXNzbGFuZC1GYWxrZW4gd2llIEJvcmlzIFBpc3Rvcml1cywgRW1tYW51ZWwgTWFjcm9uLCBLZWlyIFN0YXJtZXIgdW5kIFVyc3VsYSB2b24gZGVyIExleWVuIGdlcm4gS3JpZWcgZ2VnZW4gUnVzc2xhbmQgZsO8aHJlbiB3b2xsZW4sIGJpdHRlwqDigJMgYWJlciBvaG5lIHVucy4gSW0gS2xhcnRleHQ6IFN0b2NrdCBldXJlbiBSw7xzdHVuZ3NldGF0IGF1ZiBkaWUgZXJmb3JkZXJsaWNoZSBIw7ZoZSBhdWYsIGluIGRlbiBVU0Egc2luZCBlcyByZWFsIDUsM8KgUHJvemVudC9CSVAsIHVuZCBpaHIga8O2bm50IGRpZSBlcmZvcmRlcmxpY2hlbiBXYWZmZW4gZ2VybiBiZWkgdW5zIGthdWZlbi4KCgoKRGVtIOKAnldlc3RlbuKAnCBnaW5nIGVzIG5vY2ggbmllIHVtIGRpZSBVa3JhaW5lLiBTY2hvbiBkaWUgTmF6aXMgaGFiZW4gZGVuIHVrcmFpbmlzY2hlbiBOYXRpb25hbGlzbXVzIGbDvHIgaWhyZSBad2Vja2UgZ2VudXR6dC4gRGllIFVrcmFpbmUgd3VyZGUgMTkxOCB2b24gZGVuIFNpZWdlcm3DpGNodGVuIMO8YmVyaGF1cHQgbnVyIGdlZ3LDvG5kZXQgYWxzIEJvbGx3ZXJrIGdlZ2VuIGRlbiBCb2xzY2hld2lzbXVzLiBEYXMgUHJvamVrdCBkZXIgTkFUTy1Pc3RlcndlaXRlcnVuZyBhYiAxOTkxIHZlcmZvbGd0ZSBlYmVuc28gZGVuIFp3ZWNrIGRlciBFaW5kw6RtbXVuZyBSdXNzbGFuZHMuIEFscyBrcsO2bmVuZGVuIEFic2NobHVzcyBkaWVzZXMgUHJvamVrdHMgaW5zemVuaWVydGUgZGllIFVTLVJlZ2ltZS1DaGFuZ2UtTWFzY2hpbmUgMjAxNCBkZW4gUHV0c2NoIGluIEtpZXcgdW5kIHLDvHN0ZXRlIGRpZSBVa3JhaW5lIG1pbGl0w6RyaXNjaCB6dXIgc3TDpHJrc3RlbiBNYWNodCBpbiBFdXJvcGEgYXVmLgoKCgpEYXMgWmllbCB3YXIsIHdpZSBlcyBBbm5hbGVuYSBCYWVywq1ib2NrLCBVUy1LcmllZ3NtaW5pc3RlciBMbG95ZCBBdXN0aW4gdW5kIGRpZSBuZXVlIEVVLUF1w59lbmJlYXVmdHJhZ3RlIEthamEgS2FsbGFzIGZyZWltw7x0aWcgZm9ybXVsaWVydCBoYXR0ZW4sIGRpZSBSdWluaWVydW5nIFJ1c3NsYW5kcywgZGFzIEVuZGUgZGVyIFB1dGluLUhlcnJzY2hhZnQgdW5kIGRpZSBBdWZzcGFsdHVuZyBSdXNzbGFuZHMgZW50bGFuZyBzZWluZXIgcmVsaWdpw7ZzZW4gdW5kIGV0aG5pc2NoZW4gR3Jlbnplbi4gRGllc2VzIFByb2pla3QgaXN0IGdlc2NoZWl0ZXJ0LiBSdXNzbGFuZCBoYXQgZGllc2VuIGhpc3RvcmlzY2hlbiBLb25mbGlrdCBnZXdvbm5lbi4gRXMga2FubiB1bmQgd2lyZCBzaWNoIGRpZSBCZWRpbmd1bmdlbiBlaW5lcyBGcmllZGVuc3NjaGx1c3NlcyBuaWNodCBkaWt0aWVyZW4gbGFzc2VuLCBkYSBnaWJ0IGVzIHdlbmlnIFJhdW0gZsO8ciBadWdlc3TDpG5kbmlzc2UuIERpZSBUcnVtcC1SZWdpZXJ1bmcgaGF0IGhldXRlwqDigJMgb2JqZWt0aXYgYmV0cmFjaHRldMKg4oCTIG51ciBub2NoIGRpZSBBdWZnYWJlLCBkZW4gVVMtQsO8cmdlcm4gZGllc2UgZGVtw7x0aWdlbmRlIE5pZWRlcmxhZ2UgenUg4oCedmVya2F1ZmVu4oCcIHVuZCBkaWUgZXJmb3JkZXJsaWNoZW4gS29uc2VxdWVuemVuIGbDvHIgZGFzIOKAnndlc3RsaWNoZSBCw7xuZG5pc+KAnCB6dSB2ZXJrw7xuZGVuLgoKCgpEaWUgVm9yc3RlbGx1bmcsIGRhc3MgbmljaHQg4oCeUHV0aW7igJwsIHNvbmRlcm4gc2llIHNlbGJzdCBhdXMgZGVtIFNwaWVsIHNpbmQsIGRhc3Mgc2llIG51biB3ZWRlciDDvGJlciBlaW5lbiBLcmllZyBub2NoIGVpbmVuIEZlaW5kIHZlcmbDvGdlbiwgaGF0IGbDvHIgU2NobmFwcGF0bXVuZyBpbiBkZW4gRVUtWmVudHJhbGVuIGdlc29yZ3QuIE1pdCBQZXJzb25lbiB3aWUgT2xhZiBTY2hvbHogdW5kIEZyaWVkcmljaCBNZXJ6LCBNYWNyb24sIFN0YXJtZXIgdW5kIHZvbiBkZXIgTGV5ZW4gYW4gZGVyIFNwaXR6ZSB2ZXJmw7xnZW4gZGllIEV1cm9ww6RlciDDvGJlciBrZWluZSByZWFsaXN0aXNjaGUgdW5kIHBlcnNwZWt0aXZpc2NoZSBTdHJhdGVnaWUgZsO8ciBkaWVzZSBMYWdlLiBVbSB3ZWl0ZXJoaW4gR3Jvw59tYWNodCBzcGllbGVuIHp1IGvDtm5uZW4sIGlzdCBkYXMgZXVyb3DDpGlzY2hlIE1pbGl0w6RyIHp1IHNjaHdhY2gsIHp1IHplcnNwbGl0dGVydCwgZXMgZmVobHQgZWJlbnNvIGFuIGVpbmVyIHplbnRyYWxpc2llcnRlbiBLb21tYW5kb3N0cnVrdHVyIHdpZSBhbiBlaW5lciBpbnRlZ3JpZXJ0ZW4gUsO8c3R1bmdzaW5kdXN0cmllLiBFcyByZWljaHRlIGdlcmFkZSBmw7xyIGRpZSBUcml0dGJyZXR0ZmFocmVyZWkgYmVpIGRlciBVUy1LcmllZ3NtYXNjaGluZS4KCgoKU2VpdCBHcsO8bmR1bmcgZGVyIE5BVE8sIDE5NDksIGhhdHRlIGRlciBTYXR6IGRlcyBlcnN0ZW4gR2VuZXJhbHNla3JldMOkcnMsIEhhc3RpbmdzIExpb25lbCBJc21heSwgZ2Vnb2x0ZW46IERpZSBOQVRPIHNlaSBkYSwgdW0gZGllIFJ1c3NlbiBkcmF1w59lbiwgZGllIEFtZXJpa2FuZXIgZHJpbiB1bmQgZGllIERldXRzY2hlbiB1bnRlbiB6dSBoYWx0ZW4uIERlciDigJ5SdXNzZSB2b3IgZGVyIFTDvHLigJwgaGF0dGUgw7xiZXIgc28gbWFuY2hlIEtyaXNlIGhpbndlZ2dlaG9sZmVuLiBOdW4gc3RlaGVuIG5pY2h0IG51ciBkaWUgTmFycmF0aXZlLCBkYXMgRmVpbmRiaWxkLCBzb25kZXJuIGRpZSBnYW56ZSBVUy9FVS3igJ5TaWNoZXJoZWl0c2FyY2hpdGVrdHVy4oCcLCBpbmtsdXNpdmUgZGVyIE5BVE8gc2VsYnN0LCBtZWhyIGFscyBpbiBGcmFnZS4gVmllbGxlaWNodCBzb2xsdGUgbWFuIHNpY2ggZWlubWFsIGFuIEV4LVZlcnRlaWRpZ3VuZ3NtaW5pc3RlciBWb2xrZXIgUsO8aGUgZXJpbm5lcm46IGluIFdpcmtsaWNoa2VpdCBzaW5kIHdpciDigJ52b24gRnJldW5kZW4gdW16aW5nZWx04oCcLgoKCgpJbSBzdHJhdGVnaXNjaGVuIEthbGvDvGwgZGVzIFVTLUltcGVyaXVtcyBoYXQgc2ljaCBkaWUg4oCeV2VzdGxpY2hlIFdlcnRlZ2VtZWluc2NoYWZ04oCcIGltbWVyIG1laHIgdm9uIGVpbmVtIEFrdGl2cG9zdGVuIHp1IGVpbmVyIEJlbGFzdHVuZyBlbnR3aWNrZWx0LiBEaWUgdGV1cmVuIEV1cm9ww6RlciBzaW5kIGF1w59lcnN0YW5kZSwgUmVsZXZhbnRlcyB6dXIgTWFjaHRwcm9qZWt0aW9uIGRlcyBVUy1JbXBlcml1bXMgYmVpenV0cmFnZW4uIFdlaXQgZGF2b24gZW50ZmVybnQsIHNlbGJzdCBlaW5lIHJlbGV2YW50ZSBNYWNodCBpbiBlaW5lbSByZWFsZW4gbWlsaXTDpHJpc2NoZW4gS29uZmxpa3QgenUgc2VpbiwgYmVhbnNwcnVjaGVuIHNlbGJzdCBtaWxpdGFudCBhbnRpcnVzc2lzY2hlIE1pbmktU3RhYXRlbiB3aWUgRXN0bGFuZCBtaXQgZWluZW0gQnJ1dHRvaW5sYW5kc3Byb2R1a3Qgdm9uIG5pY2h0IGVpbm1hbCBlaW5lbSBEcml0dGVsIHZvbiBIYW1idXJnIGRlbiB2b2xsZW4sIHp1ciBOb3QgYXVjaCBhdG9tYXJlbiBTY2h1dHogZGVyIFVTQS4gRsO8ciBkaWUgVHJ1bXAtUmVnaWVydW5nIHN0ZWxsdCBzaWNoIGRhaGVyIGRpZSBGcmFnZSBuYWNoIFNpbm5oYWZ0aWdrZWl0IHVuZCBLb25zZXF1ZW56IGRlciBrb21wbGV0dCBnZXNjaGVpdGVydGVuIEFudGktUnVzc2xhbmQtU3RyYXRlZ2llLiBCaXNsYW5nIGVyc2NoZWludCBkaWUgUsO8Y2trZWhyIHp1bSDigJ5rbGFzc2lzY2hlbiBJbXBlcmlhbGlzbXVz4oCcIGRlcyBiZWdpbm5lbmRlbiAyMC7CoEphaHJodW5kZXJ0cyBhbHMgYmV2b3J6dWd0ZSBWYXJpYW50ZS4gRGllIEVyd2VpdGVydW5nIGRlciBlaWdlbmVuIE1hY2h0YmFzaXMgaW4gUmljaHR1bmcgTm9yZGVuIChHcsO2bmxhbmQsIEthbmFkYSkgdW5kIFPDvGRlbiAoTWV4aWtvLCBLYXJpYmlrLCBQYW5hbWEpLCBkaWUgS29uemVudHJhdGlvbiBhdWYgZGVuIGVudHNjaGVpZGVuZGVuIEdlZ25lciAoQ2hpbmEpIHVuZCBkaWUgU3TDpHJrdW5nIGRlciBlaWdlbmVuIFdpcnRzY2hhZnQgZHVyY2ggZWluZW4gYWdncmVzc2l2ZW4gTWVya2FudGlsaXNtdXMsIGF1Y2ggaW4gUmljaHR1bmcgRVUuIFVuZCBzY2hsaWXDn2xpY2ggZGllIFNjaHfDpGNodW5nIGRlcyBLZXJucyBkZXIgQlJJQ1MsIGRlcyBydXNzaXNjaC1jaGluZXNpc2NoZW4gQsO8bmRuaXNzZXMsIGR1cmNoIGVpbiBndXRlcyBWZXJow6RsdG5pcyB6dSBSdXNzbGFuZC4gRGVyIFJlYWxpc211cyBkaWVzZXIgS29uemVwdGUgc3RlaHQgYXVmIGVpbmVtIGFuZGVyZW4gQmxhdHQuCgoKCk5vY2ggc2luZCBsw6RuZ3N0IG5pY2h0IGFsbGUgTWVzc2VuIGdlc3VuZ2VuLiBXZW5uIGRhcyDigJ5Qcm9qZWt0IFVrcmFpbmXigJwgZsO8ciBUcnVtcCBnZXN0b3JiZW4gaXN0LCB3aXJkIGVzIGbDvHIgaWhuIGthdW0gZWluZSBSb2xsZSBzcGllbGVuLCBvYiBiZWlzcGllbHN3ZWlzZSBPZGVzc2EgcnVzc2lzY2ggd2lyZCBvZGVyIGF1Y2ggbmljaHQuIERlbm5vY2gsIGZha3Rpc2NoIGlzdCBub2NoIG5pY2h0cyBwYXNzaWVydCB1bmQgZXMgZ2lidCBtw6RjaHRpZ2UgR2VnbmVyLiBEaWUgTcOkY2h0aWdzdGVuIGltIFVTLVNpY2hlcmhlaXRzc3RhYXQgd2VyZGVuIGF1ZiBpaHJlIGdpZ2FudGlzY2hlIEJvbmFuemEtVWtyYWluZSBlYmVuc28gd2VuaWcgdmVyemljaHRlbiB3b2xsZW4gd2llIGRpZSBldXJvcMOkaXNjaGVuIEtyaWVnc3RyZWliZXIgYXVmIGlocmVuIGdlbGllYnRlbiBVa3JhaW5lLUtyaWVnLiBRdWVyc2Now7xzc2Ugc2luZCB2b24gYWxsZW4gU2VpdGVuIHp1IGVyd2FydGVuLiBRdWludGVzc2VuejogRGllIGV1cm9ww6Rpc2NoZW4gVm9yemVpZ2VkZW1va3JhdGVuIHNpbmQgZ2VnZW4gVHJ1bXAsIHdlaWwgZXIgZGVuIOKAnkZyaWVkZW4gZGlrdGllcmVu4oCcIHdpbGwuIFdlbm4gZGFzIGtlaW5lIEVycnVuZ2Vuc2NoYWZ0IGlzdC4=