Die Volksrepublik China ist heute eine Weltmacht, die die Vormachtstellung der USA in Frage gestellt hat. Chinesische Firmen bedrohen zudem die Monopolstellung westlicher Konzerne auf dem Weltmarkt. Ständig gibt es neue Berichte über technische Innovationen aus China. Dann schreiben hiesige Medien gerne von einem „China-Schock“. Dabei nehmen sie selbstverständlich die Perspektive des Kapitals ein: Fortschritte beim Laden von E-Autos oder die Weiterentwicklung von sogenannter „Künstlicher Intelligenz“ werden nicht als Fortschritt, sondern vor allem als Bedrohung wahrgenommen, weil sie in China passieren. Warum gerade China sich derart schnell entwickeln kann – diese Frage wird selten gestellt.
Der Wirtschaftsforscher Rainer Land stellt diese Frage in seinem Buch „Chinas gelenkte Marktwirtschaft“. Er stützt sich dabei auf die Wirtschaftstheorie von Joseph Schumpeter und fragt, was die Bedingungen für Entwicklung sind. Zu den Ländern, die nicht zu Innovation fähig waren oder sind, zählt Land sowohl sozialistische Planwirtschaften wie die Sowjetunion und die DDR als auch die gegenwärtigen kapitalistischen Zentren, in denen sich die Finanzmärkte verselbstständigt hätten. Land schreibt: „Im Finanzkapitalismus kehrt sich das Verhältnis um: Die Realwirtschaft wird zum Mittel der Wertsteigerung von Finanzanlagen und zum Schauplatz der Spekulation. Die wirtschaftliche Entwicklung wird fehlgeleitet.“ (S. 73)
Land legt dar, was viele umtreibt: Was hat China, was wir nicht haben? Er geht die Frage aber zunächst andersherum an: Was die Chinesen nicht verfolgen ist eine neoliberale Politik.
Die im Buch dargestellten Informationen zu Chinas Entwicklung sind interessant. Vom theoretischen Ansatz des Autors sollte man sich nicht davon ablenken lassen. Eine Auswertung der Erfahrungen mit der Planwirtschaft wäre hilfreich für das Buch gewesen. Land führt seine Kritik an der mangelnden „Innovationsfähigkeit“ der sozialistischen Staaten jedoch nicht aus. Festzuhalten ist, dass der Autor die Auffassung vertritt, Innovation und Entwicklung würden – anders als in China heute – sowohl in der Planwirtschaft als auch im finanzmarktgetriebenen Kapitalismus verhindert.
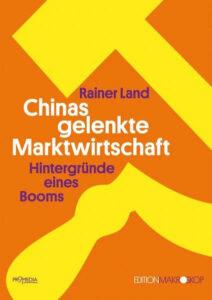
Übersichtlich und nützlich ist seine Darstellung der Entwicklung der Volksrepublik China, die Land bereits im Titel als „gelenkte Marktwirtschaft“ bezeichnet. Mit der seit 1978 verfolgten Reform- und Öffnungspolitik habe die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) zwischen langsamen Reformen und „Schocktherapie“ hin- und hergewechselt. Auf eine Phase hoher Inflation und daraus resultierenden Protesten Ende der 1980er sei ein Stopp der Reformen gefolgt, die dann 1992 wieder aufgenommen worden seien. Insgesamt sei es erfolgreich gelungen, die Volksrepublik in die kapitalistische Weltwirtschaft zu integrieren.
Die Reformen bis 2007 beschreibt Land wie folgt: Erstens die „Auflösung der Volkskommunen und Einführung des Familienverantwortungssystems“ auf dem Land „in Kombination mit der Ablieferungspflicht und dem freien Marktverkauf der Überschüsse“. Zweitens die „Einrichtung der Sonderwirtschaftszonen, in denen Unternehmen aus dem Westen gemeinsam mit chinesischen Partnern Betriebsstätten aufbauen konnten“. Drittens die „soziale Abfederung des Umbaus der Staatsbetriebe, der mit Entlassungen, einer Auflösung der betrieblichen Sozialsysteme (Danwei)“ verbunden war (S. 102 f.). Die durchaus tiefgreifenden Veränderungen, die mit Privatisierungen und auch Betriebsschließungen einhergingen, seien schrittweise erfolgt, über Jahre hinweg umgesetzt und sozial abgefedert worden.
Viele dieser Reformen führte die KPCh zunächst versuchsweise und regional begrenzt durch, um zu beobachten, ob und wie sie funktionieren. „Je nach Ergebnis wurde das jeweilige Verfahren oder Instrument verallgemeinert, in weiteren Provinzen eingeführt oder wieder aufgegeben.“ (S. 103)
Land führt den Erfolg der Reformen im Sinne einer rasanten wirtschaftlichen Entwicklung vor allem auf zwei Faktoren zurück: zum einen die Übertragung der Verantwortung an die Betriebe, die sich nun selbst um die Beschaffung von Ressourcen und den Verkauf ihrer Produkte auf dem Markt kümmern mussten; und zum anderen die Lenkung durch die KPCh. Diese habe die Kontrolle und Steuerung des Banken- und Kreditwesens nicht aufgegeben, sondern gebe einen festen Rahmen für das Agieren sowohl der Staats- als auch der Privatunternehmen vor. Zur Rolle der KPCh schreibt Land im Vorwort: „Nicht der ‚Markt‘, sondern die Gesellschaft bestimmt, welche Entwicklungen gewollt sind und welche nicht. Dies geschieht aber nicht durch starre Planvorgaben, sondern durch diskursive Prozesse, Kreditlenkung und Industriepolitik als Instrumente. Die Kommunistische Partei als Transformations- und Diskursorganisation ist die tragende Voraussetzung für die Erhaltung des Grundkonsenses aller wichtigen sozialen Gruppen und Schichten und die laufende Aktualisierung der geteilten Ziele der wirtschaftlichen wie auch der sozialen und ökologischen Entwicklung.“ (S. 9)
Seit 2012/2013 sei es zudem gelungen, die chinesische Wirtschaft von einer exportorientierten „Werkstatt der Welt“ in Richtung Innovation und Binnennachfrage umzusteuern. Das sei durch „Kreditlenkung und Finanzierungen, über Teilhabe an Infrastrukturentwicklungen und Forschungsförderung“ gelungen, über „gesetzliche Rahmenbedingungen“ und Umweltprogramme. „Zudem spielt in größeren Privatunternehmen auch die betriebliche Parteiorganisation der KPCh eine wichtige Rolle“, so Land. Unabhängig davon, ob es sich um private oder staatliche Unternehmen handele, seien diese an „sozialistische Zielstellungen“ gebunden (S. 121). Dabei spielten die Finanzmärkte eine entscheidende Rolle. Sie seien „Instrumente zur Lenkung wirtschaftlicher Entwicklung“. Zwar gehe es für den einzelnen Anleger um Rendite, aber die Rahmenbedingungen seien in der VR China eben so gestaltet, dass „die Anlagestrategien im Großen und Ganzen den gesetzten wirtschaftlichen und sozialpolitischen Zielen entsprechen“ (S. 169). So sei es möglich gewesen, dass mit der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung auch wesentliche soziale Ziele erreicht wurden: Die absolute Armut wurde beseitigt, das Pro-Kopf-Einkommen ist seit 1978 auf das 38-Fache gestiegen.
Abschließend schreibt Land: „Die These, dass die KP als der ideelle Gesamtkapitalist zu betrachten ist, trägt nicht. Es geht nicht um Kapitalprofit und Ausbeutung, sondern um einen sozialökonomisch neuen Modus wirtschaftlicher Entwicklung. Dieser schließt Kapitalverwertung und Machterhaltung ein, aber eben nicht als Selbstzweck.“ (S. 192)
Rainer Land
Chinas gelenkte Marktwirtschaft – Hintergründe eines Booms
Promedia Verlag 2025
232 Seiten, 23 Euro








