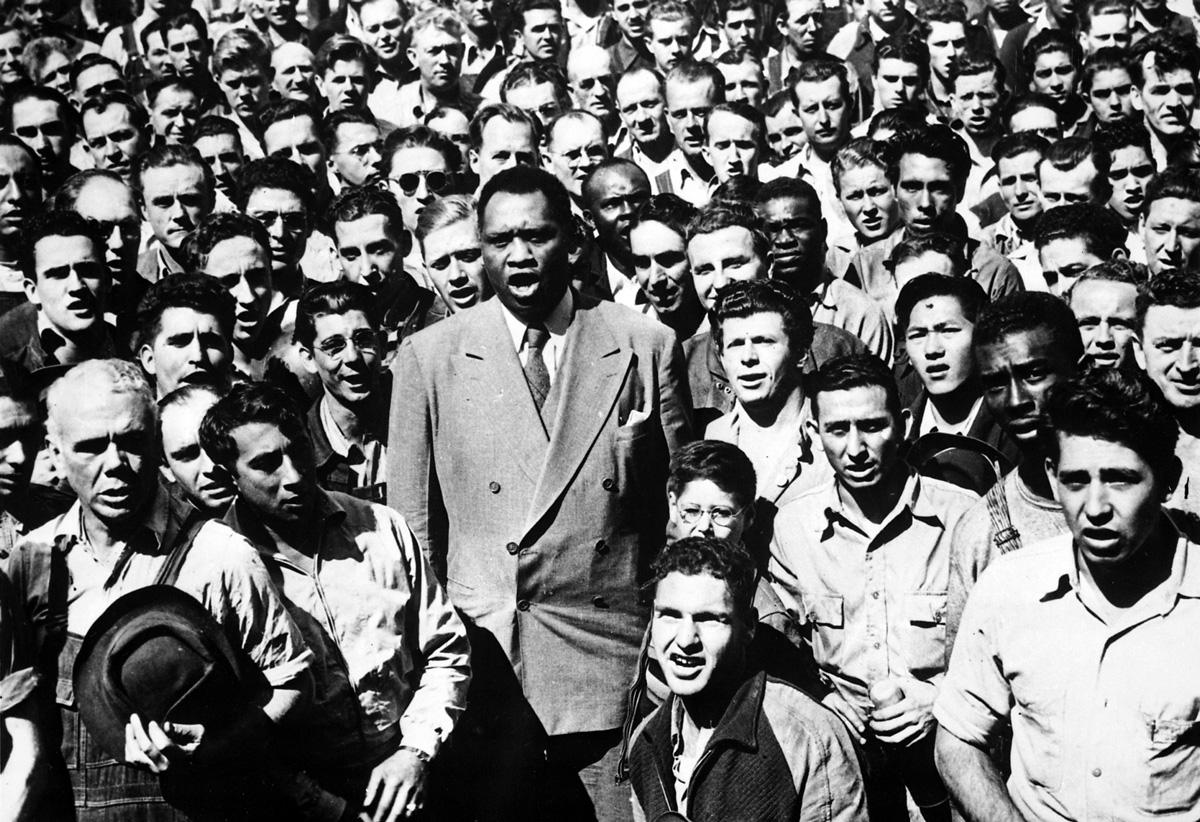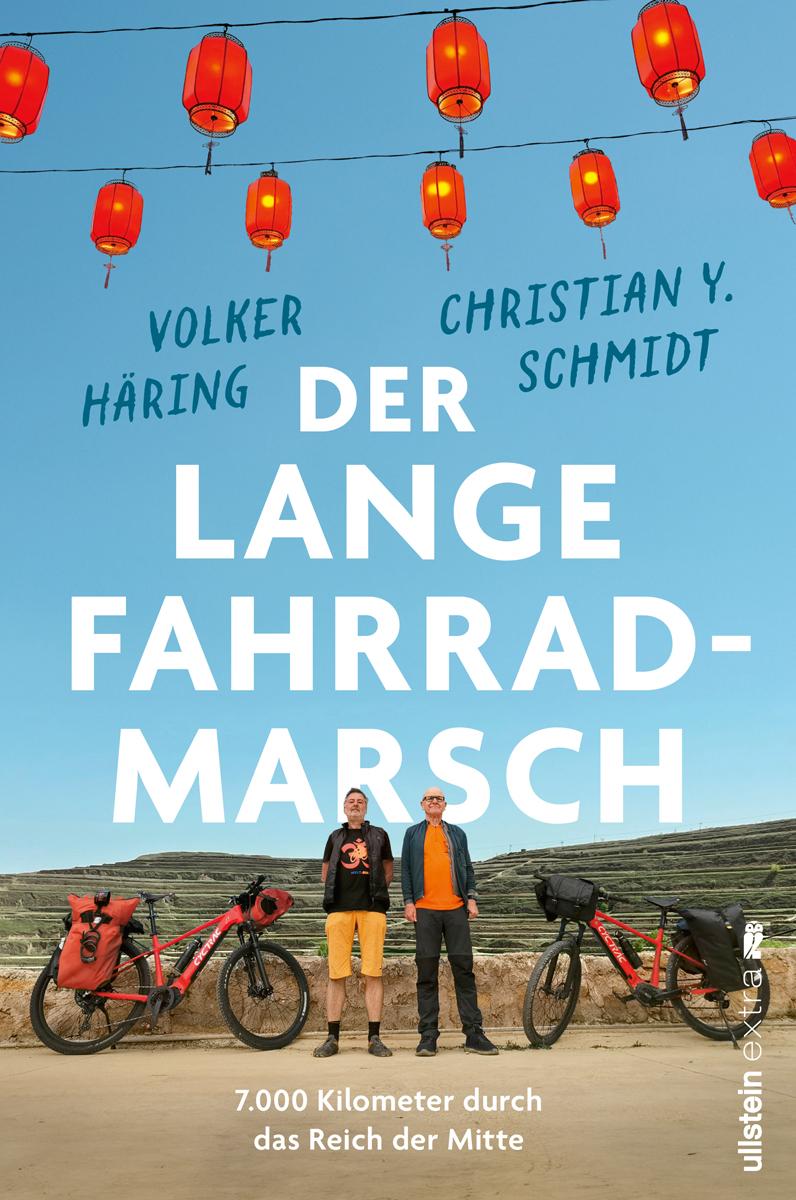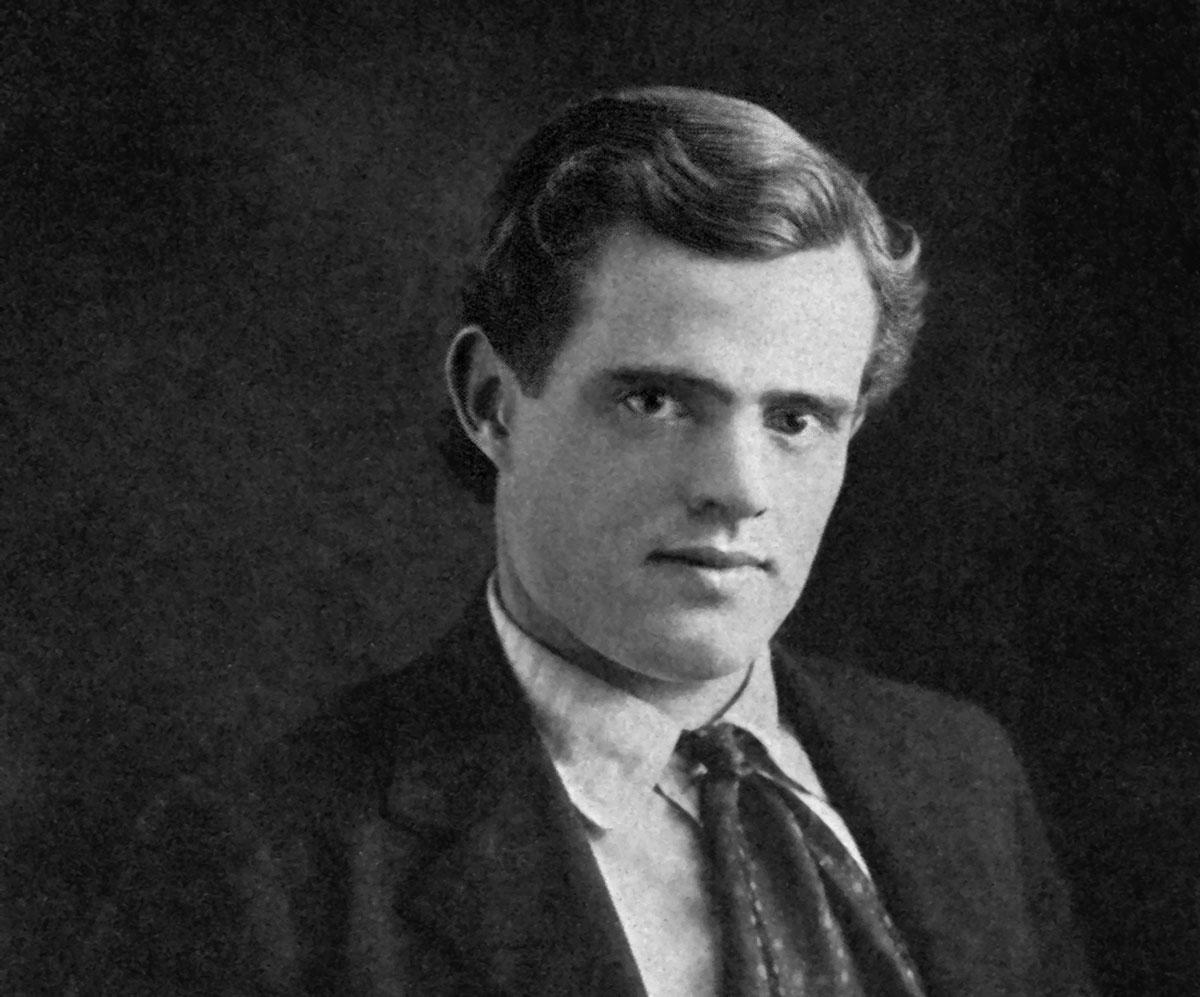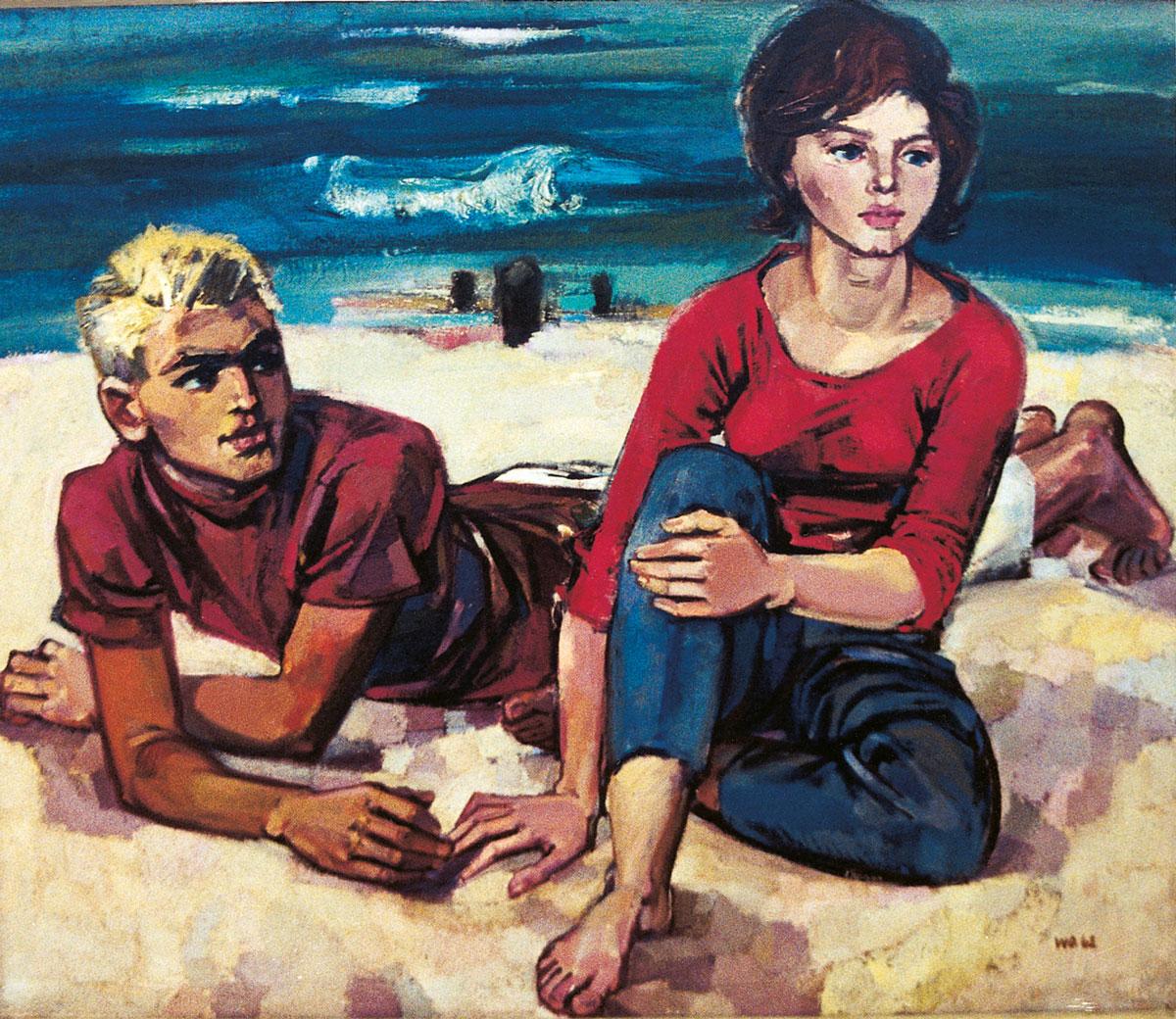Der Untergang, auf den man sich einstellt, ist keine Motivation dafür, sich noch Mühe zu geben. Das Haus zu streichen, von dem auszugehen ist, dass es eh morgen von einem Erdrutsch oder einer Bombe zerstört wird, tut man höchstens aus Trotz. Der in der westlichen Literatur dieser Tage verbreitete Dystopiefimmel fällt entsprechend zweimal ab: Als lumpengöttliche Dramödie, die unterwegs verreckt, weil man sich nicht die Mühe macht, nach einem Ausblick zu suchen und dabei Bücher auswirft, die der anstehenden Apokalypse wegen ja nur noch rausgerotzt werden müssen. Der Weltenbrand schließlich verschont keine Bibliotheken.
Dem Dichter Peter Hacks (1928 – 2003) noch war wichtig, beide Missstände, die Weltuntergangssektiererei und das literarische Schludern, zu zichtigen. „Hoffnung“, schrieb er in seinem Essay „Die Schwärze der Welt im Eingang des Tunnels“ („konkret“, 1991), „mag ein Weltprinzip sein oder auch keines; jedenfalls ist es ein Kunstprinzip. Hoffnung ist eine Gattungseigenschaft der Kunst. Indem einer Kunst macht, verrät er, dass er mit dem Weltende nicht rechnet.“ Denn, hielt Hacks kurz nach der vollendeten Konterrevolution in Europa fest: „Das von vielen erwartete und von allen gespürte Weltende hat stattgefunden – und war wieder einmal nicht das Weltende und war wieder einmal bloß das Ende der Zivilisation.“
Gegenüber dem Südwestrundfunk beschreibt der österreichische Autor und Georg-Büchner-Preisträger Clemens J. Setz die Dystopie in Anne de Marckens zweitem Roman „It Lasts Forever and Then It’s Over“ als eine „freundliche“. Tatsächlich ist im Buch, das Setz ins Deutsche gebracht hat, die Weltuntergangsstimmung heiter bis wolkig. Zwar fällt der Ich-Erzählerin, einem Zombie, der linke Arm ab, aber das ist nicht weiter schlimm: „Ich hätte eigentlich erwartet, dass es meinen Gleichgewichtssinn viel stärker beeinträchtigen würde. Aber es ist wie bei einem Haarschnitt. Die Luft bewegt sich anders um die verbliebenen Körperstellen.“ Das Hotel, „vielleicht mal eine Metapher für den Körper, für das Fegefeuer, für einen Durchgangsort“, den die Untote mit ihresgleichen bewohnt, weist noch allerhand Zivilisatorisches auf: Die Klimaanlage läuft, während Zombielaienprediger, denen der Schniedel abgeschimmelt ist, auf Tische kraxeln, von denen aus sie auf die nicht mehr und immer noch Lebenden lebensphilosophische Sinngülle („Hunger ohne Sattheit ist Gnade“) verteilen.
Die Kannibalen haben nicht nur Extremitäten und Geschlechtsorgane eingebüßt: Sie haben ihre Namen als Marker ihres Individuendaseins eingebüßt. Die Protagonistin, evolutionär ihrer Degeneration voraus, erinnert sich zwar auch nicht an ihren, aber an eine große Liebe von einst, die zu suchen sie sich aufmacht. Und sie stopft ein Loch – vielleicht als Selbsttherapie einer gewesenen Fehlgeburt wegen – in der Körpermitte mit einer lautmalerisch plappernden Krähe.
Die lässt die Vermutung aufkommen, dass die Autorin und Verlegerin de Marcken sich hier im Fortschreiben versucht hat: 1988 erschien David Marksons großer Roman „Wittgenstein’s Mistress“ („Wittgensteins Mätresse“) in dem eine Letztverbliebene der Menschheit mit sich und der Welt in Kommunikation tritt – ein schweres Unterfangen, wenn alles Kollektive, auch die Sprache, vollends privatisiert ist, weil niemand sonst mehr existiert. Die Schreibübung ist eine Schulische: Einer Geschichte Gewalt antun und sie fortdichten. Aufgabe: Das ausgedörrte Exoskelett Gregor Samsa landet auf der Prager Mülldeponie. Solche hinterhergeschmissenen Grausamkeiten.
„Es währt für immer und dann ist es vorbei“ ist zu wenig, um grausam zu sein, und hat letztlich mit Markson wenig zu tun. Stattdessen ist es schlicht mit sklavisch praktizierter Faulheit runtergeschrieben worden: Die Heldinnenreise trippelt von einer faden Begebenheit zur anderen; und selbst einem Zombie ist mehr Zusammenhang zuzutrauen als hier billig Logiklöcher gebuddelt werden, nicht als Verweis der grassierenden Irrationalität, sondern aus schierer Mitmachmentalität. Elfriede Jelinek noch ließ mit allem berechtigten Zorn auf die Gegebenheiten „Die Kinder der Toten“ (1995) auf die Fehlentscheidungen stapelnde Menschheit los. Anne de Marckens „Es währt für immer und dann ist es vorbei“ dagegen ist der billige Trick, sich das Hirn, an dem man zu schwer trägt, herausnehmen zu lassen und dann das im eigenen Sinnmist suhlende Tagebuch anzufertigen und zu publizieren.
Natürlich sind die Zeiten die, wo sowas, wie vergangenes Jahr geschehen, mit dem „Ursula K. Le Guin Prize for Fiction“ bedacht wird. Clemens J. Setz, der eigentlich das Licht am Ende des Tunnels noch sehen und es uns vermitteln kann, von diesem Roman aber völlig überzeugt ist, meint, er habe bei der Übersetzung Schwierigkeiten gehabt, de Marckens Singsang übertragen zu können. Vielleicht, ganz vielleicht also, ist die Welt, in der wir hausen, vollends aus Sprache und „Es währt für immer und dann ist es vorbei“ ist ein schon dem Titel stark entsprechendes Echo eines längst vom Meer verschluckten nordamerikanischen Kontinents. Dann ist das Melodische daran das Blubbern, das beim Untergang entsteht.
Anne de Marcken
Es währt für immer und dann ist es vorbei
Suhrkamp-Verlag, 151 Seiten, 23 Euro