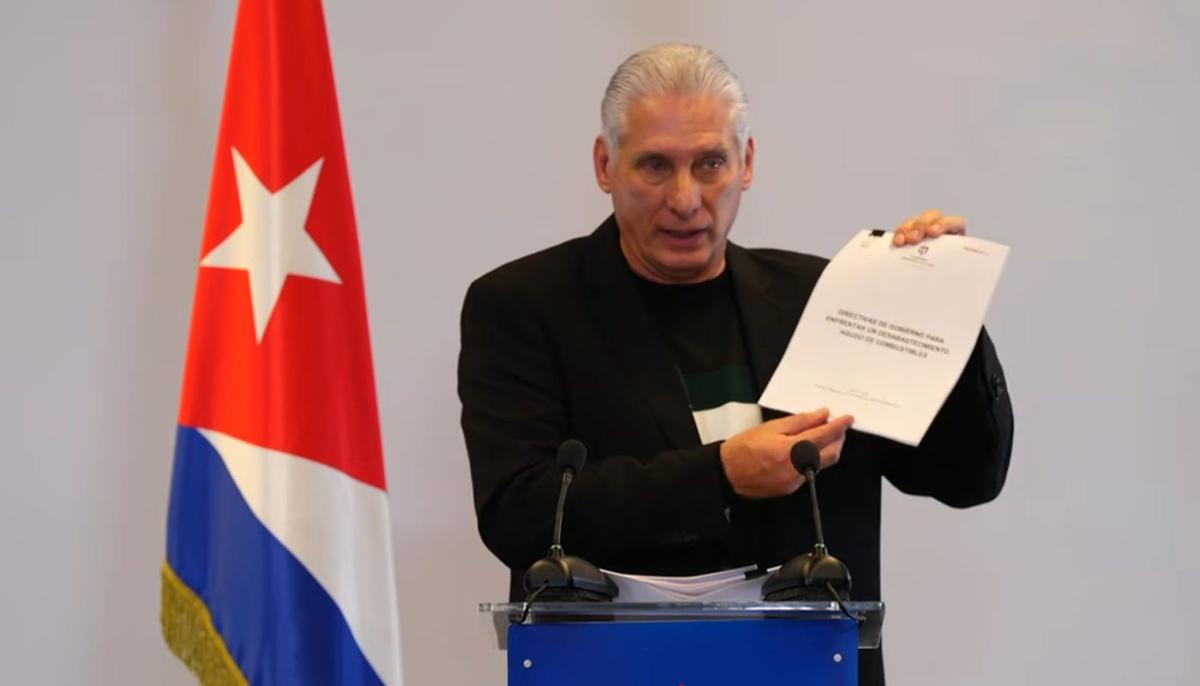Die NATO-Außenminister befassen sich auf ihrem heute beginnenden Treffen im türkischen Antalya erstmals mit neuen Plänen zur Aufstockung der Militärausgaben auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dabei sollen 3,5 Prozent des BIP unmittelbar für die Streitkräfte ausgegeben werden. 1,5 Prozent des BIP sind für infrastrukturelle Kriegsvorbereitungen vorgesehen. Verbindlich beschlossen werden könnte die Aufstockung in sechs Wochen auf dem NATO-Gipfel in Den Haag. 5 Prozent des BIP wären für Deutschland heute 215 Milliarden Euro – 44 Prozent des derzeitigen Haushaltsvolumens von fast 489 Milliarden Euro. Zugleich treibt die NATO, die jeweiligen nationalen Aufrüstungsschritte ergänzend, den Ausbau ihrer eigenen Infrastruktur voran. Laut Berichten soll das NATO-Pipelinesystem, das insbesondere Militärflugplätze mit Treibstoff versorgt, auf das Gebiet der ehemaligen DDR ausgeweitet werden – „so weit wie möglich im Osten in der Nähe des potenziellen Einsatzgebiets“ in einem Krieg gegen Russland. Damit kollidiert die NATO mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag, der jede ausländische Militärpräsenz in Ostdeutschland untersagt. Er wird schon jetzt gebrochen.
Waffen und Infrastruktur
Der Plan, sämtliche NATO-Mitglieder auf Militärausgaben in Höhe von 5 Prozent ihres BIP zu verpflichten, wird Berichten zufolge von NATO-Generalsekretär Mark Rutte forciert, seit er Ende April von Gesprächen in Washington zurückgekehrt ist. Zuvor habe er einen Betrag in Höhe von 3,5 Prozent des BIP favorisiert, habe sich damit aber bei US-Präsident Donald Trump nicht durchsetzen können, heißt es unter Berufung auf Insider. Rutte sei es lediglich gelungen, einen Kompromiss auszuhandeln, demzufolge ein Betrag in Höhe von 3,5 Prozent des BIP unmittelbar in die Streitkräfte fließen solle, während Mittel im Wert von 1,5 Prozent des BIP genutzt werden müssten, um die Infrastruktur umfassend kriegstauglich zu machen. Über den Plan hatte der Ministerpräsident der Niederlande, Dick Schoof, schon am vergangenen Freitag berichtet; inzwischen wird er von weiteren Quellen bestätigt. Dabei solle das neue Fünf-Prozent-Ziel in nur sieben Jahren, bis 2032, erreicht werden, heißt es. Bei der konkreten Ausgestaltung des 1,5-Prozent-Anteils – von einer „weichen Komponente“ ist die Rede – werde noch um Spielräume gestritten; eine Reihe von Staaten wollten etwa ihre Ausgaben für die Cybersicherheit oder für die Hochrüstung der Außengrenzen anrechnen. Ob es überhaupt noch Grundsatzeinwände gegen das Fünf-Prozent-Ziel gibt, ist unklar.
Milliarden und Billionen
Die Steigerung der Militärausgaben, die damit in Europa bevorsteht, ist gewaltig. Gaben die europäischen NATO-Staaten im Jahr 2024 bereits 476 Milliarden US-Dollar – nach aktuellem Kurs 428 Milliarden Euro – für ihre Streitkräfte aus, so müssten sie ihre Aufwendungen, um 3,5 Prozent des BIP zu erreichen, auf 805 Milliarden US-Dollar bzw. 725 Milliarden Euro steigern. Rechnet man die Ausgaben für die Kriegsvorbereitungen in puncto Infrastruktur in Höhe von 1,5 Prozent des BIP hinzu, so liegen die Gesamtausgaben von 5 Prozent des BIP bei 1,15 Billionen US-Dollar beziehungsweise 1,035 Billionen Euro. Die Bundesrepublik müsste ihren Militärhaushalt (3,5 Prozent des BIP) von aktuell rund 52 Milliarden Euro auf 150 Milliarden Euro steigern; die gesamten Ausgaben für die Kriegsvorbereitung (5 Prozent des BIP) lägen dann bei 215 Milliarden Euro. Sollte die deutsche Wirtschaft in Zukunft wieder wachsen, dann stiege mit dem BIP auch der Rüstungsanteil noch weiter. Zum Vergleich: Der derzeitige Entwurf für den Bundeshaushalt sieht etwas mehr als 22 Milliarden Euro für Bildung und Forschung und 16,5 Milliarden Euro für Gesundheit vor. Der Haushaltsposten für Arbeit und Soziales, der unter anderem Renten und Sozialleistungen umfasst – es ist bislang der größte im deutschen Staatshaushalt –, liegt bei weniger als 4,2 Prozent des BIP.
Die Rüstungsschuldenkrise
Völlig unklar ist dabei, welche Folgen der Plan haben wird, die beispiellose Hochrüstung mit Schulden zu finanzieren. Der Bundestag hat der neuen Bundesregierung bereits vor ihrem Amtsantritt erlaubt, die Schuldenbremse bei Ausgaben für die – auch militärische – Infrastruktur bis zum Wert von 500 Milliarden Euro sowie bei Ausgaben für die Bundeswehr unbegrenzt zu ignorieren. Kann sich Deutschland bei seiner Rüstung in die Höhe schnellende Schulden gegenwärtig noch leisten, so fürchten andere Staaten – etwa Frankreich, Italien und Spanien – angesichts ihres heute schon hohen Schuldenstandes bereits, in eine neue Schuldenkrise zu geraten. Ein umfassender Zusammenbruch der Wirtschaft Europas in einer Rüstungsschuldenkrise ist nicht
mehr undenkbar.
In der Nähe des Einsatzgebiets
Während die Aufrüstung der NATO-Staaten schon längst auf Hochtouren läuft, vor allem auch in Deutschland, nimmt das Militärbündnis zusätzlich den Ausbau seiner eigenen Infrastruktur in den Blick und gerät dabei in Konflikt mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag. Dabei geht es um Pipelinesysteme, mit denen die NATO die Treibstoffversorgung ihrer Streitkräfte sichert, besonders die Versorgung von Flugzeugen mit Kerosin. Unter diesen ragt das Central European Pipeline System (CEPS) heraus, das unter anderem Militärflugplätze in Deutschland versorgt. Angebunden sind außerdem Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg sowie Einrichtungen des US-Militärs. Da die Speicher, die zum CEPS gehören, regelmäßig geleert und neu befüllt werden müssen – Kerosin kann aufgrund etwaiger Zersetzungsprozesse nicht zeitlich unbegrenzt gelagert werden –, sind auch zivile Flughäfen an das Pipelinesystem angeschlossen. Weil das CEPS im Kalten Krieg gebaut und seitdem nicht erweitert wurde, ist Ostdeutschland noch nicht daran angeschlossen. Das will die NATO nun laut einem internen Vermerk des Verteidigungsministeriums ändern, um künftig „eine Lagerung von Treibstoff so weit wie möglich im Osten in der Nähe des potenziellen Einsatzgebietes“ zu ermöglichen.
„Widerstand brechen“
Das bringt nicht nur hohe Kosten. Pro Pipelinekilometer wird laut Ministeriumsangaben mit ungefähr 1 Million Euro gerechnet. Insgesamt gehe man von 21 Milliarden Euro aus, von denen Berlin mehr als 3,5 Milliarden Euro übernehmen werde, wird Verteidigungsminister Boris Pistorius zitiert. Vor allem aber wird mit der Erweiterung des CEPS auf das Gebiet der einstigen DDR die an den Zwei-plus-Vier-Vertrag anknüpfende Entscheidung gebrochen, das Pipelinesystem nicht dorthin auszudehnen. Im Zwei-plus-Vier-Vertrag heißt es unter anderem, „ausländische Streitkräfte“ würden „in diesem Teil Deutschlands weder stationiert noch dorthin verlegt“. Berichten zufolge ist nicht nur im Gespräch, eine Pipelineverbindung über das Gebiet der einstigen DDR nach Polen zu bauen, sondern auch Flughäfen wie Berlin-Brandenburg oder Leipzig/Halle anzuschließen. Wie konkret die Planungen offenbar bereits sind, verdeutlicht die Tatsache, dass im Verteidigungsministerium, wie berichtet wird, „bereits darüber nachgedacht“ wird, „wie man den erwarteten Widerstand brechen könnte“. „Bürgerinnen und Bürger, aber auch Kommunen oder Bundesländer“ könnten sich schließlich gegen das Vorhaben wehren – „zum Beispiel wegen drohender Enteignung oder wegen Umweltbedenken“. Die Bundesregierung freilich behauptete kürzlich auf eine Frage des Abgeordneten Sören Pellmann (Die Linke) im Bundestag, ihr lägen „noch keine konkreten Erkenntnisse“ zur CEPS-Ausdehnung vor.
Vertragsbruch in Rostock
Schon jetzt bricht Berlin den Zwei-plus-Vier-Vertrag mit der Commander Task Force Baltic (CTF Baltic), einem taktischen Hauptquartier der NATO, das in Rostock angesiedelt ist. Über das CTF Baltic teilt das Verteidigungsministerium mit, es sei „ein nationales Hauptquartier mit multinationaler Beteiligung“. Es werde zwar „durch einen deutschen Admiral geführt“, dessen Stellvertreter jedoch sei ein „polnische(r) Admiral“, und als Stabschef habe man einen „schwedischen Stabsoffizier“ vorgesehen. „Auch nachgeordnete Führungspositionen sind multinational besetzt“, heißt es weiter. Wie dies damit vereinbar sein soll, dass „ausländische Streitkräfte“ im Gebiet der ehemaligen DDR „weder stationiert noch dorthin verlegt“ werden dürfen, ist nicht ersichtlich. Die Bundesregierung behauptet dennoch, die Aussage, das CTF Baltic breche den Zwei-plus-Vier-Vertrag, treffe nicht zu. Die regierungsfinanzierte Deutsche Welle geht gegen Kritiker sogar mit einem sogenannten Faktencheck vor. Mit der aktuell geplanten Osterweiterung des NATO-Pipelinesystems dehnt sich das Militärbündnis nun noch mehr auf das Gebiet der früheren DDR aus. Die Bedeutung des Zwei-plus-Vier-Vertrags ist hoch: Er ersetzt den zwecks Vermeidung von Entschädigungen von der Bundesrepublik nie geschlossenen Friedensvertrag. Bricht Deutschland ihn, dann könnten sich andere Staaten auch nicht mehr an ihn gebunden fühlen.