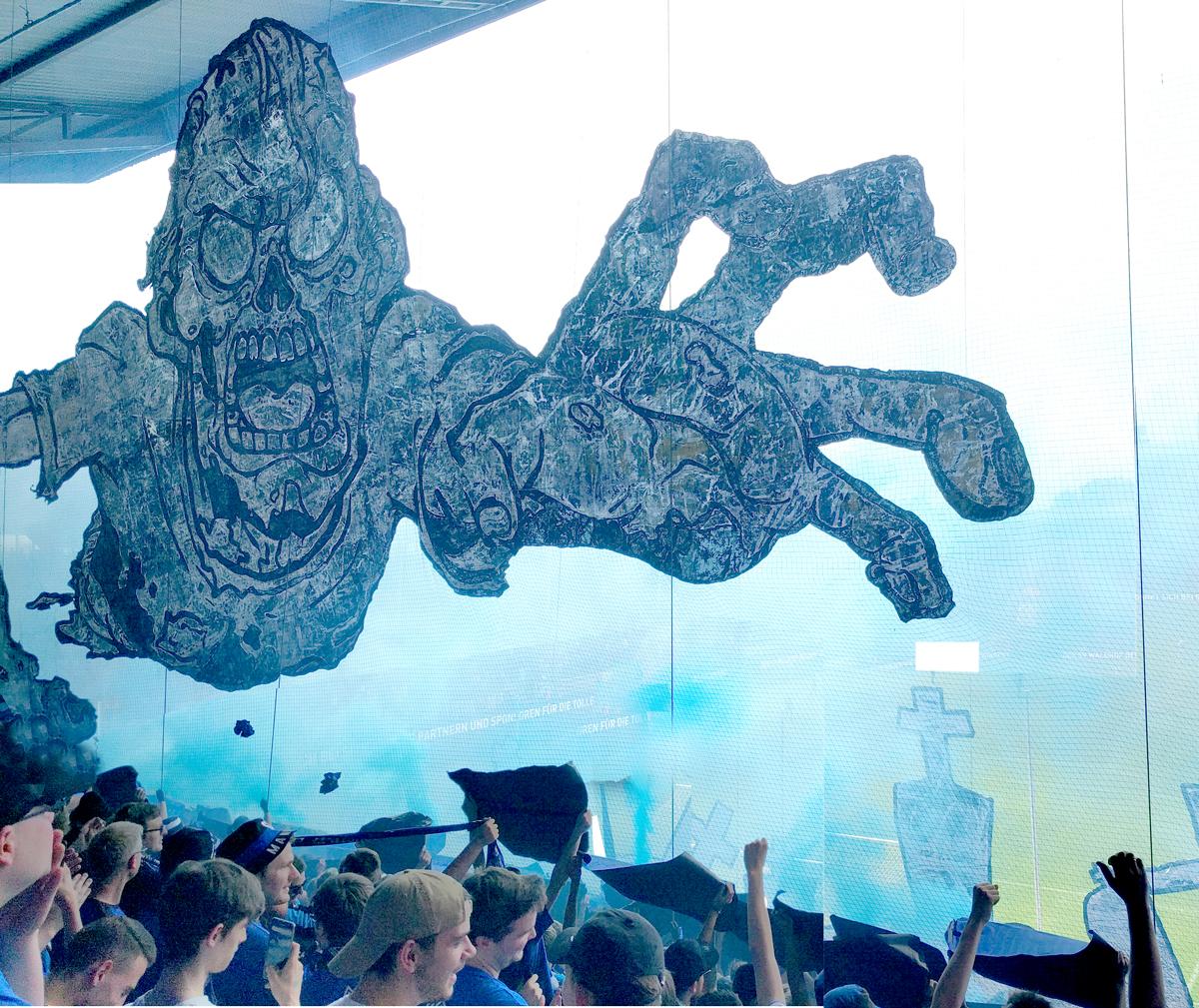Wer in einigen Jahren auf die Veränderungen im deutschen Krankenhaussystem zurückblickt, wird zweierlei feststellen können. Erstens: Es ist eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger sowie eine Arbeitsverdichtung für die Beschäftigten organisiert worden, die mit einer Öffnung des Krankenhaussektors für Privatkonzerne und neuen Möglichkeiten zur Erzielung von Profit einhergeht. Zum Zweiten war eine Regierungsführung oder -beteiligung der SPD für relevante Schritte in diese Richtung notwendig, um diese gegen die objektiven Interessen der Bevölkerung durchzusetzen und Widerstand aus den Gewerkschaften möglichst klein zu halten.
Türöffner Fallpauschalen
Auch wenn die Vorbereitungen dafür schon in den Achtzigerjahren des letzten Jahrtausends begannen: Der nötige Türöffner war die Abschaffung des Selbstkostendeckungsprinzips für Krankenhäuser und die schrittweise Einführung der Fallpauschalen (DRGs). Die rot-grüne Bundesregierung und Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt verabschiedeten das Fallpauschalengesetz, das 2003 in Kraft trat. Sämtliche Gesetzgebungen unter den folgenden großen Koalitionen – unterbrochen von der schwarz-gelben Regierung (2009 bis 2013) – stabilisierten das Fallpauschalensystem und sicherten so die Möglichkeit, mit Kosteneinsparungen bei Prozessen und Personal Profite zu erzielen. Daran änderten im immer komplexer werdenden Finanzierungssystem der deutschen Krankenhäuser auch die eingeführten Begrenzungen der Fallpauschalenlogik nichts – wie die komplette Refinanzierung der Pflegepersonalkosten mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz 2019. Arbeitgeber und allen voran die privaten Konzerne fanden immer wieder Möglichkeiten, durch Umstrukturierungen auf Kosten des Personals die Felder der Gewinnerzielung zu erweitern.
Nach Vorarbeit der CDU-geführten Landesregierungen in NRW seit 2019 war es dann möglich, den zweiten Teil, der einen freien Krankenhausmarkt begrenzte, anzugreifen. Die Krankenhausplanung, bei der die Bundesländer die Sicherstellung der Versorgung für die Bevölkerung planerisch umsetzen, wurde durch das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) unter Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) über den Umweg von Finanzierungsmechanismen angegriffen und damit der Weg für eine Marktbereinigung und das gewünschte Ziel einer großen Anzahl Krankenhausschließungen bereitet.
Vorreiter NRW
Den Startschuss für den nordrhein-westfälischen Aufschlag zur bundesweiten Reduzierung der Anzahl von Krankenhäusern gab ein von der Landesregierung in Auftrag gegebenes Gutachten zur Krankenhauslandschaft, das ab 2019 den Fahrplan vorgab und die politische Diskussion bestimmte. Insbesondere in den Ballungszentren gäbe es zu viele Krankenhäuser, hieß es darin. Diese erbrächten nicht immer gute Qualität. Notwendig sei deshalb die Zentralisierung von Leistungen und eine Planung nicht mehr nach Bettenanzahl, sondern nach Leistungsgruppen. Die Kritik von Trägern, Fachverbänden und Gewerkschaften ignorierte die Landesregierung. Das Gutachten gab beinahe vollständig vor, was anschließend Fahrplan für die Gesetzgebung in NRW werden sollte und dort seit 2021 in mehreren Stufen umgesetzt wird.
Andere Bundesländer schauten mit hohem Interesse auf NRW, vor allem aber machte die Bundesregierung sich mit dem KHVVG die Leistungsgruppenlogik zu eigen und verknüpfte die Planung mit der Refinanzierung durch die Krankenkassen. Das im Januar 2024 in Kraft getretene Gesetz war die Umsetzung der von Lauterbach 2022 angekündigten „Revolution“, die eine Entökonomisierung des Kranken-haussektors versprach. Das Tempo, in dem sich der Schleier über dem wirklichen Ziel lichtete, war beeindruckend. Lauterbach sprach initial von einer „Überwindung der DRGs“ und noch im März 2024 von einem besonderen Schutz insbesondere der kleinen Krankenhäuser auf dem Land. Im folgenden Monat lautete die zentrale Aussage bereits: „Wir werden alle Krankenhäuser retten, die wir benötigen.“ Lauterbachs parlamentarischer Staatssekretär Edgar Franke erklärte dann im September 2024 auf dem Krankenhausgipfel, dass es keine Entökonomisierung geben werde.
Noch klarer formulierten es die Taktgeber und Berater der politisch Verantwortlichen. Wulf-Dietrich Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, erklärte auf dem DRG-Forum 2024: „Jeder Monat, in dem nicht fünf bis zehn Krankenhäuser vom Netz gehen, ist ein verlorener Monat.“
Die Dimensionen, in denen die Marktbereinigung voranschreiten soll, hatte die Bertelsmann-Stiftung schon im Jahr 2019 definiert: Eine Verringerung der Klinikanzahl von knapp 1.400 auf unter 600 werde die Qualität der Versorgung verbessern und das Personal entlasten, so die Schlussfolgerung einer von Bertelsmann in Auftrag gegebenen Studie. Die Antwort, wie bei gleicher benötigter Anzahl von Operationen bei einer bestimmten Diagnose das Personal durch die Zusammenlegung der Operationen an weniger Orte entlastet werden sollte, blieben Stiftung und Bundesregierung bisher schuldig.
Massive Kritik
Seit Januar 2024 ist das KHVVG nun in Kraft. Die darin enthaltenen Regelungen führen seitdem und in Summe zu einem maximalen planerischen und finanziellen Druck auf die Krankenhausträger, selbst wenn viele Regelungen erst in mehreren Jahren finanziell wirksam werden. Kritik daran formulierten nicht nur die Gewerkschaften oder Bündnisse wie Krankenhaus statt Fabrik, sondern auch und massiv die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG). Am 9. September erklärte Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der DKG: „Wirtschaftlich stehen die Krankenhäuser so schlecht da wie noch nie. Die Defizite sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, die Krankenhausträger müssen Personal entlassen und Versorgungsangebote streichen, um Insolvenzen und Standortschließungen zu vermeiden.“
Gaß lässt dabei außer Acht, dass diese Option für viele und gerade kleinere Krankenhausträger gar nicht besteht, weshalb gerade kleine frei-gemeinnützige, also kirchliche Krankenhäuser sowie kommunale Kliniken zunächst vereinzelt geschlossen werden. Die Anzahl der drohenden Schließungen steigt zeitgleich in extreme Höhen. ver.di fordert deshalb eine Finanzierung aus Steuermitteln, um das ungesteuerte Schließen von Kliniken zu vermeiden: „Wenn nicht bald eine Brückenfinanzierung für wirtschaftlich angeschlagene Krankenhäuser kommt, droht ein Kliniksterben mit fatalen Folgen für die flächendeckende Versorgung“, so ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler anlässlich der Verabschiedung der Krankenhausreform am 17. Oktober 2024. Die zuständige Gewerkschaft macht zudem in all ihren Stellungnahmen und Statements deutlich, wie viel Druck aktuell auf dem Personal lastet und wie wenig die Perspektive der Beschäftigten und ihrer Betriebs- und Personalräte in den Krankenhausreformen mitgedacht wird.
Als Gradmesser für das 2025 von der Merz-Regierung auf den Weg gebrachte Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) definiert ver.di, ob die durch das Gesetz veränderten Reformschritte es schaffen, die Beschäftigten beim Umbau der Krankenhauslandschaft mitzunehmen.
Mit dem am 8. Oktober 2025 beschlossenen Kabinettsentwurf des Krankenhausreformanpassungsgesetzes (KHAG) hat die Bundesregierung auf Kritik reagiert – allerdings auf die der Arbeitgeberverbände und Bundesländer. Gesundheitsministerin Nina Warken ordnete dementsprechend ein, dass das neue Gesetz den Kern des KHVVG nicht ändern, sondern es nur „praxistauglicher“ machen solle. Das Bündnis „Krankenhaus statt Fabrik“ kommentierte, die Änderungen würden die aktuelle Situation zwar nicht verschärfen und zum Teil sogar zu geringfügigen Verbesserungen führen. Die wesentlichen und hochproblematischen Bestandteile blieben aber bestehen. Dazu gehört das DRG-System inklusive massiver Fehlanreize für die Krankenhausträger. Eine Vorhaltefinanzierung, die die Kosten refinanziert, die es braucht, um ein wohnortnahe und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung unabhängig von den erbrachten Leistungen sicherzustellen, wird es weiterhin nicht geben.
Auswirkungen
In Kombination mit der seit Jahrzehnten bestehenden Unterfinanzierung der Investitionskosten, für die die Bundesländer zuständig sind, kommt somit eine politisch organisierte Gemengelage zustande, die eine Marktbereinigung und eine Zerschlagung des deutschen Krankenhaussystems wollen. Im Ergebnis bleiben die privaten Investoren, die sich im Nachgang ihren Einstieg teuer bezahlen lassen werden.
Seitenweise Schließungen
Eine Übersicht zur Berichterstattung über Klinikschließungen gibt es auf der Homepage „kliniksterben.de“. Diese zeigt, warum es für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Verbände und Gewerkschaften so schwierig ist, die Klinikschließungen zu skandalisieren und Widerstand dagegen aufzubauen. Scrollt man durch die Monate der Jahre 2024 und 2025, dann finden sich neben den wirklichen Klinikschließungen vor allem Standortschließungen, Zusammenlegungen oder Schließungen von einzelnen Abteilungen oder Fachkliniken.
So wird in der Pleißentalklinik in Werdau (Sachsen) die Kinderstation geschlossen, in Düsseldorf schließt das Luisenkrankenhaus als hochspezialisiertes Krebszentrum komplett, während es wiederum in Bad Oeynhausen (ebenfalls NRW) „nur“ die Geburtsklinik trifft. In Tettnang in Baden-Württemberg ist es die Abteilung für Innere Medizin, im hessischen Sulzbach trifft es die Urologie. Diese Liste lässt sich über alle Bundesländer und nahezu alle Fachrichtungen seitenweise fortführen.
Komplette Schließungen wie beispielsweise beim Marienhospital und Vincenz-Krankenhaus in Essen, der Helios-Klinik in Zerbst, dem DRK-Krankenhaus Wolgast, der St.-Lukas-Klinik in Solingen oder des St.-Joseph-Krankenhauses in Haan waren in den letzten Jahren in der Minderheit. Schließungen werden häufig scheibchenweise durchgeführt. Dem gehen Nachrichten zur finanziellen Schieflage, Einschränkungen des Leistungsangebots mit dem Ziel der Sanierung oder ähnliches voraus. In der öffentlichen Diskussion lassen sich dann politische Verantwortungsträger damit zitieren, dass sie die Schließung sehr bedauern und sie gerne verhindert hätten, aber die Bürgerinnen und Beschäftigten Verständnis dafür haben müssten, dass man ein Krankenhaus nun mal nicht weiter betreiben kann, wenn es keine Qualität und nur rote Zahlen liefere. Sachzwangargumente sollen die Hände binden.
Widerstand?
Erfolgreiche Gegenwehr gibt es nur wenig. So gab es in Essen zwar eine Bürgerinitiative gegen die Schließung von zwei Krankenhäusern im Norden der Stadt, die mit einem „KrankenhausEntscheid“ sogar das erforderliche Quorum mit fast 17.000 gültigen Stimmen erreichte. Doch die schwarz-grüne Mehrheit im Rat der Stadt Essen sabotierte einen möglichen Bürgerentscheid durch Verzögerungen, überbordende bürokratische Anforderungen und juristische Angriffe. Durch die Verzögerungen im Verfahren waren die Krankenhäuser, um die es ging, im Verlauf bereits geschlossen worden. Die Beschäftigten mussten sich derweil darum kümmern, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, und hatten kaum oder keine Kraft für einen Kampf um den Erhalt „ihres“ Krankenhauses.
Anders lief es in der Auseinandersetzung um das Willibrord-Spital in Emmerich im Kreis Kleve. Auch hier sollte der Betrieb des Krankenhauses mit rund 500 Beschäftigten, das sich seit Mai 2024 im Insolvenzverfahren befand, zunächst geschlossen werden. Nach über einem Jahr der Unsicherheit setzte die Bevölkerung mit prominenter Unterstützung durch, dass das ehemals von der Pro-Homine-Gruppe (christlicher Träger) geführte Krankenhaus rekommunalisiert wurde. Der Kreis Kleve übernahm 74,9 Prozent der Anteile der GmbH und Garantien für die Schulden.
Ausblick
Mit viel Engagement kann es gelingen, einzelne Angriffe auf die Versorgung der Bevölkerung abzuwehren. Die Anzahl der zu erwartenden Umstrukturierungen sowie Abteilungs- und Krankenhausschließungen ist jedoch hoch und erfolgt nicht gleichzeitig. Daher wird es notwendig sein, diese Kämpfe zusammenzuführen und politisch einzuordnen. Hier kann die Gewerkschaft ver.di eine zentrale Rolle spielen, wenn sie klarer als bisher benennt, was die Belegschaften und Bürgerinnen und Bürger jeden Tag spüren: Den politisch Verantwortlichen geht es nicht um eine wohnortnahe und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung.
Derzeit werden allerdings alle Entscheidungen der Logik der Aufrüstung und Kriegstreiberei untergeordnet. Erst wenn auch dieser Zusammenhang benannt wird und der Widerstand dagegen auch mit dem Mittel des Streiks verbunden wird, gibt es eine Möglichkeit, dass wir in 20 Jahren noch auf ein Gesundheitssystem schauen, das diesen Namen verdient und für alle zugänglich ist.
Im Betrieb und im Wohnviertel ist es notwendig, inhaltlich zuzuspitzen. Nicht nur „Kanonen und Butter“ schließen sich aus. „Kanonen und eine neue Hüfte für Ältere“ wird es künftig ebenfalls nicht geben – genauso wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall am ersten Tag oder bei zu viel Erkrankungen. Und wenn es nach den Kriegstreibern geht, dann ist auch eine zeitgleiche Versorgung von zivilen und militärischen Patienten unmöglich.
Weitere Infos und Materialien zum Thema gibt es online unter krankenhaus-statt-fabrik.de.