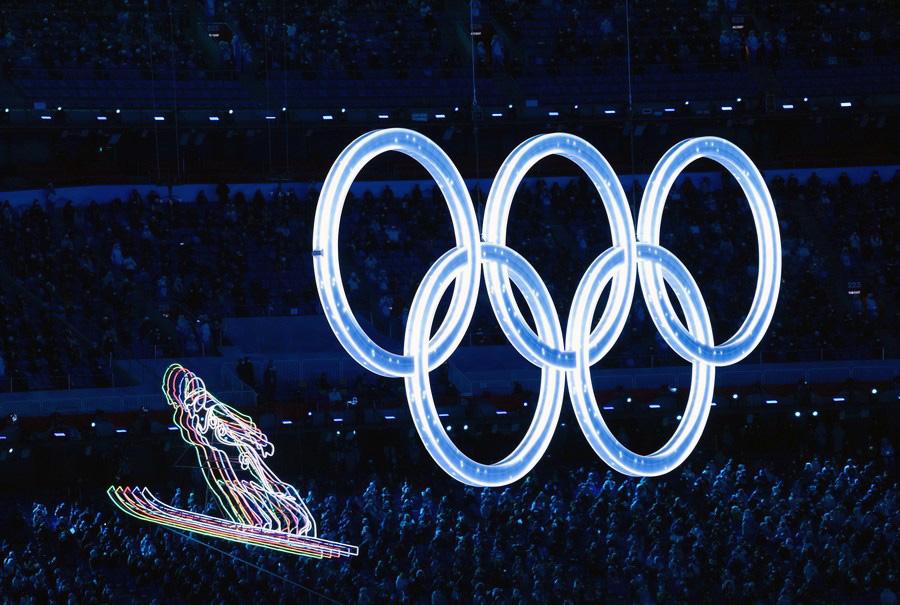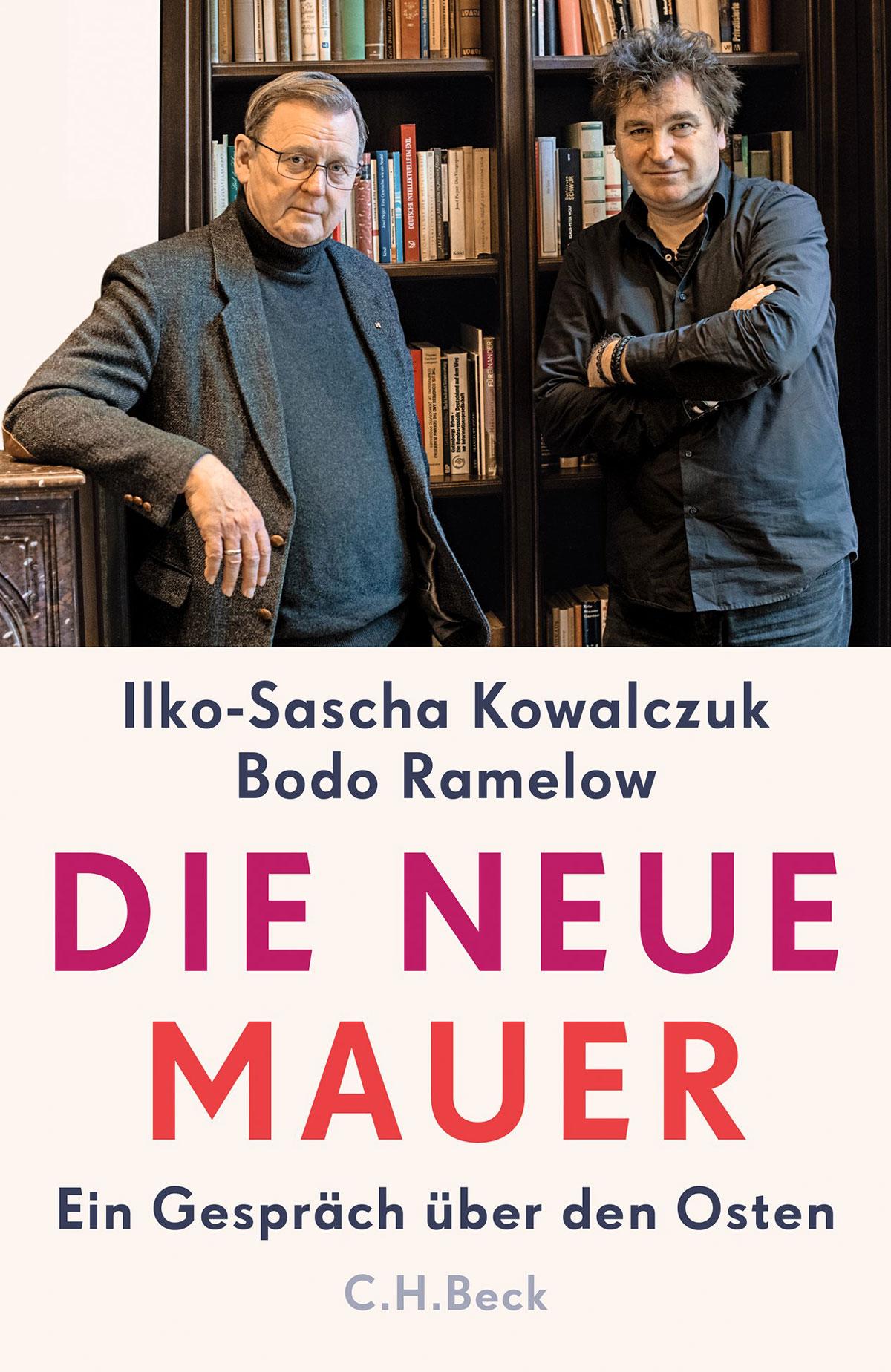Meier: Willkommen zurück auf unserem Kolumnen-Channel! Bevor’s losgeht, ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor –
Grohn: Moment – wir haben einen Sponsor?!
Meier: Na ja, ich dachte, es wäre taff, wenn wir so tun, als hätten wir lowkey einen –
Grohn: Okay, ein paar freudige Worte zu unserem Sponsor, der Roten Armee: Danke für alles! Nun zum Thema: Es ging zuletzt ja um ein Phänomen, das du „Politfluencer“ tauftest. Aber für mich sind das weder richtige Influencer noch Politiker oder Theoretiker. Auch keine Podcaster, selbst wenn sie das gleiche Format des aufgezeichneten (Selbst-)Gesprächs nutzen.
Meier: Sie machen keine digitalen Tupperpartys wie Influencer, richtig. Aber warum sollten es keine Podcaster sein? Klar, Journalisten und Autoren schufen die Blogs der 2000er, darauf folgten irgendwann Audio- und dann Videoformate. Ist doch quasi das gleiche, oder?
Grohn: Nein, diese „Politfluencer“ waren nie Journalisten oder Autoren. Sie versuchen, nach dem „Influencer“-Prinzip als solche anerkannt zu werden – indem sie auf YouTube oder Spotify eine verkaufbare Charaktermaske erstellen, um dann wie ein Reality-Star herumtingeln zu können. Nur dass sie sich mit politischen Statements statt mit Waren schmücken. Und sobald ihr „character“ als Marke etabliert ist, bedienen sie die Masche bis zum bitteren Ende.
Meier: Woher kommt dieses „Influencer“-Prinzip eigentlich? Leitet sich das historisch nicht von Figuren wie der Salonnière Rahel Varnhagen oder Mäzenen à la Reemtsma ab? Oder eher Playboy Gunter Sachs und It-Girls wie Uschi Obermayer oder Paris Hilton? Irgendwie wird man Socialité und ist prompt überall dabei, ob Volksfest, Wagner-Festspiele oder Parlament.
Grohn: Bis auf Obermayer besaßen alle als Teil der Bourgeoisie genug Kapital, um sich nicht „hocharbeiten“ zu müssen, das heißt, sie brauchten keine Medien, um popularisiert zu werden. Aber ihr volksnahes Ansehen wirkte vertrauenswürdig und konnte für Marketing oder Politik genutzt werden. Diesen Effekt versuchten die Werbe- und Kulturmonopole mit den eher talentfreien, aber „günstigeren“ Reality-Stars zu wiederholen, als ihre Absatzkrisen begannen.
Meier: Wohl, weil Anzeigen und TV-Werbung immer massiveren Kapitaleinsatz erforderten. Dazu noch superteure PR-Aktionen wie Stände, Bannerflugzeuge, Teleshop oder Verkaufsaktionen dazu, sogar der wandelnde Klinkenputzer bekam Provision!
Grohn: Eben, all das war zu teuer. Daher der Geniestreich „Big Brother“. Die Firmen blechten zwar anfangs enorm für die Werbeplätze bei den Privaten, aber es zeigte, dass das Prinzip funktioniert. Alle weiteren Formate der letzten 25 Jahre verfahren ja – mal mehr, mal weniger erfolgreich – genauso, aber erschließen je nach Thema und „Reality“-Charaktermaske die richtigen Kundengruppen. Und Medienhäuser halten mit ihren Boulevardformaten die Aufmerksamkeit so lange aufrecht, bis die Marke nicht mehr verwertbar ist.
Meier: Und das führt zu den Influencern. Denn der Markt der Reality-Shows ist inzwischen saturiert und versinkt wie das klassische Fernsehen langsam in der Bedeutungslosigkeit, da alles zu Bezahl-Angeboten wie Netflix wandert. Klar schauen die Älteren und das Kleinbürgertum noch Glotze, aber die jüngeren Generationen? Die sind in den Sozialen Medien. Nach der aktuellen Hackordnung ist deren Angebot überschaubar: Der Großkonzern Meta besitzt Instagram, Monopolist Google hat YouTube und dann gibt’s noch das chinesische TikTok. Andere wie X (ehem. Twitter), Twitch oder SnapChat sind zu vernachlässigen. Alle haben das Ziel, unüberschaubare Datenmengen zur Kundenakquise zu generieren. Damit sehen alte Marktforscher wie Kaffeesatzleser aus.
Grohn: So sattelfest sind diese Monopole aber nicht, sie werden durch Konkurrenz immer wieder in Frage gestellt. Und allen Datenmengen zum Trotz gibt es keine Garantien, dass die Algorithmen selbst mithilfe der KI die Werbung so zielgenau präsentieren, wie es gewünscht wird. Hier sollen Influencer durch ihre Follower die Zielgruppen genauer bestimmen, die Inhalte sind da egal. Denn bei aller Zerstückelung der Formate, Inhalte, Gesichter und Warengruppen erlauben sie, Zielgruppen durch ihre „freiwillige“ Werbung zu erschließen. Selbst die rebellischsten und alternativsten sind letztlich 1-Euro-Jobber der Medienkonzerne.
Meier: Das heißt, die Lage des Imperialismus ist inzwischen so verzweifelt, dass er auf digitale Tupperpartys und Klinkenputzer zurückgreifen muss: Durch quasi-soziale Beziehungen soll eine möglichst ergiebige Kundengewinnung und -bindung generiert werden. Aber ich glaube, dass für Unternehmen die vielen Plattformen, Formate, Inhalte, Gesichter oder Warengruppen auch ein Problem darstellen. Das können eher die großen Monopole stemmen, die in ihren Produkten breiter aufgestellt und im Marketing flexibler für Trends sind.
Grohn: Ja. Doch hinter der Nutzung von Influencern steckt keine Verzweiflung. Es ist eine Strategie, die wir herausarbeiten müssen in der nächsten Kolumne. Bis dahin!