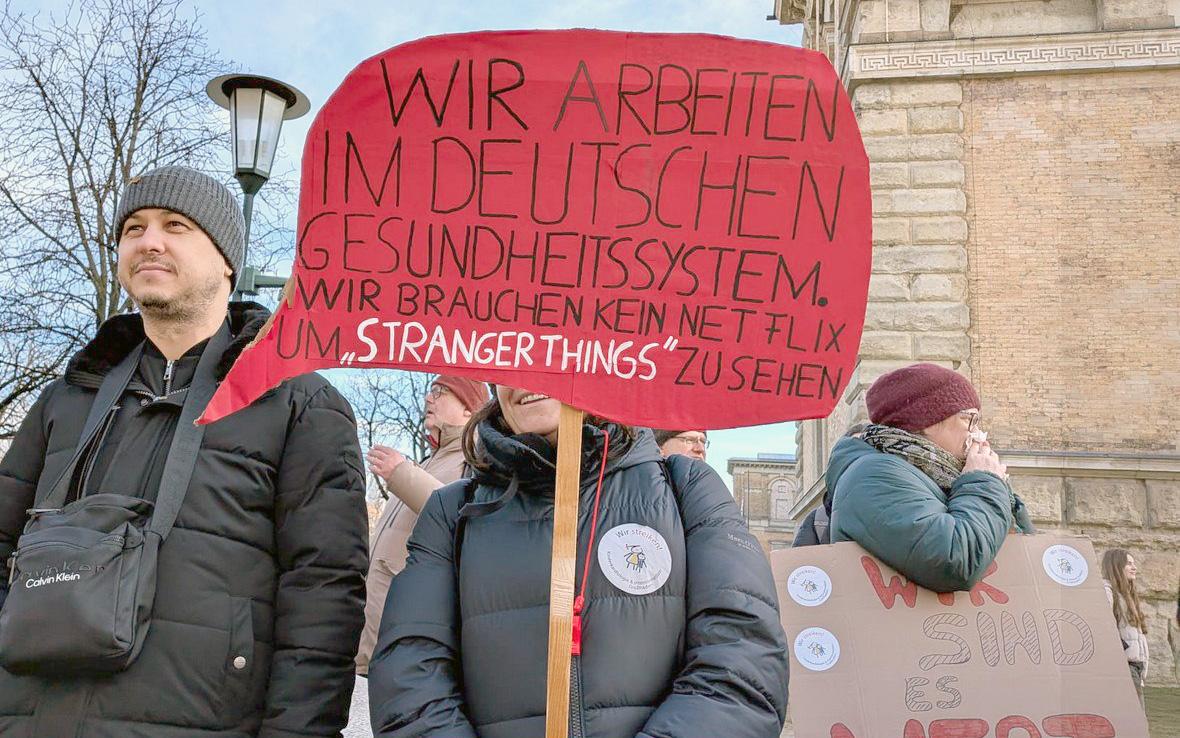Seit über 125 Jahren wird sie bereits veranstaltet: die Internationale Automobilausstellung, kurz IAA. Ihre Ursprünge reichen zurück bis in das Jahr 1897. Damals fand die „Automobil-Revue“ in Berlin statt. Im Jahr 2025 präsentierten rund 750 Aussteller aus 37 Ländern ihre Produkte bei der IAA in München. Jedes Jahr werden neue Superlative verkündet. In diesem Jahr war es die bis dato „größte innerstädtische Ausstellungsfläche in der über hundertjährigen IAA-Geschichte“, die hervorgehoben wurde.
Aber nicht alles ist rekordverdächtig. Knackte die Besucherzahl der IAA Anfang der 2000er Jahre noch die Millionengrenze, lag sie 2025 noch bei einer halben Million. Der Auto-Hype lässt nach, auch wenn die Medien versuchen, es anders darzustellen. „Die deutsche Autoindustrie will die IAA als großes Aufbruchssignal verstanden wissen“, so die „Stuttgarter Zeitung“ am 11. September. Politikprominenz marschiert auf. Und Bundeskanzler Friedrich Merz tönt: „Ja zum Auto, Ja zum Autoland Deutschland“ und fordert, „das Verbot von Pkw mit Verbrennungsmotoren“ ab 2035 zu kippen.
Das „Handelsblatt“ lobt: „Gerade die deutschen Hersteller demonstrieren mit ihren Weltpremieren neues Selbstbewusstsein.“ Die „Süddeutsche Zeitung“ greift die starke Präsenz chinesischer Autohersteller wie BYD oder XPeng auf und betont, dass sie „mit Vehemenz auf den deutschen und europäischen Automarkt drängen und die schwächelnde heimische Autoindustrie unter Druck setzen“. Kein Wunder, sind doch die chinesischen Autos oft innovativer und technologisch höherwertig. Vor allem sind sie wesentlich billiger, so dass auch Normalverdiener sie sich leisten können.
Bei der ganzen Lobhudelei blieb kein Platz für die Thematisierung der massiven Einschnitte, die die deutschen Hersteller auf dem Rücken der Beschäftigten vornehmen. Innerhalb eines Jahres (von Juni 2024 bis Juni 2025) sind 51.500 Arbeitsplätze in der Autobranche abgebaut worden. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Das bedeutet, dass rund 7 Prozent der Stellen gestrichen wurden. Keine andere Branche hat in diesem Zeitraum mehr Jobs abgebaut. Und gleich nachdem die IAA Mitte September ihren Abschluss fand, kündigt Ford an, in Köln weitere 1.000 Stellen abzubauen. Aber es wäre auch nicht zu erwarten gewesen, dass die Probleme der Beschäftigten bei diesem Event für Aufmerksamkeit gesorgt hätten.
Noch rechtzeitig zur IAA kam die gemeinsame Erklärung der IG Metall und des Verbands der Automobilindustrie (VDA) „Jetzt Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sichern“ heraus. Der Titel führt in die Irre. Vorschläge zur Sicherung von Arbeitsplätzen werden darin nicht formuliert. Dem VDA geht es um eine Offensive für Elektromobilität und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen sowie um finanzielle Unterstützung. Es geht um eine Abkehr vom Verbrennerverbot, um die Aufhebung der angestrebten Beschränkung auf CO2-Emissions-freie Autos ab 2035. Und die IG Metall zieht mit.
VDA und IG Metall fordern also – mal wieder – steuerliche Anreize zum Kauf von Elektroautos, den schnelleren Aufbau von Ladeinfrastruktur und Stromnetzen sowie billigeren Ladestrom. Die CO2-Regulierungen sollen flexibilisiert werden. Die in diesem fünfseitigen Papier geforderten Maßnahmen wären für die Kapitalseite sicherlich sehr nützlich. Die Interessen der Beschäftigten und der Gesellschaft spielen darin allerdings keine Rolle.
Was ist an Entwicklungen in der Autobranche zu beobachten? Sind die E-Mobilität, sinkende Umsätze, Verkaufsrückgänge, CO2-Regulierungen die Hauptprobleme? Diesen Problemen wäre mit Arbeitszeitverkürzungen und Produktion von zivilen gesellschaftlich nützlichen Güter gut zu begegnen. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs wäre ökologisch sinnvoller als auf Individualverkehr und Elektroautos zu setzen. Eine Produktion von Bahnen, Bussen und Kleinbussen für die sozial-ökologische Verkehrswende ist in den Produktionsstätten dieser Branche durchaus machbar. Das zeigen die beiden Autozulieferbetrieben Boge (chinesische Konzernmutter) in Simmern und Kessler in Aalen. Dort wurde die Produktion umgestellt. Statt Autoteile werden hier Teile für die Bahn oder die Bahninfrastruktur produziert.
Unternehmen wie Porsche, Daimler Truck, Motorenhersteller Deutz oder Maschinenbauer Trumpf haben andere Ziele. Sie wollen ins Rüstungsgeschäft einsteigen. Dort winken wesentlich höhere Profite, zumal diese über das sogenannte „Sondervermögen“ staatlich abgesichert sind.
Wenn mit der Herstellung von Autos nur noch knapp 5 Prozent Rendite erzielt werden, könnten auf den gleichen Anlagen ja auch Panzer oder Waffen mit einer Rendite von 50 Prozent oder mehr produziert werden. Der Gewinn des Rüstungskonzerns Rheinmetall wuchs allein 2024 um 60 Prozent. Weil Profite in anderen Branchen zurückgehen, wechselt das Kapital in diese Branche. Jahrzehntelang wurde behauptet, Konversion hin zu ziviler Produktion sei nicht machbar. Geht es um ihre Profite, dann ist der Umstieg von ziviler auf Rüstungsproduktion auf einmal kein Hindernis mehr.
Wollen die Beschäftigen der Autobranche Rüstungsgüter produzieren? Lars Hirsekorn, Betriebsratsmitglied von VW Braunschweig, hielt auf einer Betriebsversammlung Anfang September eine bemerkenswerte Rede, die mit einer Warnung endete: „Welcher Arbeiter ist aus dem Ersten Weltkrieg als Sieger hervorgegangen? Was sagen uns die Millionen Gräber auf der ganzen Welt? Die Aktionäre werden ihre Kinder nicht auf dem Schlachtfeld opfern. Sie führen kriegswichtige Betriebe und sind bestimmt unabkömmlich. Und das Sondervermögen Rüstung, so heißen heute die Kriegskredite, werden wir bezahlen, nicht Musk, nicht Porsche, nicht Thyssen-Krupp. Auch heute gibt es leider wieder Stimmen in unseren Gewerkschaften, aber auch in der Belegschaft, die die Kriegskredite unterstützen und sich über die gut bezahlten Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie freuen. Wir müssen lernen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen schnell lernen. Denn bezahlen werden wir sonst wieder mit dem Blut unserer Kinder (…).“