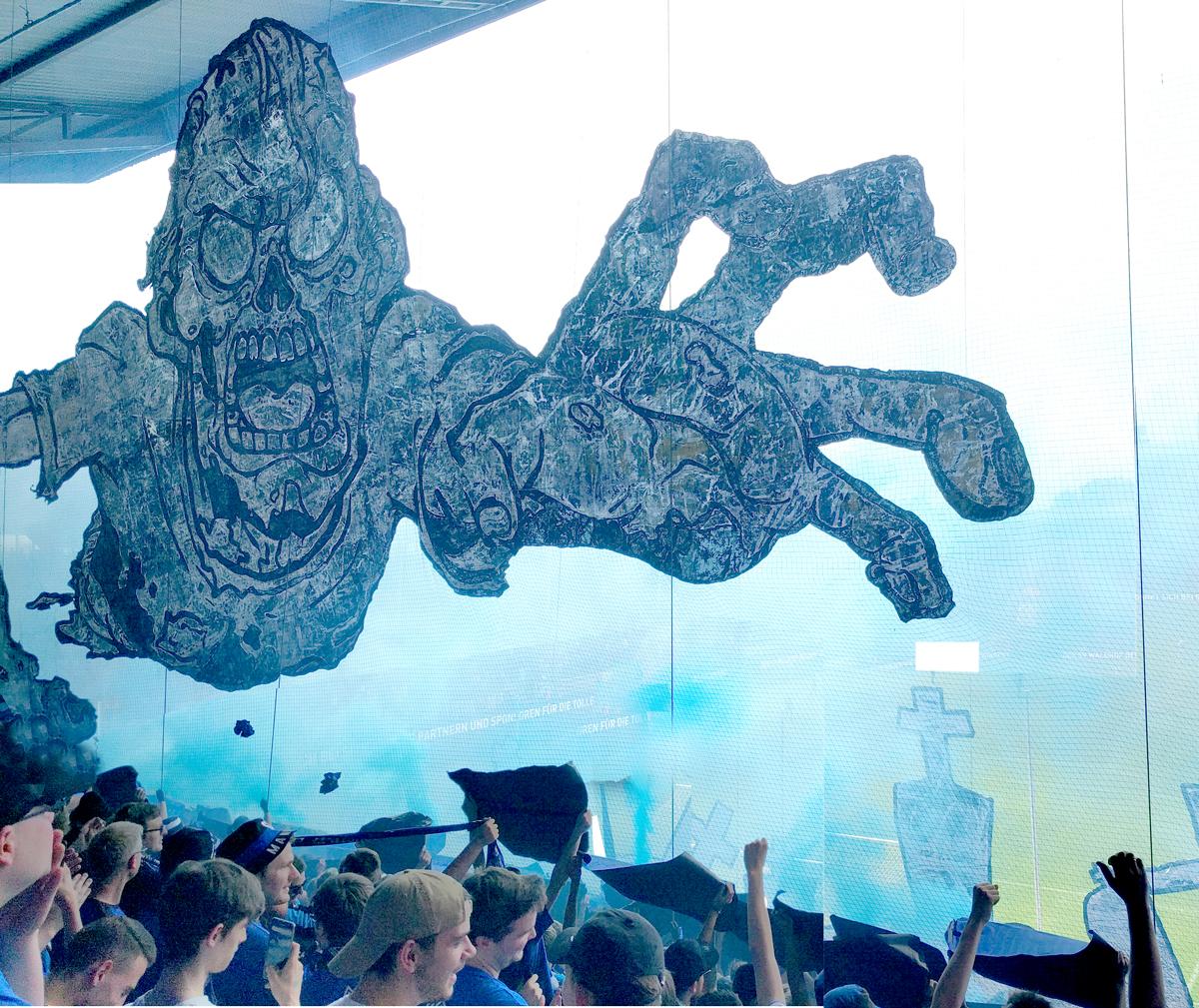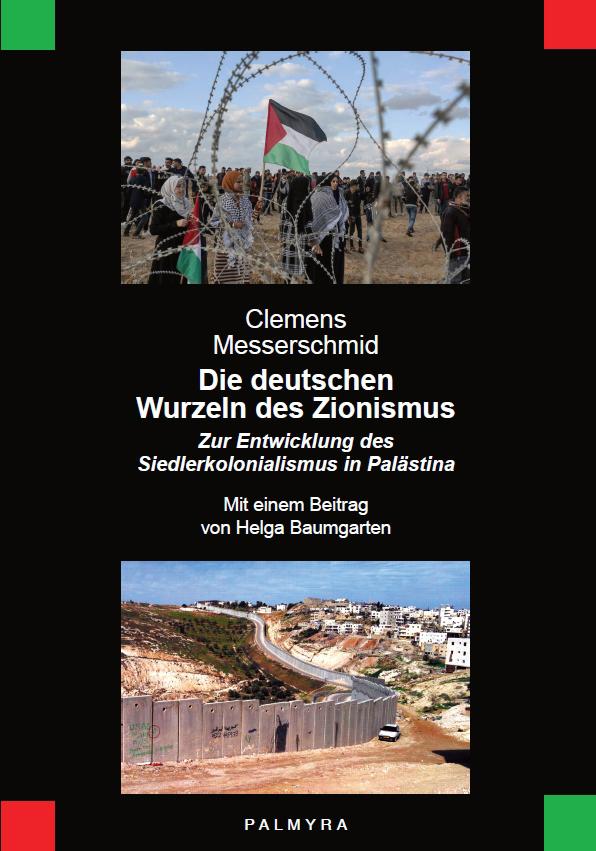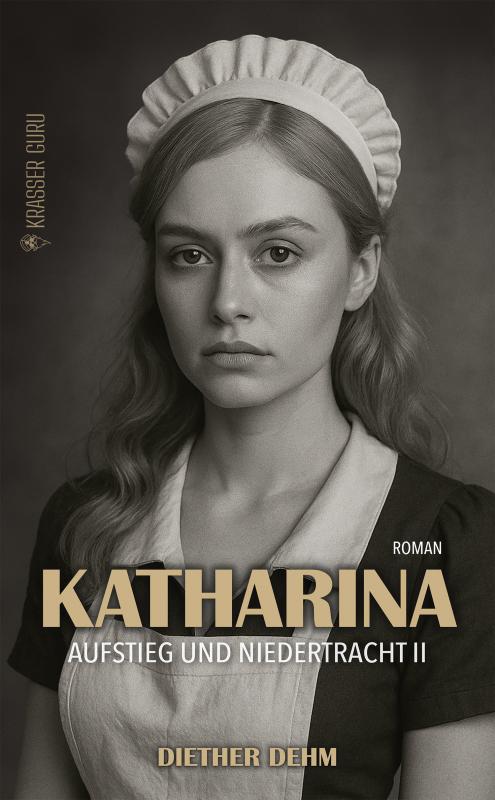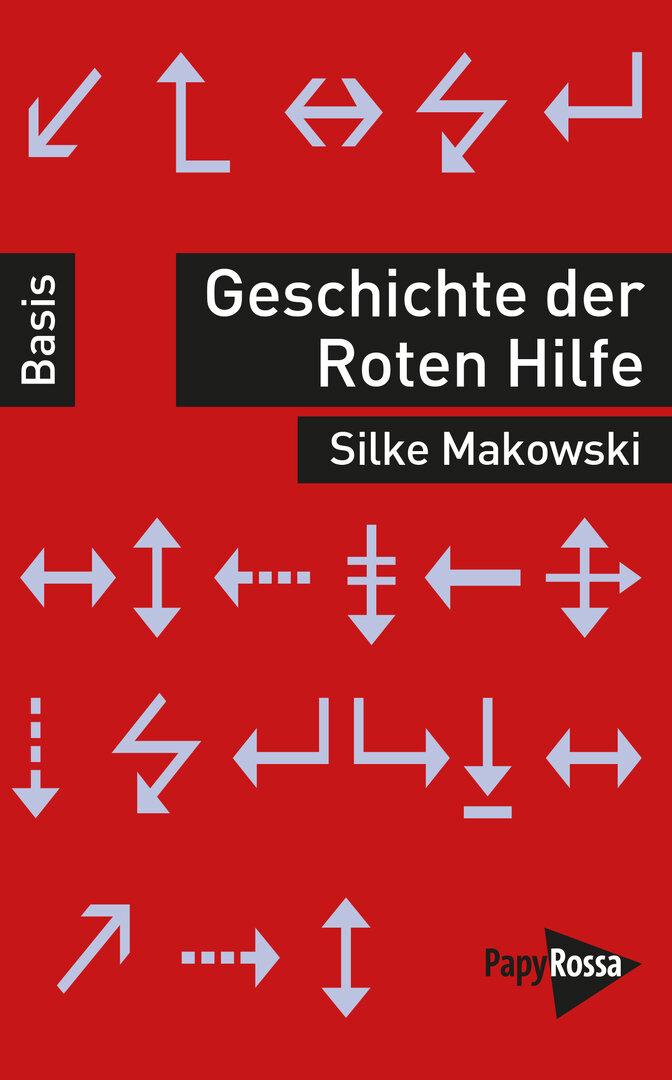Anfang April erschien die neue Ausgabe der Marxistischen Blätter. „Gegenmacht im Gegenwind – Kämpfen, aber wie?“, fragt die Redaktion im Schwerpunkt des Hefts. Wir drucken mit freundlicher Genehmigung der Autoren und des Verlags einen – redaktionell leicht bearbeiteten – Auszug aus dem Artikel von Achim Bigus und Timo Reuter ab. Die Marxistischen Blätter können unter neue-impulse-verlag.de bezogen werden.
„Weihnachtswunder“ – so nannte die IG Metall das Ergebnis nach fünf Tagen und Nächten Verhandlungen mit Volkswagen. Die vom VW-Vorstand für Sommer 2025 geplanten betriebsbedingten Kündigungen und Werksschließungen sind (fürs Erste …) vom Tisch. Aber die Beschäftigten zahlen auch einen hohen Preis: keine Tariferhöhungen in den nächsten zwei Jahren, Verzicht auf Teile von Sonderzahlungen, Erhöhung der Wochenarbeitszeit, nur noch halb so viele Ausbildungsplätze und ein überarbeitetes Entgeltsystem, durch das die Entgeltsumme pauschal um 6 Prozent sinken soll. Seit dem 20. Januar ist die Einspruchsfrist abgelaufen, sodass der Abschluss nun verbindlich ist.
Konzernspitze und Medien stellten Volkswagen als „Sanierungsfall“ dar: Der Konzern sei angeschlagen. Die Absatzzahlen sinken, man müsse sparen. Die IG Metall übernahm diese Darstellung und legte eigene „Sparvorschläge“ vor. Doch noch im Sommer 2024 hatte der Konzern Dividenden in Höhe von 4,5 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Das erklärte Ziel der Tarifeinigung ist und bleibt eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent, um die Aktionäre zufriedenzustellen.
Der Familienclan Porsche/Piëch als Haupteigentümer und der VW-Vorstand hatten harte Einschnitte gefordert – betriebsbedingte Kündigungen, Schließung von drei Werken. 100.000 kampfbereite Kolleginnen und Kollegen verhinderten dies mit massiven Warnstreiks im Dezember.
Klassenkampf von oben
Vor der Sommerpause 2024 gab VW die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Mit Blick auf den Umsatz von 322 Milliarden Euro war 2023 ein Rekordjahr, das operative Ergebnis kletterte auf 22,6 Milliarden Euro. Die Dividenden wurden erneut angehoben und erreichten eine Rekordmarke von 9 Euro pro Stammaktie und 9,06 Euro pro Vorzugsaktie.
Am 2. September 2024 ließ der Vorstand von VW dann die Katze aus dem Sack. Er zeichnete ein Grusel-Szenario zur aktuellen Situation der Automobilindustrie und der Marke Volkswagen. Seit der Corona-Pandemie sanken die Absatzzahlen der Automobilindustrie in Europa um zwei Millionen Fahrzeuge. Gemessen am Marktanteil von VW bedeute das etwa 500.000 Fahrzeuge und damit zwei Produktionsstandorte. Die einzige Lösung seien der Abbau von Überkapazitäten durch Massenentlassungen und die Schließung von bis zu drei Werken sowie ein signifikanter Beitrag der Beschäftigten zur Kostensenkung.
Die Betriebsversammlungen in den Werken wurden vorverlegt und fanden zwischen dem 4. und 6. September statt. Überall wurden die Vorstandsmitglieder, die diese Nachricht überbringen sollten, mit lautstarkem Protest empfangen. Teilweise standen sie mehrere Minuten, ohne sprechen zu können, am Rednerpult und warteten, bis sich die Lautstärke legte. Am 10. September erreichte die offizielle Kündigung des Zukunftstarifvertrages und damit der noch bis 2030 geltenden Beschäftigungssicherung, die auch Standortgarantien beinhaltete, dann die IG Metall. Der Betriebsrat bezeichnete das Vorgehen des Konzerns als „Kampfansage von historischem Ausmaß“.
Verhandlungskonzept gekippt
Diese Ankündigung warf den Zeitplan der anstehenden Tarifrunde (geplant für den November) durcheinander. So wurden die Tarifverhandlungen vorgezogen und mit Verhandlungen zwischen dem Gesamtbetriebsrat und dem Vorstand zusammengeführt. Die erste Verhandlungsrunde zwischen Unternehmen, Gesamtbetriebsrat und der IG Metall startete am 25. September. Am 30. Oktober ging die zweite Verhandlungsrunde zu Ende – ohne einen Abschluss.
Für den 21. November war die dritte Verhandlungsrunde angesetzt. Einen Tag zuvor legten IG Metall und Gesamtbetriebsrat dem Unternehmen überraschend ein Gesamtkonzept mit Lösungsstrategien vor. Das Besondere daran war, dass noch vor dem Verhandlungstermin ein Kompromissangebot unterbreitet wurde. Dieses beinhaltete:
- Einbringen von Teilen der Ergebnisbeteiligung und Boni von Management bis Tarif, begrenzt auf die Jahre 2025 und 2026
- Tariferhöhung (Übernahme Ergebnis der Fläche Metall & Elektro (M&E)) fließt als kollektives Arbeitszeitvolumen in Zukunftsfonds zur Absenkung von Arbeitszeiten
- Entwicklung eines modernen Entgeltsystems mit Besitzstandsicherung
Dennoch endete auch die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis, so dass sich die Belegschaften auf Warnstreiks vorbereiteten. Zum Tarifauftakt im September kamen laut IG Metall mehr als 3.000 Beschäftigte. Zur dritten Verhandlungsrunde Ende November waren es dann mehr als 7.000.
Das half aber nicht, das Unternehmen von seinem Kurs abzubringen. So kam es am 2. Dezember zu Warnstreiks, an denen sich laut IG Metall fast 100.000 Beschäftigte in allen Werken im Haustarif beteiligten. Am 9. Dezember waren dann laut IG Metall etwa 103.000 Beschäftigte im Warnstreik. Überrascht hatte diese Beteiligung nicht nur das Unternehmen, sondern auch die IG Metall selbst.
In der Woche vor Weihnachten einigten sich IG Metall und Unternehmen in einer historisch langen Verhandlung über fünf Tage dann auf ein Ergebnis, welches Massenentlassungen, Standortschließungen in Deutschland und den Eingriff in das monatliche Grundentgelt verhindern sollte. Zudem wurde eine neue Beschäftigungssicherung bis Ende 2030 vereinbart.
„Kooperative Konfliktbewältigung“
Wie kam es zu diesem Abschluss? Die Beschäftigten reagierten auf die „Kampfansage“ der Konzernspitze mit Aktionen „von historischem Ausmaß“: Die Warnstreiks waren die größten in der Geschichte des Konzerns. Für den Fall, dass es bis Weihnachten keine Einigung gegeben hätte, waren für den Januar 24-Stunden-Warnstreiks vorbereitet sowie auch die Einbeziehung der Belegschaften, die nicht unter den Haustarif fallen (Sachsen GmbH und Osnabrück).
Doch gleichzeitig agierten IG Metall und Gesamtbetriebsrat weiterhin im Rahmen der bei Volkswagen traditionellen „kooperativen Konfliktbewältigung“ zwischen Kapital und Arbeit. Die Interessenvertretung übernahm die Erzählung von Kapitalseite und Medien, Volkswagen sei ein „Sanierungsfall“ und müsse „sparen“.
Vorstandsvorsitzender Oliver Blume betont in seinem Statement zur Tarifeinigung die „gemeinsamen Herausforderungen“ und die Suche nach „gemeinsamen Lösungen“. Diese Vorstellung, bei Volkswagen seien alle – Aktionäre und Vorstände, Arbeiterinnen und Arbeiter – „ein Team, eine Familie“, ist auch in den Belegschaften tief verankert. Zu erklären ist dies mit einem Blick auf die Geschichte der Eigentumsverhältnisse und der industriellen Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit im Volkswagen-Konzern.
Musterkonzern
Die Nazis gründeten das Volkswagenwerk 1937/38 vor allem als Rüstungsschmiede. Das Stammkapital (bei der Gründung 50 Millionen, später dann 150 Millionen Reichsmark) stammte von der „Deutschen Arbeitsfront“, also aus dem enteigneten Vermögen der 1933 zerschlagenen Gewerkschaften.
Nach dem Ende von Nazifaschismus und Krieg beschlagnahmte die britische Besatzungsmacht das Volkswagenwerk. 1949 übergab sie es „zu treuen Händen“ an das Land Niedersachsen mit der Auflage, „die Eigentumsrechte gemeinsam mit dem Bund auszuüben“. Daneben sollten „die Gewerkschaften und die anderen Bundesländer starken Einfluss erhalten“. Unter diesen Umständen „habe der Deutsche Gewerkschaftsbund darauf verzichtet, Eigentumsrechte am Werk einzuklagen“, so der IG-Metall-Vorsitzende Berthold Huber in einem Brief an den damaligen Noch-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Die speziellen Mitbestimmungsmöglichkeiten hätten somit „auch den Charakter einer Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts und der Anerkennung daraus entstandener gewerkschaftlicher Ansprüche“.
Diese besondere Unternehmensgeschichte prägte auch das „VW-Gesetz“, als 1960 die Regierung Adenauer/Erhard den Konzern – gegen den Widerstand der Gewerkschaften – in eine Aktiengesellschaft umwandelte. Jeweils 20 Prozent der Aktien verblieben damals beim Bund und beim Land Niedersachsen, 60 Prozent wurden als „Volksaktien“ an der Börse gehandelt. Das VW-Gesetz beschränkte die Macht privater Anleger im Vergleich zu anderen Aktiengesellschaften – ein Zugeständnis, um den Widerstand gegen diese Teilprivatisierung zu beschwichtigen. Den 20-Prozent-Anteil des Bundes privatisierte die CDU/FDP-Bundesregierung unter Helmut Kohl dann 1988.
Diese Eigentumsverhältnisse zusammen mit einem hohen Organisationsgrad in der IG Metall erleichterten es Belegschaften, Betriebsrat und Gewerkschaft, deutlich bessere Bedingungen durchzusetzen als in anderen Großkonzernen – lange Zeit weitgehend ohne große Arbeitskämpfe.
Ab März 2004 begann dann mit einem Vorstoß der EU-Kommission ein längeres Gerangel um das VW-Gesetz. Parallel dazu ging der Porsche-Piëch-Clan daran, Volkswagen zu übernehmen. Das „manager magazin“ kommentierte: „Zum ersten Mal in der Geschichte habe VW einen Großaktionär, der rein wirtschaftliche Interessen habe.“
Im Ergebnis dieser Übernahmeschlacht besitzen die Familien Porsche und Piëch heute privat den Löwenanteil der Aktien und der Verfügungsgewalt bei VW. Damit hat sich die Waage mit den einst proklamierten Waagschalen „Beschäftigung“ und „Wirtschaftlichkeit“ deutlich zugunsten letzterer geneigt.
Nach dem Dieselskandal hieß es im selben Blatt im November 2015, der neue Konzernchef, Matthias Müller, wolle „die Krise nutzen, um die Strukturen aufzubrechen (…) VW soll langfristig wettbewerbsfähiger werden.“ Dabei ginge es um einen „Machtkampf gegen ein Bündnis aus Arbeitnehmern und dem Land Niedersachsen“ und den „Schluss mit einer Kultur des Kuschelns und Kungelns“.
Solche Töne und entsprechende Konflikte zwischen Vorstand und Interessenvertretung prägten die letzten zehn Jahre im Konzern. Die „Kampfansage von historischem Ausmaß“ kam also nicht aus heiterem Himmel, sondern als letzter dramatischer Akt eines schon seit Jahren aufgeführten Stückes: statt „kooperativer Konfliktbewältigung“ heißt jetzt die Devise „maximale Rendite“ und zu deren Erreichung „Klassenkampf von oben“.
Perspektiven
Wenn die Beschäftigten und ihre Vertretung sich dagegen angemessen zur Wehr setzen wollen, werden sie sozialpartnerschaftliche Illusionen überwinden müssen – ganz im Sinne der Erwartung, die Willi Bleicher (1907 bis 1981), ehemaliger Buchenwald-Häftling, antifaschistischer Widerstandskämpfer, Marxist und langjähriger Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, einmal so formulierte: „So hoffe ich, dass unter der Wucht der Ereignisse, unter der Wucht der Schläge, die uns der Gegner noch versetzt, die Arbeiterklasse lernt, die Hindernisse zu erkennen und zu beseitigen, die ihr den Weg versperren zu einer friedlicheren Welt.“
Mitte der 1980er Jahre hatte die IG Metall für die Stahlindustrie, die damals auch in einer Strukturkrise steckte, ein „Stahlpolitisches Programm“ beschlossen. Darin wurde unter anderem gefordert:
„Die Interessen der Arbeitnehmer in den Stahlunternehmen und in den Stahlrevieren zu wahren, muss oberster Grundsatz einer sozial verpflichteten Stahlpolitik sein. Dazu gehört:
- Sicherung der Beschäftigung in den Stahlrevieren
- Sicherung des sozialen Status der Arbeitnehmer
- Erhaltung der Stahlstandorte
- Vergesellschaftung der Stahlindustrie bei entscheidenden Einflussmöglichkeiten der Gewerkschaften
- Erhaltung und Ausbau der Mitbestimmung
- Weitere Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich
(…) Der Sicherung von Privateigentum und Managementinteressen setzen wir die Forderung nach Vergesellschaftung, nach Erhaltung und Ausbau der Mitbestimmung entgegen.“
Wären das nicht heute bedenkenswerte Forderungen für die Automobilindustrie?