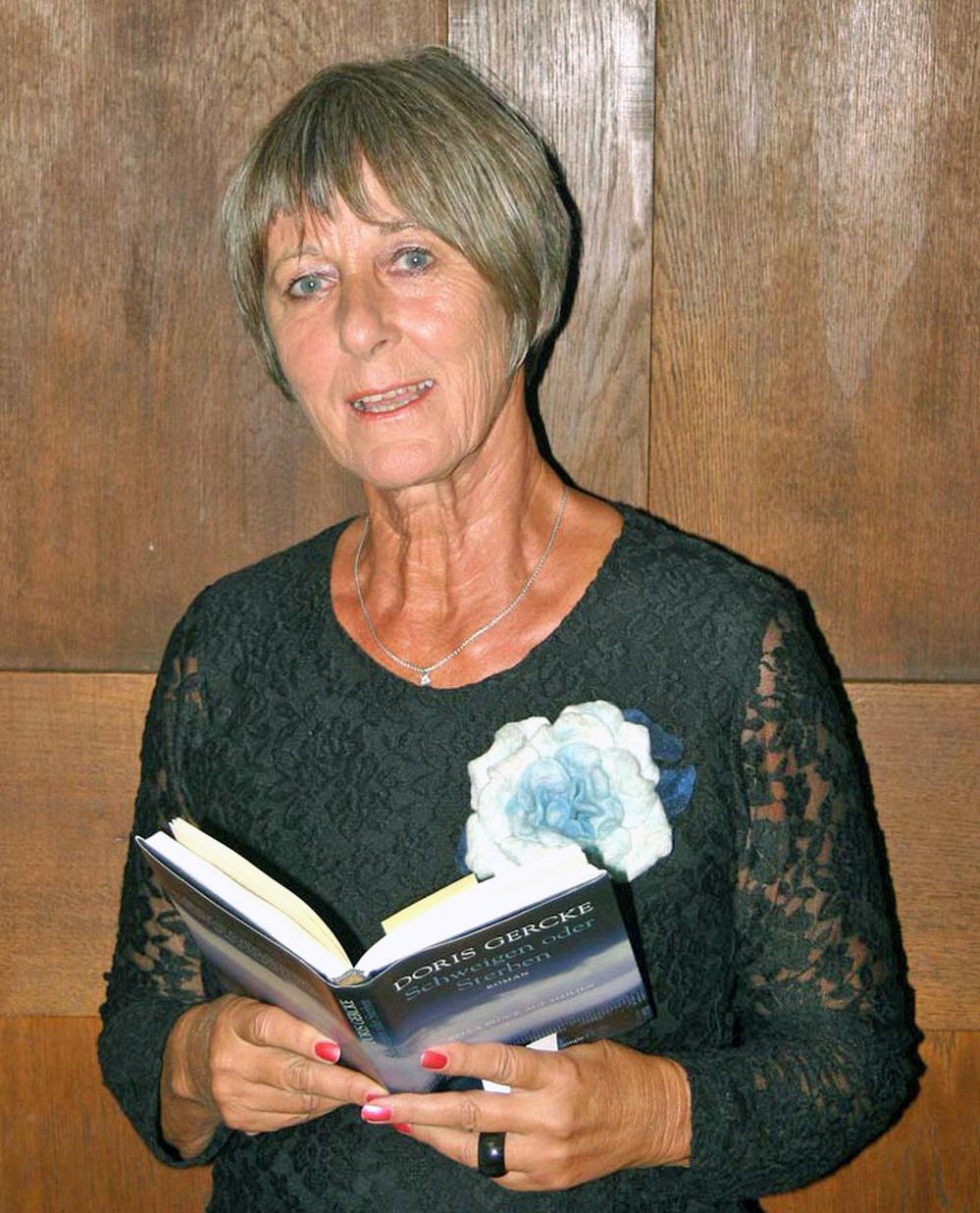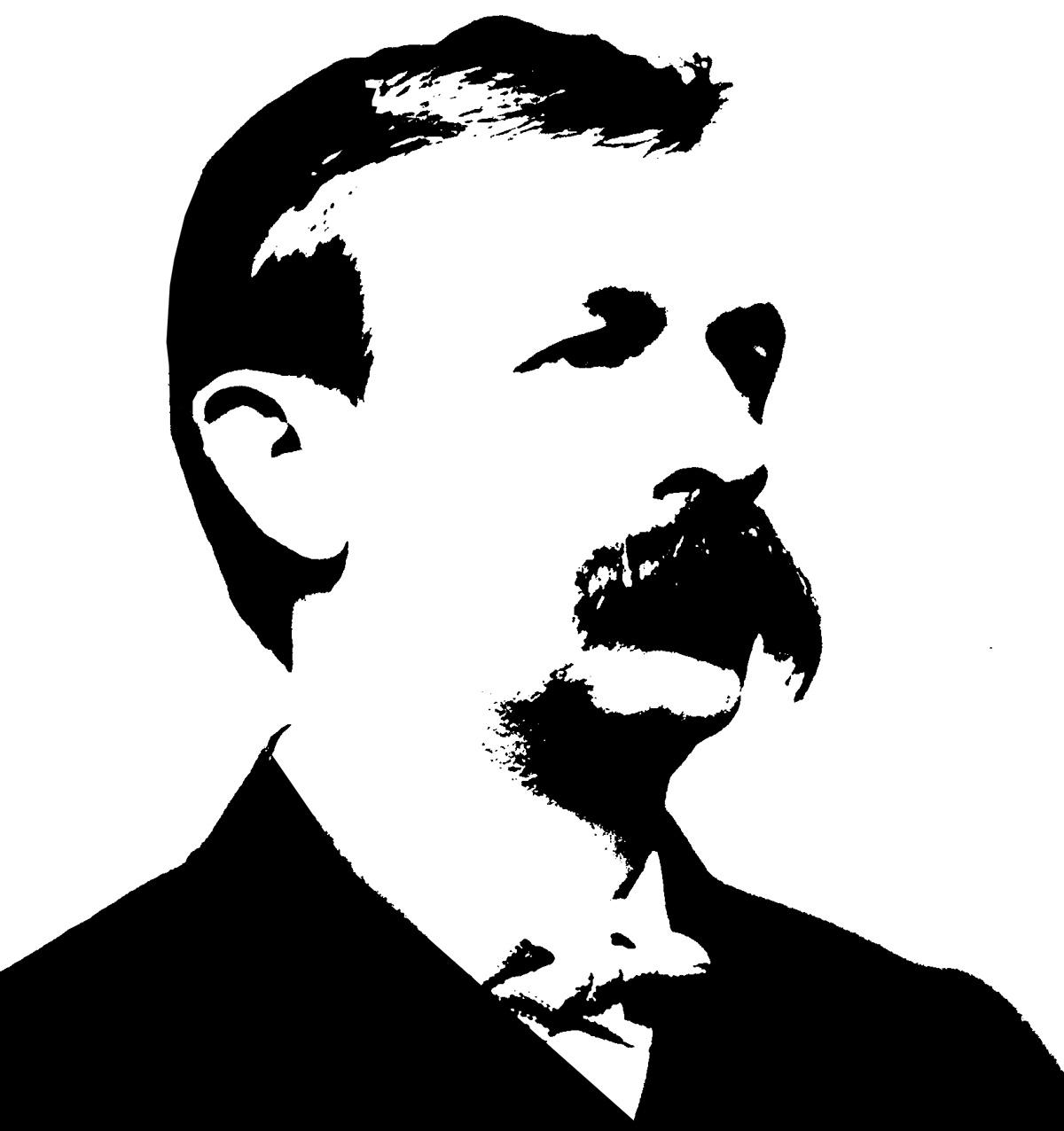Nicht die Ausübung von Zensur war vordringliche Aufgabe der Propagandaverwaltung der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD, später Informationsverwaltung), sondern die Ingangsetzung des gesellschaftlichen Lebens mittels Presse, Rundfunk, Theater, Filmkunst, Verlagswesen … Kultur war ein Lebensmittel, so wichtig wie Brot, Butter und Kartoffeln. Nach Jahren der Entbehrung und der faschistischen Indoktrination hungerten die Deutschen nach Unterhaltung, Zerstreuung und Erbauung. Und so gab es zum Beispiel in Berlin an einem Tag im Februar 1946 zweihundert verschiedene Theaterveranstaltungen. In meist schlecht bis überhaupt nicht geheizten Räumen.
Legendär der Auftritt des Alexandrow-Ensembles am 18. August 1948 auf den Stufen des zerstörten Schauspielhauses auf dem Berliner Gendarmenmarkt vor Zehntausenden. „Im schönsten Wiesengrunde“ bewies einmal mehr, dass die Russen weder Untermenschen noch Barbaren waren, wie es die Nazipropaganda den Deutschen hatte weismachen wollen.
So erlebten die Berliner schon bald nach Kriegsende Kultur statt Rache – zu ihrer großen Erleichterung.
Kultur und Kunst sind wie kein anderes Gebiet geeignet, Brücken zu bauen, Gräben zuzuschütten, einander kennen und schätzen zu lernen, humanistische Ideen zu verbreiten, zu transportieren und dem barbarischen Charakter der noch lange nachwirkenden faschistischen Ideologie progressive weltanschauliche Ansichten entgegenzustellen.
Mit 80 Mitarbeitern war die Kulturabteilung der SMAD eine der größten Abteilungen in der Informationsverwaltung von über 160 Mitarbeitern. Sie war gut mit Experten der verschiedensten Genres ausgestattet, von Literatur- und Geschichtswissenschaft, Malerei, bildender und angewandter Kunst über Theater, Musik, Philosophie, Ökonomie, Journalistik, Pädagogik bis hin zur Volkskunst.
„Kulturoffizier“ war im Nachkriegsdeutschland Ost praktisch ein Synonym für den sowjetischen Akademiker in Uniform. Oft werden neben den Spezialisten für Kunst und Kultur auch alle diejenigen als Kulturoffiziere bezeichnet, die sich mit ideologischer, geistiger Arbeit schlechthin beschäftigten, zum Beispiel Presseoffiziere, Jugend-, Bildungs-, Hochschuloffiziere, Beauftragte für die neu gegründeten Parteien, Gewerkschaften und anderen Organisationen, für Verlage, die DEFA, Volkskunstensembles und andere. Viele von ihnen waren hoch gebildete Dozenten, Professoren und Spezialisten, der deutschen Sprache mächtig und zuhause in der deutschen Geschichte, Kultur und Mentalität.
Die Kulturoffiziere genossen als Konsultanten, Referenten, Instrukteure und Lektoren ganz schnell das Vertrauen, ja Verehrung und Zuneigung ihrer deutschen Partner und Zuhörer.
Ihnen allen oblagen Anleitungs-, Informations- und Kontrollaufgaben im Rahmen ihrer Verpflichtungen zur Einhaltung des Potsdamer Abkommens. Einige von ihnen glänzten selbst schon mit eigenen Werken oder erregten später Aufsehen damit. Aber ihre eigenen Forschungen und Pläne, ihr eigenes Schaffen musste zunächst warten. Ihre Karrieren waren unterbrochen. Nach jahrelangen Kämpfen gegen die faschistischen Eindringlinge führten sie – die meisten von ihnen um die dreißig Jahre alt, also noch recht jung und in jedem Falle unerfahren in der Aufgabe, den grausamen, besiegten Feind umzuerziehen – nun im Nachkriegsdeutschland mit ihrer Kompetenz einen bewundernswerten Kampf um die Herzen und Hirne der Menschen, für einen antifaschistisch-demokratischen Neubeginn in der von den Faschisten hinterlassenen Kulturwüste. Sie waren außerdem auch prädestiniert, den Deutschen die sowjetische Kunst und Kultur nahezubringen sowie Beschlüsse der sowjetischen Regierung und der SMAD zu erläutern. Ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen Antisowjetismus. Sie kamen und blieben aus Überzeugung. Oft wurde aus Anleitung und Unterstützung sehr schnell ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
Ihrer aller „Dienstherr“ war Sergei Iwanowitsch Tjulpanow. Er hat das Kunststück vollbracht, ihnen – obwohl militärischer Vorgesetzter – gleichzeitig Freund und Partner zu sein. Sein legendärer Ruf als Kenner der Deutschen, ihrer Literatur und Geschichte, Freund deutscher antifaschistischer Schriftsteller, politischer Emigranten, deutscher Kommunisten im Fronteinsatz und Repräsentanten des Nationalkomitees Freies Deutschland sowie des Bundes Deutscher Offiziere, war ihm nach Berlin vorausgeeilt, als er im August 1945 von Marschall Schukow nach Berlin in die SMAD gerufen wurde.
Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein neues politisch-kulturelles Leben im Osten Deutschlands in Gang gekommen. Der Berliner Rundfunk sendete seit dem 13. Mai wieder und neben der Berliner Zeitung erschien seit 21. Mai die legendäre „Tägliche Rundschau“ mit ihren denkwürdigen Kulturbeiträgen von hohem intellektuellem Niveau. Der Kulturbund zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands mit Johannes R. Becher an der Spitze war gegründet und für das gesamte Gebiet der Stadt Berlin sowie die SBZ zugelassen worden, das Goethe-Nationalmuseum in Weimar wiedereröffnet, Klassikergedenkstätten auf Kosten der SMAD instand gesetzt und mit ihrer Hilfe Theater, Kinos, Opernhäuser und Bibliotheken in vielen größeren Städten wieder präsentabel gemacht worden.
Von Administrieren hielt Sergei Iwanowitsch nicht so viel wie vom Diskutieren. Im Berliner Künstlerklub „Die Möwe“ war das Klima dafür ideal. Der „charismatische Oberst“ ging gern dort ein und aus. Man traf sich mit Gleichgesinnten, schloss neue Bekanntschaften, tauschte Meinungen zur Renaissance deutscher Kultur mit den Deutschen aus. Seine glänzenden Auftritte und die begründeten, logischen Ausführungen sorgten stets für überfüllte Säle.
Niemals ist er scharfen Fragen ausgewichen. Er verstand es, mit politischen Gegnern heftige Diskussionen zu führen und dabei höflich und korrekt zu bleiben. Niemals hat er seine Überzeugung preisgegeben und immer hat er sich bemüht, vom Standpunkt eines überzeugten, hoch gebildeten Kommunisten-Internationalisten erschöpfende Antwort zu geben. Er fürchtete sich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen, traf selbstständige Entscheidungen und setzte sich offen für Inhaftierte ein, die er für einen Neubeginn gewinnen wollte.
Ilja Fradkin, ehemaliger Theateroffizier in Tjulpanows Informationsverwaltung, berichtet in seinen Erinnerungen, wie sein Vorgesetzter im ersten Jahr der Nachkriegszeit in einer unerhörten Aktion von Zivilcourage bei den sowjetischen Sicherheitsorganen erfolgreich intervenierte, um den Schauspieler Gustaf Gründgens aus der Haft zu befreien. Das war zum damaligen Zeitpunkt selbst für ihn ein persönliches Risiko für Leib und Leben.

Zur Erinnerung: Gustaf Gründgens, begnadeter Schauspieler, kokettiert in der Weimarer Republik noch mit dem einen oder anderen Auftritt im Arbeitertheater, bis er als Protegé von Joseph Goebbels in Deutschland bleibt und auch nach außen hin als Visitenkarte fungiert.Einen solchen Weg zum „Clown zur Zerstreuung der Mörder“ verarbeitet Klaus Mann literarisch in seinem Roman „Mephisto“, erstmals erschienen 1936 in Amsterdam. In der Bundesrepublik Jahrzehnte lang verboten, wurde er 1956 vom (Ost-)Berliner Aufbau-Verlag herausgebracht. Unter dem selben Titel „Mephisto“ von István Szabó mit Klaus-Maria Brandauer genial verfilmt, lohnt sich gerade heute unbedingt ein Wieder-Sehen oder Wieder-Lesen.
Zurück zu Tjulpanow: Er kannte Wilhelm Pieck persönlich aus Moskau, hatte mit Walter Ulbricht gemeinsam vor Stalingrad im Schützengraben gekämpft und war mit Otto Grotewohl befreundet. Mit Anna Seghers, Jürgen Kuczynski, Johannes R. Becher, Friedrich Wolf, Ernst Busch und Willi Bredel pflegte er eine lebenslange Freundschaft. Er ging auf diejenigen bürgerlichen Politiker, Wissenschaftler und Künstler zu, die sich loyal gegenüber der Sowjetunion und der SMAD verhielten. Humanisten, Pazifisten, Demokraten – alle sollten sie einbezogen werden. So galt sein aufrichtiges Bemühen, oft gemeinsam mit J. R. Becher, beispielsweise Gerhart Hauptmann, Bernhard Kellermann, Hans Fallada und viele andere Persönlichkeiten zur Rückkehr aus der Emigration nach Berlin zu gewinnen. Ebenso galten seine Bemühungen den Brüdern Hanns und Gerhart Eisler, Anna Seghers, Alexander Abusch, Ludwig Renn, Wolfgang Langhoff, Wilhelm Furtwängler, Lion Feuchtwanger, Louis Fürnberg, Alfred Kantorowicz und vielen anderen. Auch Bert Brecht kam und hatte gleich 1947 ein Gespräch mit Sergei Tjulpanow, Arnold Zweig wurde Akademiepräsident, sie alle trugen dazu bei, ein neues geistiges Klima zu schaffen.
Nach Tjulpanows Auffassung ist Kultur ein weites Feld und umfasst nicht nur die verschiedensten Gebiete kreativen Schaffens, der geistigen Erbauung und Entspannung sowie der Bildung. Immer wieder wandte er sich gegen die Einengung und Reduzierung des Begriffes Kultur auf die schönen Künste. Kultur im weitesten Sinne zu sehen bedeutete für ihn, die geistige, kulturelle, politische und ökonomische Entwicklung eines Landes und der darin lebenden Menschen einschließlich ihrer gesellschaftlichen Strukturen und Machtverhältnisse zu betrachten.
Im September 1949 wurde Sergei Iwanowitsch Tjulpanow nach Moskau zurückbeordert, im Januar 1950 konnte er sich von seinen Mitarbeitern in Berlin verabschieden. Bekannt auch als „Oberster Kulturoffizier der SMAD“ hatte er sich in vielen Herzen, besonders der Ostdeutschen, mit seinem Wirken im Nachkriegsdeutschland einen Ehrenplatz erarbeitet. Und er seinerseits ließ bei Rückkehr in die Heimat ein Stück seines Herzens in Deutschland zurück. Tjulpanow ging wieder nach Leningrad, in die Wissenschaft, er wurde zu einem gefragten Hochschullehrer und Wissenschaftler der Politischen Ökonomie des Kapitalismus. Erst 1965 durfte er die DDR wieder besuchen.
Viele Schriftsteller, Publizisten, Wissenschaftler und Journalisten, unter ihnen auch solche, die er erst zu DDR-Zeiten kennengelernt hatte, schickten ihm noch jahrelang ihre Werke, meist mit anrührenden persönlichen Widmungen versehen, wie zum Beispiel Peter Edel: „Nehmen Sie mein Buch an als ein kleines Zeichen der Dankbarkeit für alles, was Sie für den Aufbau meines Landes geleistet haben.“
Ja, Dankbarkeit den Befreiern gegenüber ist angesagt und das Erinnern an ihren opferreichen Kampf vor 80 Jahren.
Dieser Text erschien zuerst unter befreiung.org