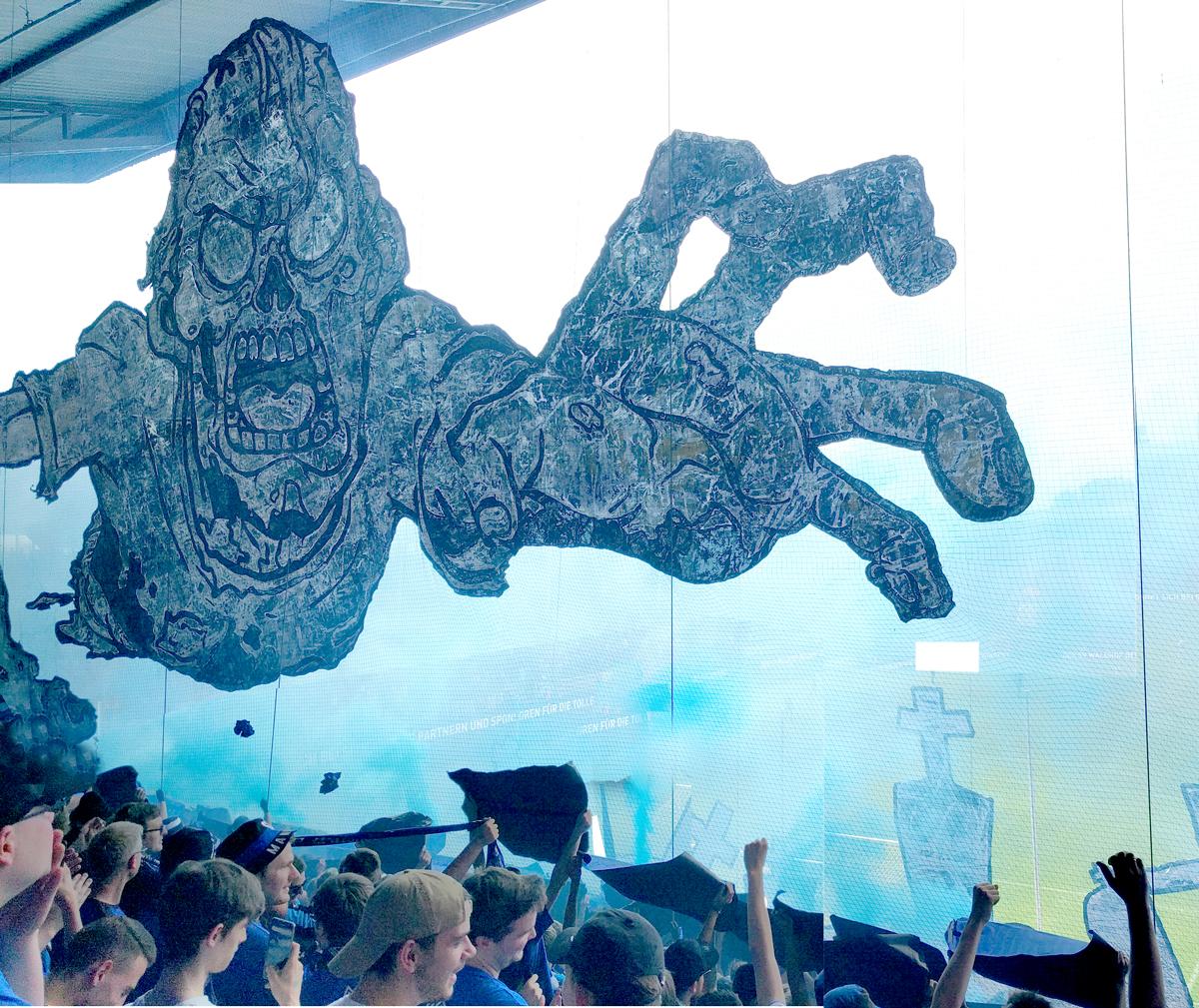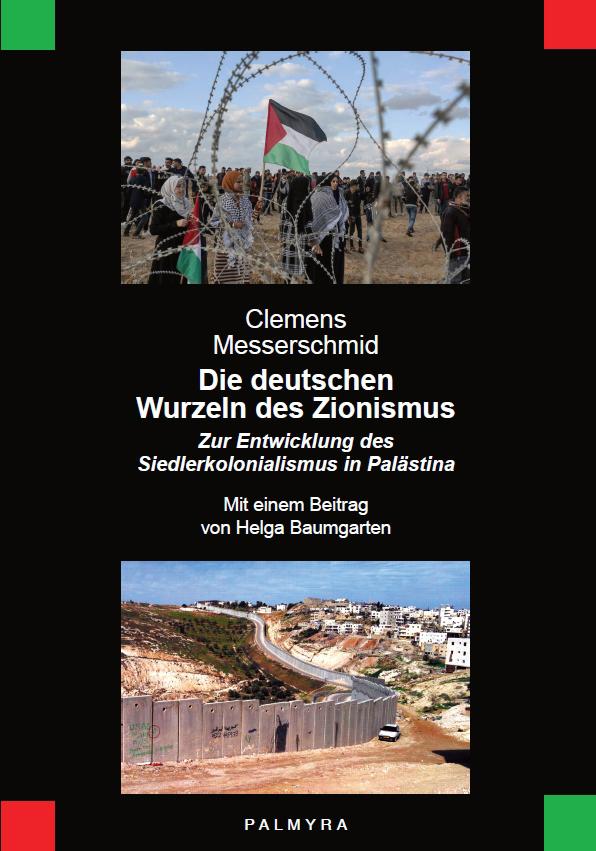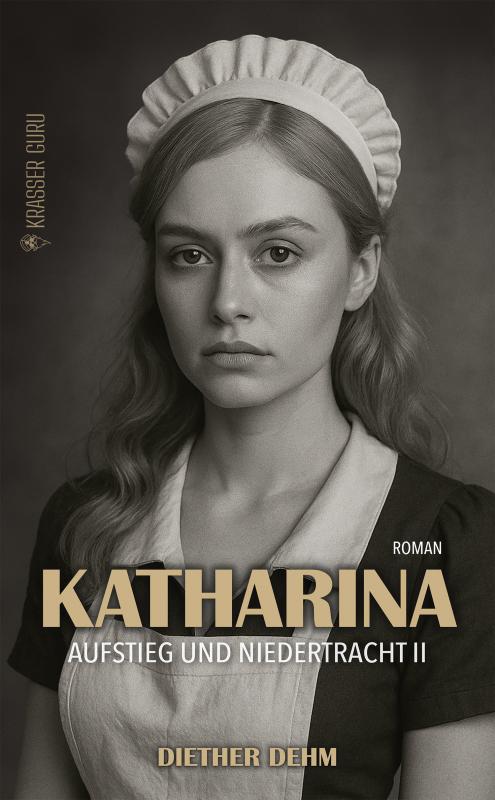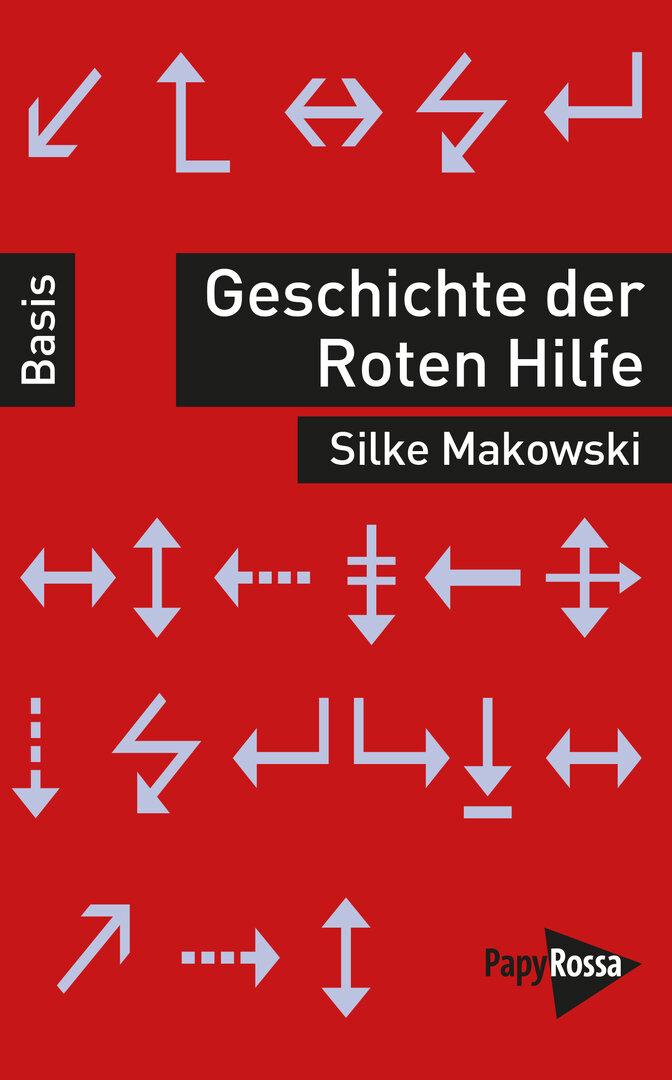Uwe Behrens hat fast 30 Jahre in China gelebt. Seit 1990 arbeitete er für verschiedene Logistikunternehmen in der Volksrepublik. Sein Buch „Feindbild China“ erschien 2020, „Der Umbau der Welt. Wohin führt die Neue Seidenstraße?“ im Jahr 2022. In seinem neuen Buch „Chinas Gegenentwurf“ schildert Behrens, welche Erkenntnisse er über den Entwicklungsweg des Landes gewonnen hat und welche Erfahrungen er in verschiedenen Regionen Chinas sammeln konnte. Der nachstehende Text ist ein Auszug aus den Kapiteln „Was macht China anders?“ und „Administration der Armutsbekämpfung“. Wir danken der Eulenspiegel Verlagsgruppe für die Abdruckgenehmigung.
Ende 2020, nach acht Jahren intensiver Anstrengungen, erreichte China das Ziel, die extreme Armut zu beseitigen – eine Schlüsselaufgabe für die neue Ära des Aufbaus des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen. Für die 98,99 Millionen Menschen in den 128.000 als arm ausgewiesenen Dörfern und 832 Landkreisen, die unterhalb der aktuellen Armutsgrenze lebten, war die Armut Vergangenheit.
Alle Einwohner selbst in den ärmsten Regionen verfügten nunmehr über ein jährliches Einkommen von mindestens 12.588 Yuan, umgerechnet circa 4,6 US-Dollar am Tag. Der von der UNO definierte Grenzwert liegt bei 2,15 Dollar pro Person und Tag.
Neben dem Minimal-Einkommen wurden ausreichend Wohnraum, ein dreistufiges Gesundheitssystem in Dorf, Gemeinde und Landkreis und ein neunjähriger Schulbesuch mit in die Bewertung einbezogen. Die Abdeckung mit Trinkwasser lag bei 83 Prozent und mit Glasfaser-Internetanbindung bei 98 Prozent.
Im Mai 2021verkündete die chinesische Parteiführung, dass bereits Ende 2020 das Ziel der Überwindung der absoluten Armut in ganz China erreicht worden sei. Die UN sah dafür das Jahr 2030 vor. Die Volksrepublik lag also zehn Jahre vor dieser Frist – und das trotz der weltweiten Covid-Pandemie.
In der Vergangenheit kannte die Welt nur ein schwaches China in Armut, dessen Bevölkerung in schrecklichem Elend lebte. Mit der bis 2020 erreichten vollständigen Überwindung der Armut war China das erste Entwicklungsland, das eines der Millenniums-Entwicklungsziele zur Armutsbekämpfung verwirklicht hatte.
Die gezielte Armutsbekämpfung in China erfolgte durch Institutionen, die eine politische Strategie engagiert umsetzten. Diese war äußerst komplex, was eine strenge Organisation und Führung erforderte. Unter Berufung auf die politische und die organisatorische Stärke der KP Chinas etablierte China ein Netzwerk zur Beseitigung der Armut – mit der Zentralregierung, die als Koordinator fungierte, den Provinzregierungen, Stadt- und Kreisregierungen, die für die Umsetzung verantwortlich zeichneten. Bürokratische Grenzen zwischen Regierungsämtern wurden überwunden, um personelle Ressourcen für die Armutsbekämpfung zu schaffen. Es kam zu horizontaler und vertikaler politischer Integration. In armutsbetroffenen Regionen arbeiteten auf allen Regierungsebenen Anti-Armuts-Koordinationseinheiten.
Die führenden Beamten in 22 Provinzen und Verwaltungseinheiten in Zentral- und Westchina sandten Verpflichtungen an das Zentralkomitee der Partei. Die Parteisekretäre auf den fünf Verwaltungsebenen – der Provinz, der Stadt, des Landkreises, der Kommune und des Dorfes – wirkten für dieses eine Ziel. Während der Kampagne mussten Sekretäre und Bezirksgouverneure auf ihren Posten bleiben.
Gebiete, die mit der Beseitigung der Armut beauftragt waren, arbeiteten Zeitpläne mit einer klaren Zuweisung der Zuständigkeiten aus und trieben deren Umsetzung voran. An Orten, an denen die Arbeit besonders schwierig war, wurde der Kampf gegen die Armut zur obersten Priorität der sozialen und wirtschaftlichen Verpflichtungen erklärt.
2005 gründete die Regierung der Volksrepublik das International Poverty Reduction Center of China (IPRCC). Das Internationale Zentrum für Armutsbekämpfung in China arbeitete sowohl an der Strategie als auch an deren taktischer Umsetzung. Beginnend auf Landesebene richtete die Regierung ein zentrales Meldesystem ein, welches über die Provinzregierungen, die Kreisverwaltungen bis in die einzelnen Dörfer reichte. Die erste Phase des Programms bestand darin, Umfang und Ursachen der individuellen Armut zu erfassen. 800.000 Instrukteure – hauptamtliche Parteikader, Ingenieure, Wissenschaftler, Mediziner, Soziologen – reisten in 128.000 Dörfer, um die konkreten Umstände zu erfassen und zu analysieren. Sie lebten mindestens zwanzig Tage in den Dorfgemeinschaften, um herauszufinden, warum die Familien in Not lebten und wie ihnen wirksam geholfen werden konnte, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern.
China entwickelte eine Reihe von Standards und Verfahren, um „die Armen“ präzise zu erfassen. Darauf aufbauend wurden unter anderem konkrete Vorschläge zur Verbesserung des Einkommens mit den Familien und mit den Dorfkomitees diskutiert. (Bei den Komitees handelt es sich um gewählte Vertretungen der Dorfbewohner, die für die lokale Verwaltung und Selbstverwaltung des Dorfes zuständig sind.) War eine Beschäftigung im Dorf, im lokalen Handwerk oder in einem Industriebetrieb möglich? Entsprach die Wohnung oder das Haus den Anforderungen, genügten die Lebensbedingungen heutigen Ansprüchen – fließend Wasser, Strom, Internetzugang? Oder war ein anderes Quartier nötig? Wie sah es mit dem Zugang zur Bildung aus? Fuhr ein Schulbus oder war ein Platz im Internat in der Stadt besser? Wie war die medizinische Versorgung?
Im Durchschnitt bearbeitete jeder Analyst fünf Haushalte. Er war verpflichtet, mit jedem Haushalt einen Plan auszuarbeiten, wie eine realistische Verbesserung erfolgen könnte. Bis 2015 gab es in allen armen Dörfern ortsansässige Arbeitsteams, jeder arme Haushalt hatte seinen Ansprechpartner. Bis Ende 2020 waren insgesamt 255.000 ortsansässige Teams und mehr als drei Millionen Beauftragte in Dörfern unterwegs. Daneben arbeiteten fast zwei Millionen Bedienstete in den Stadtverwaltungen für diese Aufgabe. Der personelle Aufwand war immens.

Familien, die Beihilfen zur Linderung ihrer Armut beantragen wollten, bewarben sich zunächst um die Anerkennung, tatsächlich arm zu sein. Anschließend wurden die Angaben überprüft. Bei Meetings mit Dorfvertretern wurden sie entweder bestätigt oder eben nicht. Die Entscheidung wurde anschließend auf einer Informationstafel im Dorf ausgehängt. Kommentare und Vorschläge hinzuzufügen war erlaubt. Nach Ablauf der Aushängefrist prüften die Gemeinde- und Kreisregierung erneut diese Armenliste.
Der Ablauf des Prozederes war präzise vorgeschrieben und wurde auch akribisch dokumentiert.
Auf speziell eingerichteten Internetplattformen erfolgte seit 2015 eine diversifiziertere Messung von Armut. Mit 84 Indikatoren wurden die Lagen „vermessen“ und Punkte vergeben. Erhielt ein Haushalt weniger als 60 Punkte, wurde er als „absolut arm“ eingestuft. Zwischen 60 und 80 Punkte galt man als armutsgefährdet. Haushalte mit einem Wert über 80 wurden als „armutsbefreit“ deklariert.
War ein Haushalt als „extrem arm“ eingestuft worden, wurde ein Betreuer berufen. Dieser beriet individuell, doch sein Name und seine Telefonnummer wurden auf einem Aushang an der Haustür mitgeteilt, ebenso die Höhe der Zuwendungen für den von ihm betreuten Haushalt.
Erstmals in Chinas Geschichte wurden Hilfsbedürftige nicht nur systematisch für die Statistik erfasst, sondern damit auch die Voraussetzungen geschaffen, konkret und zielführend gegen die Armut gesamtgesellschaftlich vorgehen zu können. Alle relevanten Informationen wurden in Datenbanken in der Provinz eingespeist und damit gearbeitet.
Natürlich erfolgte auch eine Kontrolle der Kader, die als Betreuer eingesetzt wurden. Es gab Besuche von Untersuchungskomitees, die deren Anwesenheit feststellten. Und über GPS verfolgte man, dass diese Personen auch in der vereinbarten Zeit in den ihnen zugewiesenen Dörfern waren. Und auf der anderen Seite waren die Betreuten aufgerufen, die Arbeit ihrer Betreuer zu beurteilen. Gute Betreuer wurden belobigt und für einen Aufstieg vorgeschlagen, Nachlässige sanktioniert.
Weil diese Arbeit fordernd und nicht sonderlich attraktiv war, wurden vorzugsweise Parteimitglieder für diese Aufgabe eingesetzt. Ihnen mutete man die Belastung zu, zeitweise außerhalb ihres Wohnorts und getrennt von der Familie zu arbeiten und zu leben. Ich hörte von Fällen, in denen Betreuer nicht nur Wochen und Monate, sondern Jahre in den ihnen zugewiesenen Orten verbrachten. Insbesondere für Städter war es mitunter hart, wenn sie die einfachen Lebensbedingungen mit den in weit abgelegenen Dörfern lebenden Menschen teilen mussten. (…)
Durch die sozialen Medien wabern Mitteilungen, nach denen angeblich etwa 1.800 Betreuer ihren Einsatz auf dem Land nicht überlebt hätten. Das lässt sich so wenig überprüfen wie die erhobenen Vorwürfe von Korruption. Es heißt, dass Familien bevorzugt worden seien. Dann wieder gab es Berichte, dass angeblich Einmalzahlungen geflossen seien, um die Statistik zu verbessern: So half man Familien angeblich über die statistische Armutsgrenze. Oder: Die sozialen Unterschiede in den Dörfern waren mitunter so gering, dass sie mit den aufgelisteten Kriterien kaum ausgemacht werden konnten. Also schätzten die Betreuer nach Augenschein und entschieden subjektiv, wer Zuwendungen erhielt und wer nicht. Das führte mitunter zu Unzufriedenheit und Konflikten, weil sich Dorfbewohner aufgrund solcher persönlichen Entscheidungen benachteiligt fühlten. Solche Missstimmungen kamen bisweilen auch zwischen Kommunen auf. Etwa wenn in Erwartung von Kontrollen genau dort, wo geprüft werden sollte, die Entwicklung überdurchschnittlich gefördert wurde, um die Arbeit der Betreuer in ein besonders gutes Licht zu setzen. Und schließlich raunte es in den Medien, dass die Ärmsten dieser Armen weniger stark protegiert wurden, weil sie trotz Förderung am wenigsten zum Wachstum der lokalen Wirtschaft beitragen würden. Man habe die Starken bevorzugt.
Tatsache ist, dass die Kontrollmechanismen funktionierten und eben solche Unregelmäßigkeiten aufgedeckt wurden. So wurden in der Provinz Hubei – etwa so groß wie die Bundesländer Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zusammen, dort leben an die 60 Millionen Menschen – in vier Monaten in rund 430.000 Fällen Momente von Korruption gemeldet. Es waren über 600 Millionen Yuan Renminbi (RMB), umgerechnet 78 Millionen Euro, unrechtmäßig gezahlt worden. Die Erfahrungen beim Aufdecken von Subventionsbetrug wird man künftig beim Nachverfolgen der Zuwendungen in die nunmehr aus der Armut befreiten Haushalte nutzen.
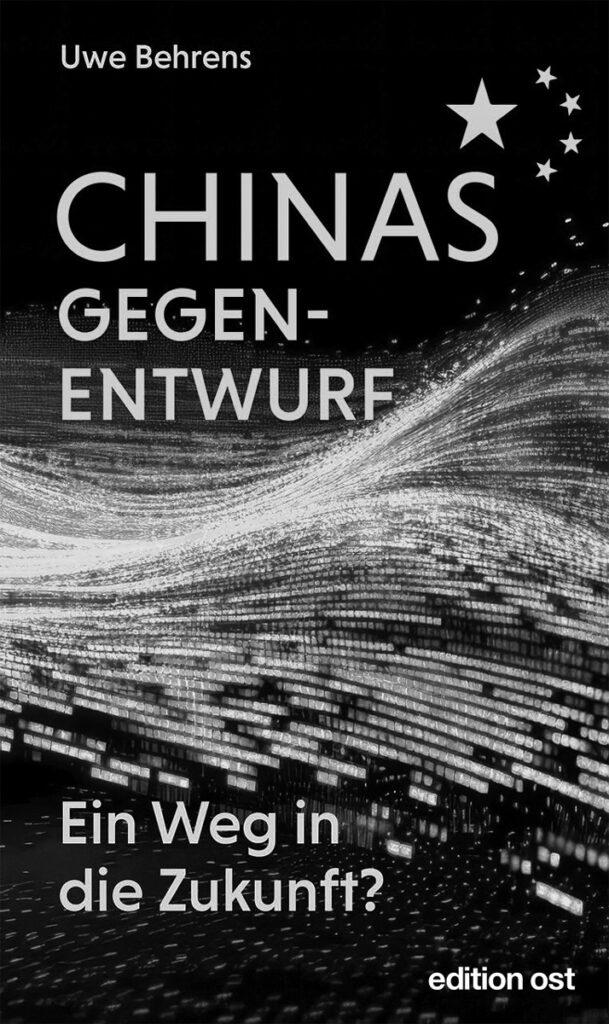
Uwe Behrens:
Chinas Gegenentwurf – Ein Weg in die Zukunft?
256 Seiten, 20 Euro
Zu bestellen unter UZ-Shop