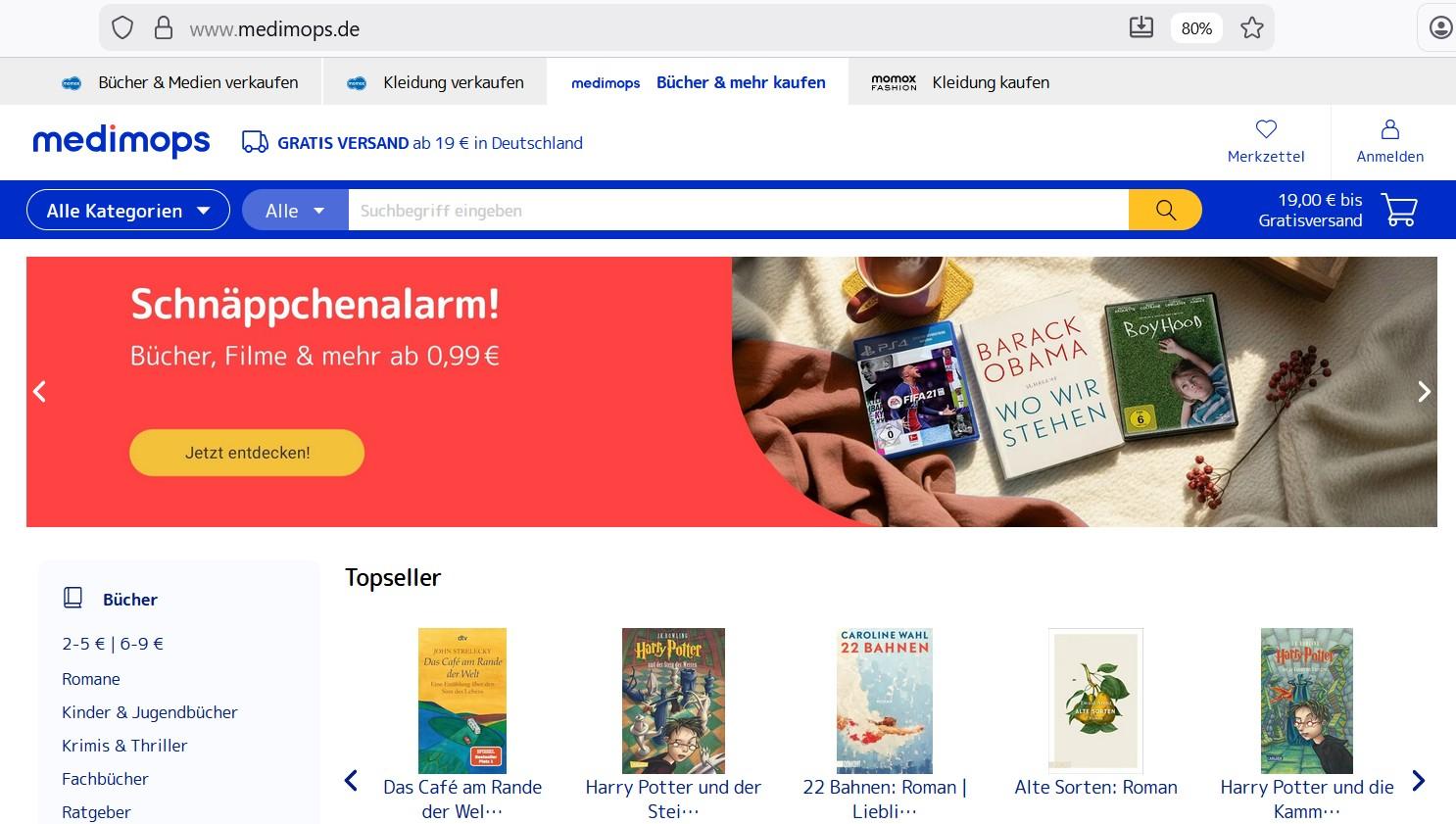Die Schere geht immer weiter auseinander. Was für die Vermögensverteilung schon lange bekannt ist, trifft auch auf den Ruhestand zu. Jeder fünfte Rentner kommt finanziell kaum über die Runden und muss monatlich mit maximal 1.400 Euro netto auskommen. Weitere 20 Prozent haben ein Einkommen zwischen 1.401 und 1.793 Euro. Jeweils ein weiteres Fünftel lebt von 1.794 bis 2.209 beziehungsweise 2.210 bis 2.869 Euro. Ihnen gegenüber stehen die übrigen 20 Prozent der Rentner und Pensionäre, die monatlich mehr als ... Bitte hier anmelden
Mi44NzDCoEV1cm8gbmV0dG8genVyIFZlcmbDvGd1bmcgaGFiZW4uCgoKCkRpZXMgZ2VodCBhdXMgWmFobGVuIGRlcyBTdGF0aXN0aXNjaGVuIEJ1bmRlc2FtdGVzIGhlcnZvciwgZGllIGluIGRlciB2ZXJnYW5nZW5lbiBXb2NoZSB2ZXLDtmZmZW50bGljaHQgd3VyZGVuLiBGw7xyIGRpZSBTdGF0aXN0aWsgd3VyZGVuIFJlbnRuZXJpbm5lbiB1bmQgUmVudG5lciBzb3dpZSBQZW5zaW9uw6RyZSBpbSBBbHRlciB2b24gbWluZGVzdGVucyA2NcKgSmFocmVuIGJlcsO8Y2tzaWNodGlndC4gWnVsZXR6dCB3YXJlbiBkYXMgMTYsM8KgTWlsbGlvbmVuIE1lbnNjaGVuLiBEYXMgbWl0dGxlcmUgRWlua29tbWVuIGluIGRpZXNlciBHcnVwcGUgbGFnIG5hY2ggQW5nYWJlbiBkZXMgU3RhdGlzdGlzY2hlbiBCdW5kZXNhbXRlcyBiZWkgMS45OTDCoEV1cm8gbmV0dG8uIERhenUgesOkaGx0ZW4gQWx0ZXJzcmVudGVuIHVuZCAtcGVuc2lvbmVuLCBIaW50ZXJibGllYmVuZW5yZW50ZW4gdW5kIC1wZW5zaW9uZW4gc293aWUgUmVudGVuIGF1cyBpbmRpdmlkdWVsbGVyIHByaXZhdGVyIFZvcnNvcmdlLgoKCgpEaWUgdmVyw7ZmZmVudGxpY2h0ZW4gWmFobGVuIGJlbGVnZW4sIGRhc3MgZGFzIEVpbmtvbW1lbiBkZXIgw7xiZXIgNjUtasOkaHJpZ2VuIFJ1aGVzdMOkbmRsZXIgaW4gZGVuIHZlcmdhbmdlbmVuIEphaHJlbiBsYW5nc2FtZXIgZ2VzdGllZ2VuIGlzdCBhbHMgZGFzIGRlciBHZXNhbXRiZXbDtmxrZXJ1bmcuIDIwMjEgYmV0cnVnIGVzIGltIE1pdHRlbCBydW5kIDEuODIwwqBFdXJvIG1vbmF0bGljaCB1bmQgd3VjaHMgYmlzIDIwMjQgdW0gbmV1biBQcm96ZW50LiBEYXMgbWl0dGxlcmUgRWlua29tbWVuIGRlciBHZXNhbXRiZXbDtmxrZXJ1bmcgc3RpZWcgaW0gc2VsYmVuIFplaXRyYXVtIGhpbmdlZ2VuIHVtIDExwqBQcm96ZW50LgoKCgpOaWVkcmlnZSBSZW50ZW4gYmVkZXV0ZW4gZsO8ciBkaWUgQmV0cm9mZmVuZW4gaW4gZGVyIFJlZ2VsIEFsdGVyc2FybXV0LiBMYXV0IGRlciBha3R1ZWxsZW4gRVUtU3RhdGlzdGlrIMO8YmVyIEVpbmtvbW1lbiB1bmQgTGViZW5zYmVkaW5ndW5nZW4gKEVVLVNJTEMpIGdhbHQgaW0gdmVyZ2FuZ2VuZW4gSmFociBoaWVyenVsYW5kZSBtaXQgMTksNMKgUHJvemVudCBmYXN0IGplZGUgZsO8bmZ0ZSBQZXJzb24gw7xiZXIgNjXCoEphaHJlIGFscyDigJ5hcm11dHNnZWbDpGhyZGV04oCcLiBEaWVzIGlzdCBlaW4gbWFzc2l2ZXIgQW5zdGllZyBzZWl0IDIwMTMsIGFscyBkaWVzIG51ciBmw7xyIDE0LDnCoFByb3plbnQgZGllc2VyIEFsdGVyc2dydXBwZSB6dXRyYWYuIEFscyBhcm11dHNnZWbDpGhyZGV0IGdpbHQgbGF1dCBTdGF0aXN0aXNjaGVtIEJ1bmRlc2FtdCBlaW5lIFBlcnNvbiwgd2VubiBpaHIgRWlua29tbWVuIHdlbmlnZXIgYWxzIDYwwqBQcm96ZW50IGRlcyBtaXR0bGVyZW4gRWlua29tbWVucyBiZXRyw6RndC4KCgoKSW4gZGVyIEZvbGdlIHNpbmQgaW1tZXIgbWVociBSZW50bmVyaW5uZW4gdW5kIFJlbnRuZXIgYXVmIHN0YWF0bGljaGUgVW50ZXJzdMO8dHp1bmcgYW5nZXdpZXNlbi4gRW5kZSAyMDI0IGJlem9nZW4ga25hcHAgNzM5LjAwMCB2b24gaWhuZW4gR3J1bmRzaWNoZXJ1bmcgaW0gQWx0ZXIuIERhcyBzaW5kIDY5MC4wMDAgYmV6aWVodW5nc3dlaXNlIGd1dCA3wqBQcm96ZW50IG1laHIgYWxzIGVpbiBKYWhyIHp1dm9yIHVuZCAzMcKgUHJvemVudCBtZWhyIGFscyBFbmRlIDIwMjAsIGFscyBlcyA1NjQuMDAwIHdhcmVuLgoKCgpBbmdlc2ljaHRzIGRpZXNlciBFbnR3aWNrbHVuZyBmb3JkZXJuIEdld2Vya3NjaGFmdGVuIHVuZCBTb3ppYWx2ZXJiw6RuZGUgc2Nob24gbGFuZ2UsIEFsdGVyc2FybXV0IHdpcmtzYW0genUgYmVrw6RtcGZlbi4gRGllIEJlcmxpbmVyIEtvYWxpdGlvbsOkcmUgaGFiZW4gamVkb2NoIGFuZGVyZSBQcmlvcml0w6R0ZW4uIEJ1bmRlc2thbnpsZXIgRnJpZWRyaWNoIE1lcnogaGF0IGRlbiDigJ5IZXJic3QgZGVyIFJlZm9ybWVu4oCcIGF1c2dlcnVmZW4uIFp1ciBCZWdyw7xuZHVuZyBkZXMgU296aWFsa2FobHNjaGxhZ3MsIGRlciBzaWNoIGRhaGludGVyIHZlcmJpcmd0LCBtw7xzc2VuIHdhY2hzZW5kZSBCZWxhc3R1bmdlbiBmw7xyIGRlbiBTdGFhdHNoYXVzaGFsdCB1bmQgZGllIEJlaXRyYWdzemFobGVyIHNvd2llIFJpc2lrZW4gZsO8ciBkaWUgV2V0dGJld2VyYnNmw6RoaWdrZWl0IGRlcyBTdGFuZG9ydHMgaGVyaGFsdGVuLgoKCgpEZXIgV2lzc2Vuc2NoYWZ0bGljaGUgQmVpcmF0IGJlaW0gQnVuZGVzd2lydHNjaGFmdHNtaW5pc3Rlcml1bSBoYXQgYmVyZWl0cyBkZXV0bGljaGUgRWluc2Nobml0dGUgaW4gZGVyIFJlbnRlbnBvbGl0aWsgYW5nZXJlZ3QuIFNvIGVtcGZlaGxlbiBkaWUgw5Zrb25vbWVuLCBkYXMgUmVudGVuZWludHJpdHRzYWx0ZXIgZHluYW1pc2NoIGFuIGRpZSBzdGVpZ2VuZGUgTGViZW5zZXJ3YXJ0dW5nIHp1IGtvcHBlbG4sIGRpZSBSZW50ZW4gYW4gZGVyIEluZmxhdGlvbiBzdGF0dCBhbiBkZXIgTG9obmVudHdpY2tsdW5nIHp1IG9yaWVudGllcmVuIHVuZCBkaWUgYWJzY2hsYWdzZnJlaWUg4oCeUmVudGUgbWl0IDYzIG5hY2ggNDUgQmVpdHJhZ3NqYWhyZW7igJzCoOKAkyBtaXQgQXVzbmFobWVuIGbDvHIgd2VuaWdlIGdlc3VuZGhlaXRsaWNoIGJlZWludHLDpGNodGlndGUgUmVudGVuYmVyZWNodGlndGXCoOKAkyBlbmRnw7xsdGlnIGFienVzY2hhZmZlbi4KCgoKRXMgc2NoZWludCwgYWxzIHfDpHJlIGF1cyBTaWNodCBkZXIgUmVnaWVydW5nIHVuZCBkZXIgZGFoaW50ZXJzdGVoZW5kZW4gS2FwaXRhbGZyYWt0aW9uZW4g4oCeQXJiZWl0ZW4gYmlzIHp1bSBzb3ppYWx2ZXJ0csOkZ2xpY2hlbiBBYmxlYmVu4oCcIGRpZSBMw7ZzdW5nIGFsbGVyIHJlbnRlbnBvbGl0aXNjaGVyIFByb2JsZW1lLiBEYXNzIG5hY2ggWmFobGVuIGRlciBEZXV0c2NoZW4gUmVudGVudmVyc2ljaGVydW5nIGJlcmVpdHMgRW5kZSAyMDIzIDEsNDbCoE1pbGxpb25lbiBSZW50bmVyIGVpbmVyIEJlc2Now6RmdGlndW5nIG5hY2hnaW5nZW7CoOKAkyBkYXZvbiAxNsKgUHJvemVudCBpbiBWb2xsemVpdMKg4oCTLCB1bSBpaHJlIGthcmdlIFJlbnRlIGF1Znp1YmVzc2Vybiwgd2lyZCB2ZXJzY2h3aWVnZW4uCgoKClN0YXR0ZGVzc2VuIHNvbGwgZGllIFphaGwgZGVyIGFyYmVpdGVuZGVuIFNlbmlvcmVuIGR1cmNoIHN0ZXVlcmZyZWllIEhpbnp1dmVyZGllbnN0bcO2Z2xpY2hrZWl0ZW4gaW4gSMO2aGUgdm9uIGJpcyB6dSAyLjAwMMKgRXVybyBpbSBNb25hdMKg4oCTIGRpZSBzb2dlbmFubnRlIOKAnkFrdGl2cmVudGXigJzCoOKAkyB3ZWl0ZXIgZXJow7ZodCB3ZXJkZW4uIFNvIHdlcmRlbiBkaWUgUmVudGVuIGplZG9jaCBuaWNodCBhcm11dHNmZXN0IGdlbWFjaHQuIEVpbmUgVmlsbGEgaW0gVGVzc2luIGFscyBBbHRlcnNydWhlc2l0eiBibGVpYnQgYXVjaCBpbiBadWt1bmZ0IGRlbmplbmlnZW4gdm9yYmVoYWx0ZW4sIGRpZSBpaHIgVmVybcO2Z2VuIGR1cmNoIGRpZSBBcmJlaXQgYW5kZXJlciBlcndvcmJlbiBoYWJlbi4=