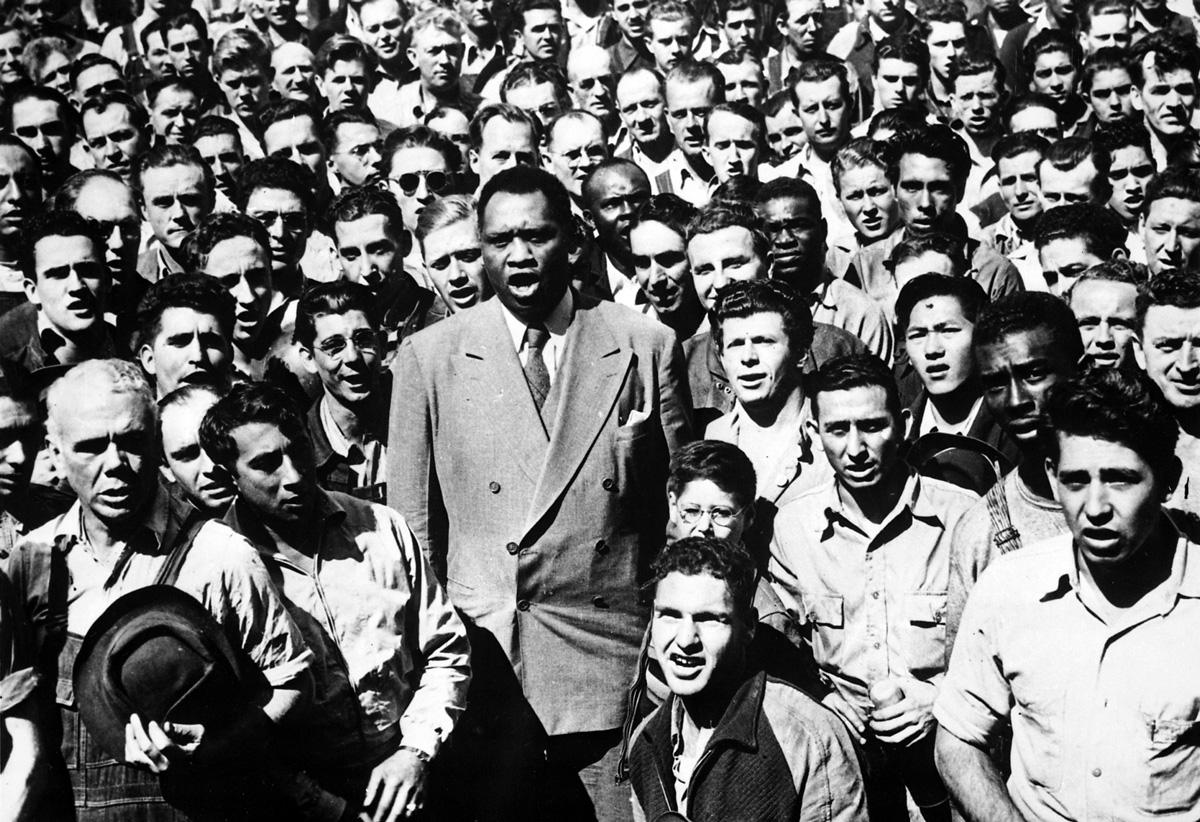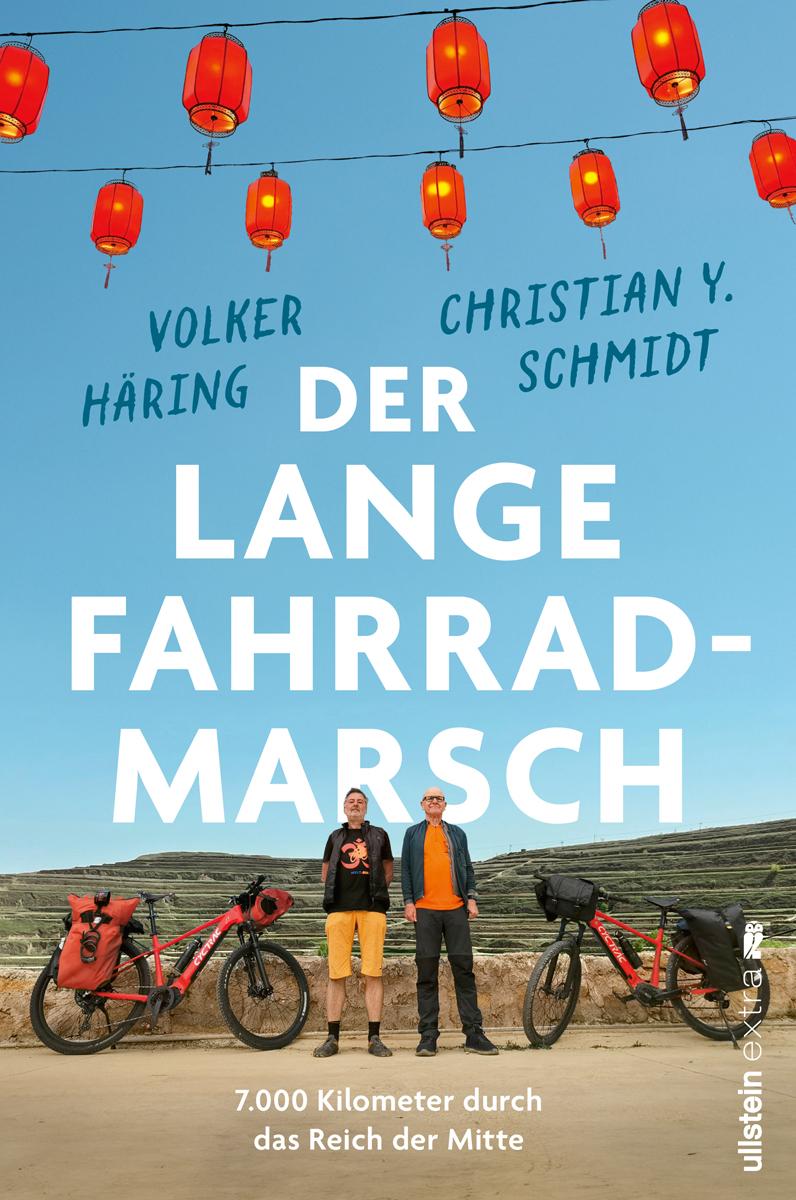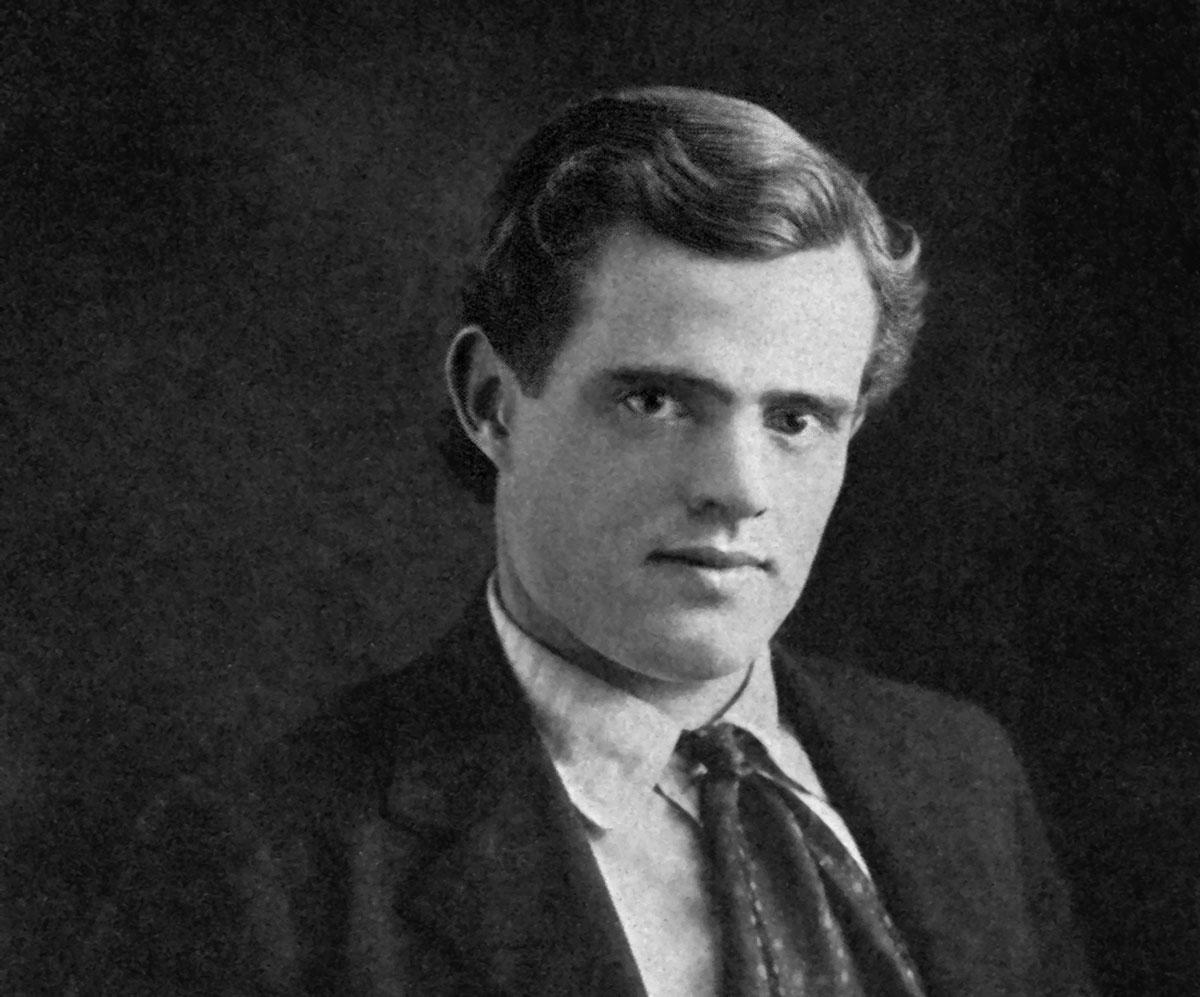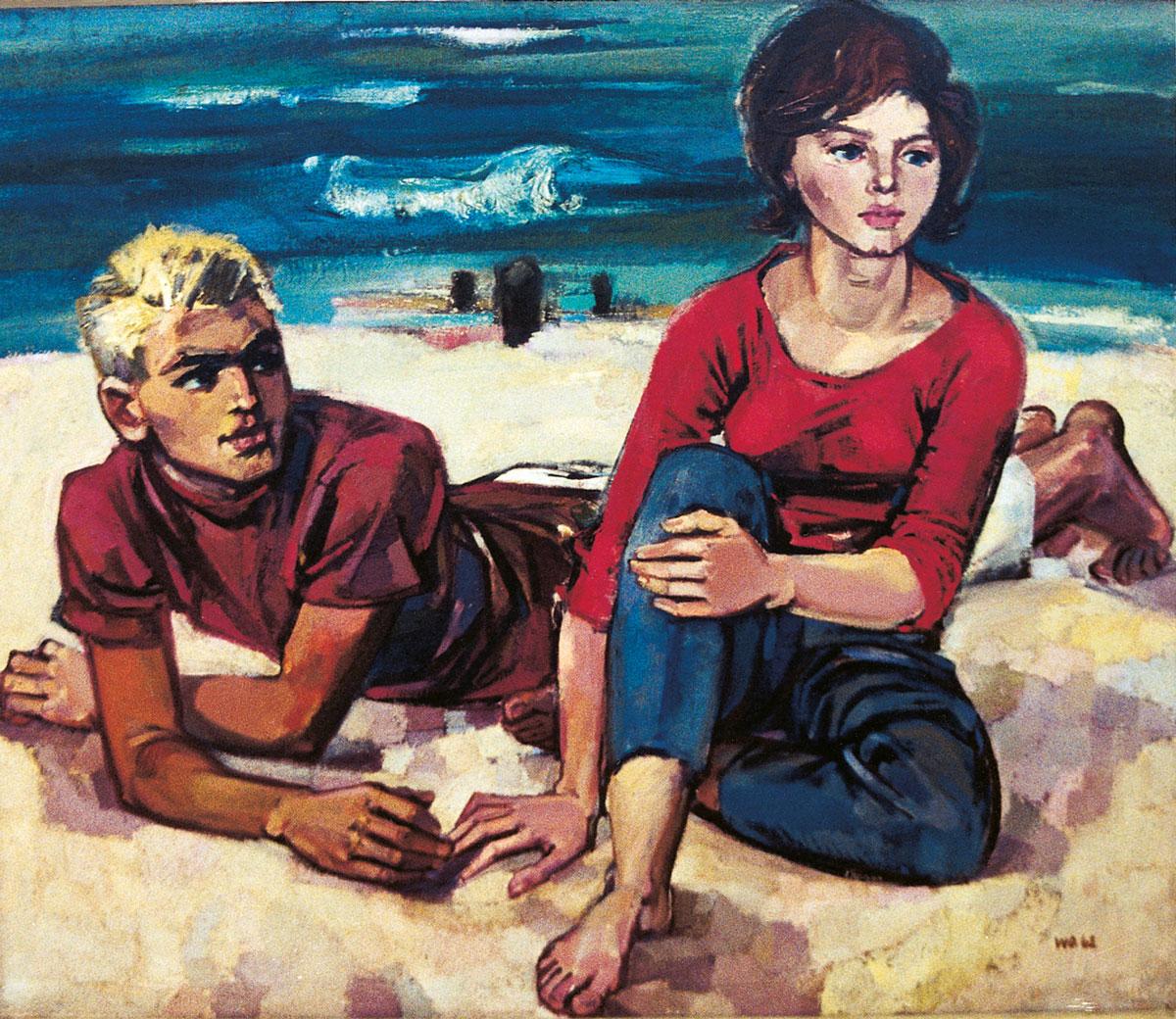Der Aufschrei bleibt aus: Titeln bundesdeutsche Medien Ähnliches wie „Wenn die Urlaubstage alle sind: Haben Arbeitnehmer Anspruch auf unbezahlten Urlaub?“, dann fühlt sich keiner diskriminiert und keine merkt an, welche unappetitliche Bedeutung durch die Wortwahl mittransportiert wird. Der Freiburger Literatur- und Kulturwissenschaftler Simon Sahner und der westdeutsche Frankfurter Ökonom Daniel Stähr haben sich die Mühe gemacht, die ideologischen Versatzstücke hinter der für uns alltäglichen Sprache zu enttarnen: Auch in der Bundesrepublik spricht man die „Sprache des Kapitalismus“.
Kapitalistisch sprechen, das ist meist kein böswilliger, nicht mal ein naiver Akt: „Es ist eine Sprache, die wir automatisch sprechen und verstehen, wenn wir im Kapitalismus sozialisiert worden sind oder lange in ihm gelebt haben“, schreiben die Autoren, und definieren das Phänomen als Summe bestimmter „Sprachbilder und Metaphern, Redewendungen und Phrasen, Mythen und Erzählungen“ und „einzelne(r) Begriffe, mit denen ökonomische Zusammenhänge beschrieben und erzählt werden“.
Der Kapitalismus also hat seine eigene Sprache entwickelt – und dabei stützt er sich auf Wendungen vorangegangener Epochen, wie das Eingangsbeispiel zeigt: Die Umkehrung der Verhältnisse, die sprachlich vorgenommen wird, wenn Lohnabhängige landläufig als „Arbeitnehmer“ ab-, die sich deren Arbeit aneignenden Kapitalisten als „Arbeitgeber“ aufgewertet werden, mögen viele durchschaut haben, ohne sich mit dem Marxismus beschäftigt zu haben. Alles andere als Allgemeinwissen ist jedoch, dass die Begriffe ihre Wurzeln im Feudalismus haben, ehe die bürgerliche Revolution für formale Rechtsgleichheit sorgte und der „Dienstgeber“ dem „Dienstnehmer“ das Arbeiten oktroyierte. Ähnlich gelagert ist der Fall des schön in unseren Ohren klingenden Wortes Urlaub: Dessen Ursprung liegt im mittelhochdeutschen „urloup“, die Erlaubnis, die der Leibeigene erhielt, um zu gehen.
Sahner und Stähr gehen auch auf mehr oder weniger bewusst betriebene Schindluder der Begriffe ein: Fußballer mit Millionenverträgen bekommen einen „Verdienst“, obwohl es menschenunmöglich ist, derart viel Leistung aufzubringen, um solche Summen wirklich verdienen zu können. Wer zu viel hat, als dass das noch ethisch vertretbar ist, wird von den Befürwortern progressiver Besteuerung Sahner und Stähr mit ihrem moralisierenden Neologismus „überreich“ bedacht. Moralisiert wird von den Herrschenden allemal: Finanzminister Christian Lindner (FDP) sprach im Zuge der Debatten um das 9-Euro-Ticket 2022 von „Gratismentalität“, natürlich ohne darauf hinzuweisen, dass diese Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel aus Steuergeldern finanziert ist, also die, die sie in Anspruch nehmen, keineswegs etwas gratis bekommen.
Größeren Raum geben die Autoren der Bildersprache des Kapitalismus: Mal wird die Marktwirtschaft anthropomorphisiert (die deutsche Ökonomie als Europas „kranker Mann“), mal zur Natur an sich erklärt, wenn etwa in Zeiten der Krise ohne menschliches Zutun der „perfekte Sturm“ oder ein „Tsunami“ naht und nun alle Anstrengungen getan werden müssen, das Kapital und seine Akteure mit „Rettungsschirmen“ vor dem Untergang zu bewahren. Auch auf neue Sprachkreationen im von ihnen an keiner Stelle so genannten Klassenkampf gehen Sahner und Stähr ein, indem sie auf die Flexibilisierung und das Einreißen der Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit verweisen, wenn von „New Work“ die Rede ist. Im mit Menschenrechten in Bombenform um sich schmeißenden, im Buch nicht als solcher ausgeschilderten Imperialismus wird eben schöngeredet, was Plünderung ist. Sahner und Stähr zitieren dazu trefflich den ehemaligen ivorischen Finanzminister Mamadou Koulibaly: „Die Ausbeutung kommt heute im Gewand der Entwicklungshilfe.“
Der Kapitalismus schafft es, sich durch seine Narrative als alternativlos darzustellen. Dem ist voll und ganz zuzustimmen. Nicht aber der Mitverantwortung, die der Realsozialismus den Autoren nach als gescheitertes Gegenprojekt zu tragen habe. Dass Antikommunismus die oberste Schublade im Aktenschrank der Sprache des Kapitalismus ist, wird im Buch verschwiegen.
Die Autoren träumen eher dem britischen Kulturwissenschaftler Mark Fisher nach von der unbestimmten Negation, einem „Postkapitalismus“, und sehen einen Ausweg aus der zunehmenden Zerstörung der Lebensgrundlage des Menschen auf der Erde wie die „taz“-Redakteurin Ulrike Herrmann. Die schwärmt vom britischen Kriegskapitalismus während des Zweiten Weltkriegs, als der Staat regulativ in die Wirtschaft eingriff, ohne zu enteignen, und dem dafür klassenübergreifende Zustimmung zuflog, weil es eben um die Niederringung des deutschen Faschismus als externe Bedrohung ging.
Letztlich schlagen sich Sahner und Stähr im innersystemischen Streit zwischen marktradikaler Neoklassik und wohlfahrtsstaatlichem Keynesianismus auf die Seite von Letzterem. Damit ist kein Leben nach der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu erlangen, auch nicht durch den illusionsbehafteten Fokus darauf, dass Erzählungen und Sprache maßgeblich das Handeln leiten. Auch in Anbetracht der Strecken, die das Buch für manche Sachverhalte in Anspruch nimmt, mag man in Anbetracht der Zeilenschinderei, um auf Buchlänge zu kommen, merken, dass auch Simon Sahner und Daniel Stähr die Sprache des Kapitalismus mitsprechen. Das geben die beiden mitunter auch zu – und letztlich ist das Unterfangen zu loben, sich für eine breite Öffentlichkeit mit der Sprache als allgegenwärtigem Ideologieinstrument zu befassen und als selbstverständlich und ungefährlich genommene Begriffe im Kapitalismus als dessen Waffen zu entlarven.
Simon Sahner/Daniel Stähr
Die Sprache des Kapitalismus
S. Fischer Verlag, 304 Seiten, 24 Euro