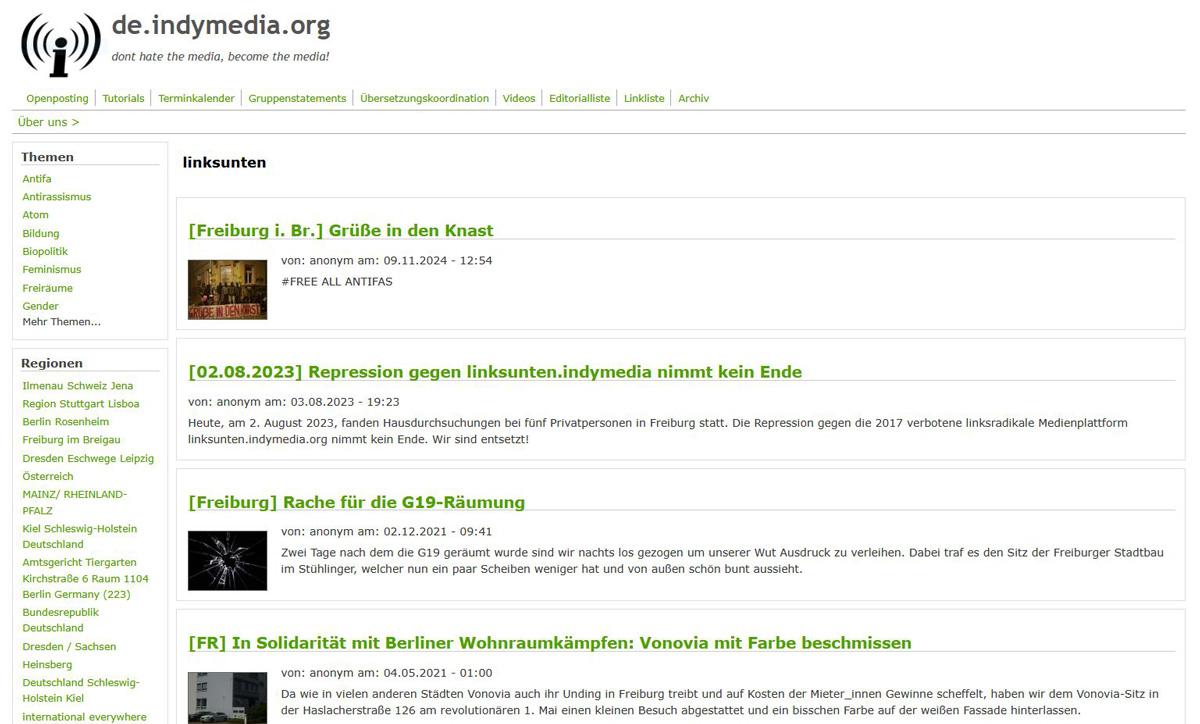Wenn internationale Wahlbeobachter, etwa der OSZE, in geopolitisch umkämpften Ländern ihre Berichte abliefern, schaut die westliche Öffentlichkeit hin: Kann man ihre Berichte nutzen, um eine missliebige Regierung zu delegitimieren? So etwa zuletzt bei der Parlamentswahl in Georgien, nachdem dort eine Regierung gewählt wurde, die sich der Konfrontation mit Russland verweigert.
Dass auch OSZE-Beobachter bei Bundestagswahlen in Deutschland anwesend sind und entsprechende Berichte veröffentlichen, ist hingegen wenig bekannt. Grundlage hierfür ist die Kopenhagener Erklärung von 1990, in der sich alle OSZE-Staaten verpflichten, internationale Wahlbeobachter einzuladen.
Wie wichtig deren Berichte sein können, zeigt der Fall der DKP: Bei der Bundestagswahl 2021 wurde sie zunächst vom Bundeswahlausschuss abgelehnt, konnte danach aber beim Bundesverfassungsgericht klagen, bekam Recht und konnte schließlich doch zur Wahl antreten. Der Schaffung dieser Klagemöglichkeit waren entsprechende Berichte der OSZE vorausgegangen, die die zuvor nicht bestehende Klagemöglichkeit einforderten. Der gesetzliche Rahmen wurde dann in Deutschland angepasst.
Sehr deutlich (und fast schon prophetisch) kritisierten die OSZE-Beobachter 2017 in ihrem Bericht den rechtlichen Rahmen für Nachwahlbeschwerden in Deutschland: „Die rechtlichen Rahmenbedingungen geben keinen Zeitraum für die Bearbeitung der Entscheidung von Beschwerden in der Nachwahlperiode her. In der Praxis können diese Entscheidungen einige Zeit in Anspruch nehmen (…) So ein langer Prozess wirft Fragen zur Effizienz und zeitnahen Schutz von Wahlrechten auf und steht im Widerspruch zu den OSZE Verpflichtungen als auch anderer internationaler Verpflichtungen und Standards. Des Weiteren kann ein System, wo der gewählte Bundestag die Rechtmäßigkeit der Wahl seiner eigenen Mitglieder überprüft, Fragen zu Interessenskonflikten aufwerfen.“
Dieser rechtliche Rahmen sieht in Deutschland vor, Beschwerden nach einer Wahl an den neu gewählten Bundestag zu richten, der sich erst konstituieren und entsprechende Ausschüsse einrichten muss. Vor allem besteht hier ein massiver Interessenkonflikt bei mandatsrelevanten Beschwerden. Im aktuellen Fall der Beschwerde des BSW müssten bei einer Neuauszählung und dem dann wahrscheinlichen nachträglichen Einzug in den Bundestag mehr als 30 Abgeordnete aller anderen Parteien den Bundestag verlassen. Die Merz-Klingbeil-Regierung verfügte dann zudem über keine Parlamentsmehrheit mehr. Man kann sich kaum einen größeren Interessenkonflikt vorstellen. Kein anderes europäisches Land kennt ein solches System.
Auch wenn nach Abschluss der Prüfung der Wahlbeschwerde durch den neuen Bundestag noch der Gang zum Bundesverfassungsgericht (und eventuell zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte) offensteht, unterminiert die fehlende zeitliche Vorgabe im Rechtsrahmen diesen Weg: Bei der Bundestagswahl 2021 hat es mehr als eine halbe Legislatur gedauert, bis das Bundesverwaltungsgericht im Dezember 2023 die Nachwahl in etlichen Berliner Wahlbezirken anordnete, die dann im Februar 2024 stattfand. Einzelne Abgeordnete mussten danach ihre Koffer packen, andere zogen noch für ein knappes Jahr ein. Diese Veränderungen hatten jedoch keinen Einfluss auf die Mehrheitsverhältnisse.
Es liegt auf der Hand, dass ein solcher Zeitrahmen nicht angemessen ist. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) im Juni dieses Jahres anlässlich der Klage des BSW einen „angemessenen“ Zeitrahmen eingefordert. Im Verwaltungsrecht beträgt eine solche Angemessenheit drei Monate. Anlässlich einer weiteren Klage eines Bürgers schreibt das BVerfG am 13. August 2025:
„Die Gründe dafür, dass der Bundestag die für die Wahlprüfung erforderlichen Schritte nicht unverzüglich nach seiner Konstituierung eingeleitet hat, erschließen sich nicht ohne Weiteres. (…) Es besteht ein öffentliches Interesse an der raschen und verbindlichen Klärung der ordnungsgemäßen Zusammensetzung des Parlaments. (…) Daher schließt das Bundesverfassungsgericht ausnahmsweise eine Wahlprüfungsbeschwerde auch ohne vorangehende Entscheidung des Deutschen Bundestages nicht aus, wenn dieser über den Wahleinspruch nicht in angemessener Frist entscheidet.“
Offiziell fehlen dem BSW circa 9.500 Stimmen, um die 5-Prozent-Hürde zu überspringen. Alle seriösen statistischen Extrapolierungen von Nachzählungen in mehr als 50 der circa 95.000 Wahlbezirke deuten darauf hin, dass das BSW mehr als 30.000 Stimmen zusätzlich in den Urnen hat als bislang offiziell gezählt. Ein Ignorieren dieses Umstands und ein weiteres Verschleppen der Wahlprüfung würde das Vertrauen in das deutsche Wahlsystem erschüttern, auch international.
24 Abgeordnete des Europarates wandten sich deshalb im Juni dieses Jahres an den Bundestag und forderten einen schnellen Abschluss des Wahlprozesses in Deutschland. Das Gleiche forderte der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Theodoros Rousopoulos, bei der Akkreditierung der neuen deutschen Delegation.
Egal, was man vom BSW hält, ein zügiger Abschluss der Bundestagswahl 2025 sollte im Interesse jedes Demokraten sein. Internationale Wahlbeobachtungen können hilfreich sein, wenn sie nicht geopolitisch missbraucht werden. Man sieht von außen eben manchmal klarer als im Getümmel.
Unser Autor ist Mitglied des BSW und war seit dem Jahr 2009 Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Er hat an mehr als 25 Wahlbeobachtungsmissionen des Europarates und der OSZE teilgenommen.