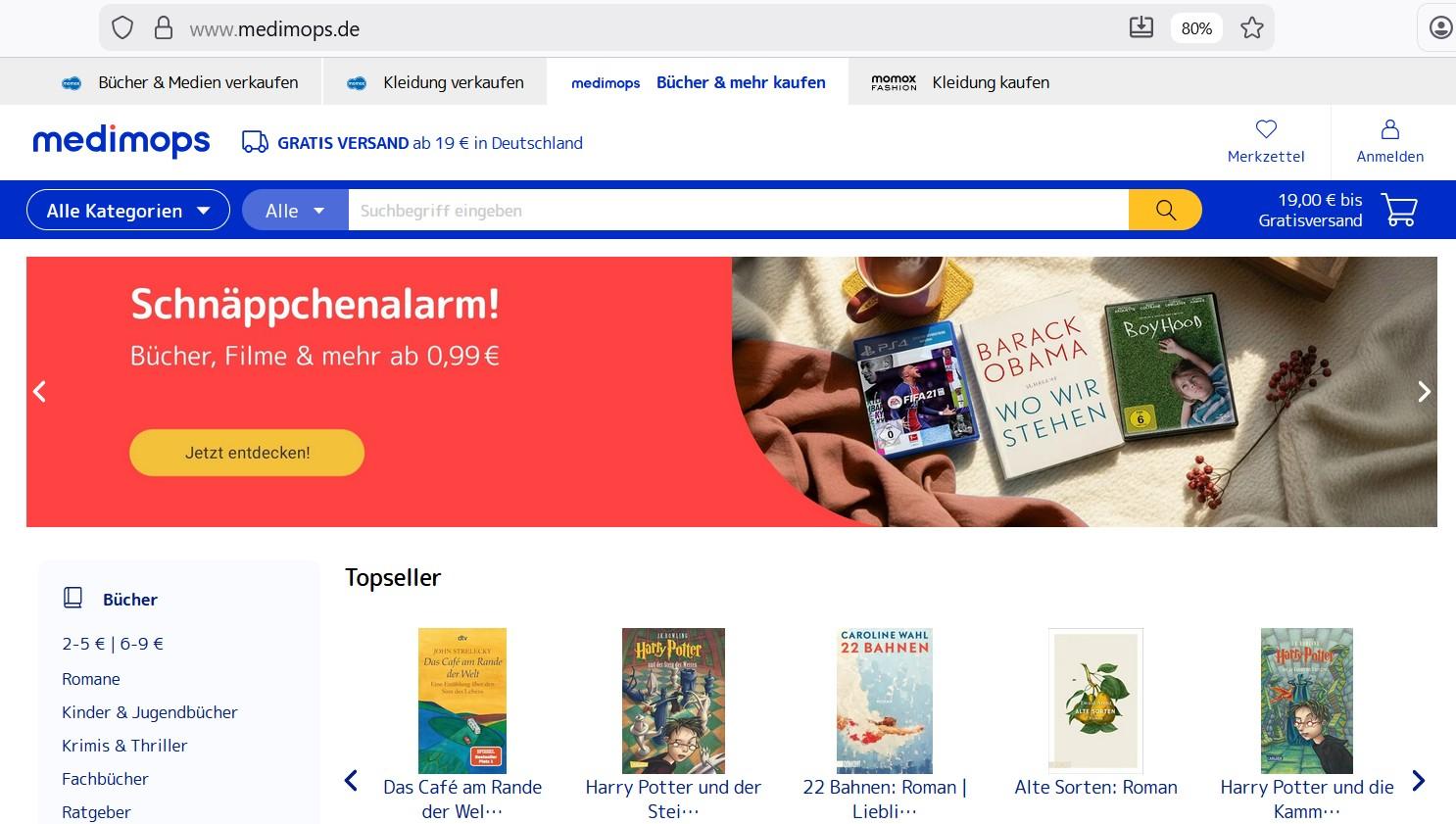Verspätungen, marode Infrastruktur, rote Zahlen und Personalabbau – die Deutsche Bahn AG steckt in der Krise. Nach dem angekündigten Abgang von Bahnchef Richard Lutz will Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) im September seine Pläne zur Zukunft der DB vorstellen. Fragen nach der sicherheitspolitischen Rolle der Bahn sollen dabei nicht im Fokus stehen. UZ sprach mit Rainer Perschewski, Betriebsratsvorsitzender bei der DB InfraGO AG im Geschäftsbereich Personenbahnhöfe und Mitglied im Bundesvorstand der EVG, über die Folgen der aktuellen Entwicklung für die Beschäftigten.
UZ: Turbulente Zeiten für die Deutsche Bahn. Wie macht sich das in deiner betrieblichen Praxis bemerkbar?
Rainer Perschewski: Die Situation ist chaotisch wie selten zuvor. Ich bin seit über 20 Jahren im Konzern, seit 2005 im Betriebsrat und inzwischen Betriebsratsvorsitzender – einiges an Unruhe sind wir gewohnt. Aber was wir jetzt erleben, stellt mindestens die letzten 15 Jahre in den Schatten: Nach der Neuorganisation von Schiene und Personenbahnhöfen stehen erneut massive Umstrukturierungen an. Das schafft enorme Unsicherheit. Noch nie habe ich so viele Kolleginnen und Kollegen erlebt, deren Gedanken sich mit Kündigungsschutz, Beschäftigungssicherung oder Aufhebungsverträgen beschäftigen. Dabei haben wir im Grunde gute tarifvertragliche Regelungen, so dass niemand befürchten muss, morgen auf der Straße zu sitzen. Aber die aktuelle Gemengelage aus wirtschaftlicher Situation, der Diskussion in den Medien und den noch nicht greifbaren Vorstellungen der Politik führt zu Verunsicherung. Manche schauen sich schon nach neuen Jobs um. Das ist brandgefährlich – denn die Bahn braucht jede Fachkraft, und zwar nicht nur draußen am Bahnhof oder in den Werken, sondern auch im Betrieb, in Planung und Verwaltung.
UZ: Was meinst du konkret damit? Personal in den Werken, am Bahnhof, im Gleisbau soll doch eingestellt werden?

Rainer Perschewski: Ja, es gibt Einstellungen – aber gleichzeitig sollen 30.000 Stellen abgebaut und Betriebe zusammengelegt werden. Dazu kommt die Spaltung in „gute“ und „unnütze“ Bereiche. Besonders gegen die „Zentralen“ wird Stimmung gemacht: Von „Plüschetage“ bis „Wasserkopf“ ist da die Rede. Aber das ist ideologische Spaltung – nichts anderes. Ich weiß genau, wer dort arbeitet: Architekten, IT-Spezialisten, Brandschutz- und Elektrofachleute, die man dringend braucht, um den Bahnbetrieb zu gewährleisten. Auch Dienste wie Buchhaltung, Personal oder Kantinen, die der Konzernzentrale zugeordnet sind, werden damit diffamiert.
Aber so funktioniert ja vieles in dieser Gesellschaft. Man setzt Behauptungen in die Welt, die einigermaßen plausibel klingen, und diese Stimmungsmache verhindert Solidarität und spielt nur denjenigen in die Hände, die die Bahn weiter zurechtstutzen wollen. Dabei werden Realitäten verschleiert, Stellen nicht nachbesetzt und die verbliebenen Beschäftigten höher belastet. Derzeit verzeichnen wir bei uns mehr Überlastungsanzeigen von Kolleginnen und Kollegen.
UZ: Wie stehst du zu den personellen Veränderungen in der Konzernspitze?
Rainer Perschewski: Ehrlich gesagt ist es für die Beschäftigten zweitrangig, ob oben ein Name ausgetauscht wird. Entscheidend ist, wessen Interessen diese Leute vertreten. Die Misere der Bahn hat nicht mit einzelnen Managern begonnen, sondern mit der Politik seit der Bahnreform 1994. Seitdem wird der Konzern chronisch unterfinanziert, tausende Kilometer Strecke wurden stillgelegt, Bahnhöfe verkauft und das Personal von 500.000 auf gut 200.000 zusammengestrichen. Ziel war nie eine funktionierende öffentliche Bahn, sondern Privatisierung, Profite und Konzerninteressen.
Ich war vor meiner Zeit als Betriebsratsvorsitzender Referent für die Arbeitnehmerbank – also die Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten – von zwei Aufsichtsräten und kann daher nur bestätigen: Die Politik wusste genau, was sie tat. SPD, CDU, FDP und Grüne – also die Regierungsparteien der Koalitionen der letzten Jahrzehnte – tragen daran gemeinsam Verantwortung. Darum sage ich: Der Wechsel an der Spitze ändert nichts. Es kommt darauf an, ob endlich eine Verkehrspolitik gemacht wird, die dem Gemeinnutz dient – also Mobilität für alle garantiert, Beschäftigung sichert und wirklich eine klimagerechte Verkehrswende einleitet. Alles andere bleibt ein Spiel auf Kosten der Beschäftigten und der Fahrgäste.
UZ: Die Bundesregierung hat einen Infrastrukturfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro aufgelegt, von dem gesagt wird, dass hiervon nun auch in die Infrastruktur der Bahn investiert werden soll. Wird nun alles besser?
Rainer Perschewski: Schön wär’s. Natürlich braucht die Bahn dringend Investitionen – das sehen wir täglich. Aber wer glaubt, mit diesem Fonds sei das Problem gelöst, macht sich Illusionen. Ich habe selbst Sitzungen im Bundestag miterlebt: Da wird um Beträge gefeilscht wie auf einem Basar und am Ende kommt bei der Bahn immer weniger an, als vorher versprochen wurde. Ich fürchte, so wird es auch diesmal laufen.
Viel entscheidender ist aber, wozu das Geld überhaupt in die Hand genommen wird. Und da reden wir nicht über eine Verkehrswende im Sinne der Beschäftigten oder der Fahrgäste. In der Gesetzesbegründung steht schwarz auf weiß, dass die Investitionen vor allem mit den Anforderungen des Militärs begründet werden. Sinngemäß: Ohne intakte Brücken, moderne Bahnhöfe und leistungsfähige Korridore können keine Panzer und Militärgüter nach Osten rollen. Das ist die eigentliche Triebkraft – und das wird selbst in den offiziellen Stellungnahmen der Gewerkschaften einfach verschwiegen.
Mich ärgert, dass auch meine eigene Gewerkschaft, ebenso wie andere DGB-Gewerkschaften, diesen Fonds kritiklos begrüßt hat. Anstatt die Militarisierung beim Namen zu nennen, verkauft man das als Fortschritt für die Infrastruktur.
Damit macht man sich blind für die Interessen, die hier wirklich durchgesetzt werden. Ich habe das mehrfach in Diskussionen angesprochen und hatte eher das Gefühl, dass mir mit Unglauben begegnet wird, dass es keiner wahrhaben will. Aber als auf einer Gesamtbetriebsratssitzung ein Kollege von Gesprächen mit der Politik berichtet hat und dass hier seiner Meinung nach Kriegsvorbereitung betrieben wird, war die Betroffenheit deutlich zu spüren.
Ich bin überzeugt: Spätestens, wenn die Rechnung kommt – nämlich Kürzungen im sozialen Bereich, um die Hochrüstung und diesen Fonds zu finanzieren – wird klarer, wohin der Kurs führt. Dann wird sich auch Widerstand regen müssen. Die Gewerkschaften haben die Pflicht, das nicht länger schönzureden, sondern klar Position zu beziehen: für Investitionen in eine Bahn im Interesse der Gesellschaft und der Beschäftigten – und gegen eine Militarisierung der Infrastruktur.
UZ: Wird das unter Betriebsräten und deiner Gewerkschaft politisch diskutiert? Und welchen Schlussfolgerungen ziehst du daraus?
Rainer Perschewski: Ja, es wird diskutiert – aber oft zu kurz gegriffen. Viele Kolleginnen und Kollegen sind es nicht mehr gewohnt, Entwicklungen im größeren gesellschaftlichen Zusammenhang zu betrachten. Statt klare Kante zu zeigen, wird manchmal eher auf die SPD geschielt – eine Partei, die die Bahnpolitik der letzten Jahrzehnte mitzuverantworten hat. Gespräche führen und kleine Aktionen starten reicht nicht. Wir brauchen eine Gewerkschaftsbewegung, die wieder grundsätzliche Fragen stellt: Wem gehört die Bahn? Wessen Interessen bestimmen die Politik? Und wie kommen wir zu einer echten Verkehrswende, die Beschäftigung und Gemeinnutz in den Mittelpunkt stellt – nicht Profite und Rüstungsvorhaben? Gewerkschaften dürfen sich nicht auf Tarifpolitik und Verkehrspolitik im engen Sinn beschränken. Unsere Aufgabe ist es, gesellschaftspolitisch einzugreifen – mit klarer Klassenposition, Solidarität und Kampfbereitschaft. Nur so können wir verhindern, dass die Beschäftigten weiter die Zeche für die Fehlentscheidungen der Politik und der Konzernspitze zahlen.