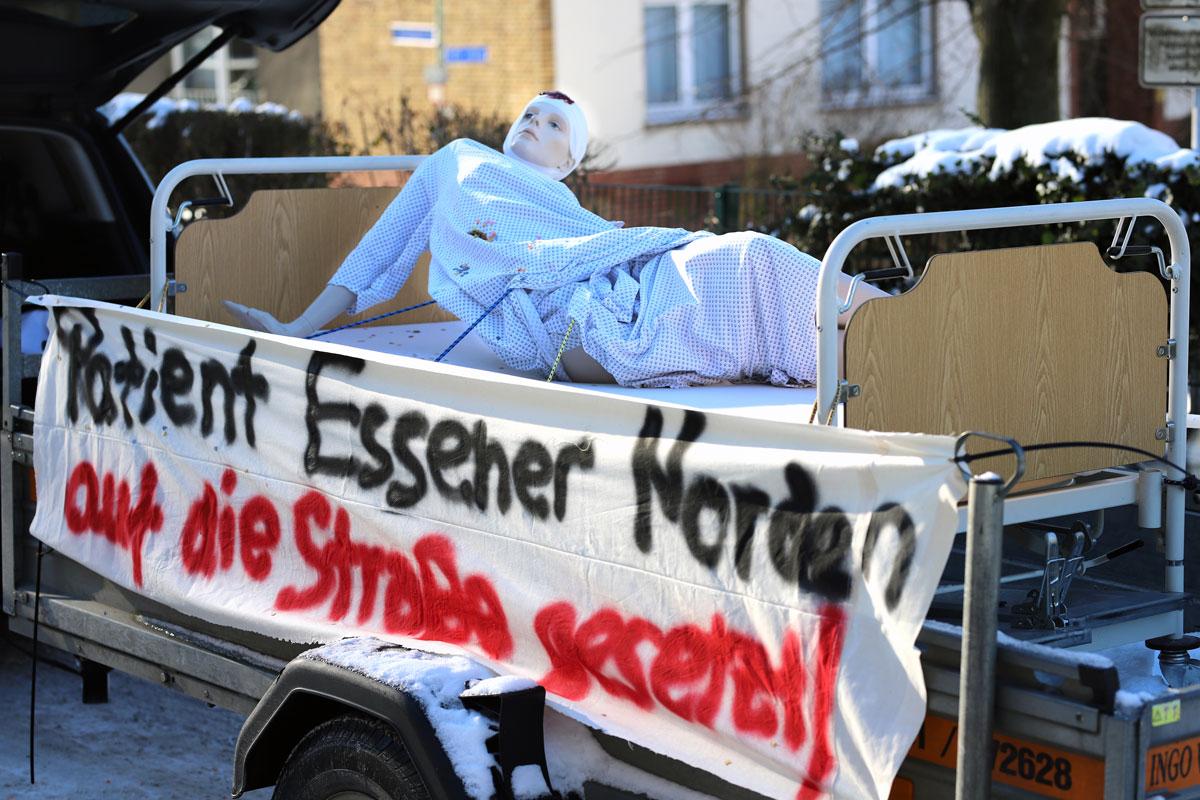Nicht nur die DKP befasst sich mit der aktuellen geopolitischen Entwicklung, ihrem geschichtlichen Hintergrund und den zu ziehenden Schlussfolgerungen. Das Buch des Geschichtsphilosophen Hauke Ritz „Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas“ ist ein beachtenswerter Beitrag zu dieser Debatte. Die Schlussfolgerungen betreffend Europa sehen wir kritisch, denn „Europa“ wird zu sehr als undifferenzierte Einheit gesehen, insbesondere die Rolle der BRD und anderer Unterdrückerstaaten findet kaum Beachtung. Doch darf das durchaus zurückstehen angesichts der profunden Analyse des Niedergangs des Westens, seiner gesteigerten Aggressivität und unter anderem der Rolle des Russenhasses hierbei. Wir drucken im Folgenden mit freundlicher Genehmigung des Verlags Promedia Auszüge aus dem Kapitel 6 nach. Es beleuchtet die Propagandaschlachten insbesondere der USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Erschreckend, entlarvend und – hoffentlich – erhellend ist die hier dargestellte Strategie der CIA zur Bekämpfung der Kommunisten durch eine nichtkommunistische Linke.
Für die USA stellte der hohe Organisationsgrad der sozialistischen und kommunistischen Parteien in Europa ein ernstes Problem dar. Nicht nur konnten sie in Frankreich, Italien und Griechenland hohe Stimmenanteile gewinnen und früher oder später an der Regierung beteiligt werden, wodurch sie sogar Einblicke in die Pläne der NATO erlangt hätten. Auch existierten in den europäischen Ländern zahlreiche Zeitschriften und Verlagshäuser, die die Weltsicht der Arbeiterbewegung umfassend in der Gesellschaft verbreiteten. Leicht konnten linke Parteien, Gewerkschaften und mit diesen verbundene Organisationen und Zeitschriften direkt von der Sowjetunion angesprochen und unterstützt werden.
Bereits 1948 hatte der ehemalige Kommunist und spätere Antikommunist Arthur Koestler auf einer Lesereise in den USA ein Gespräch mit Mitgliedern des State Departments geführt. Schon in diesem Gespräch soll er dafür geworben haben, sozialistische und kommunistische Gruppen nicht direkt zu unterdrücken, sondern stattdessen eine linke Kritik an ihnen zu fördern. Der US-amerikanische Historiker und Präsidentenberater Arthur Schlesinger hat diese Einsicht später als „stille Revolution“ beschrieben. Langsam verstand man in der CIA, dass es in der Gesellschaft immer linke Gruppen geben würde und es nicht zielführend war, das Linkssein wie unter Senator McCarthy an sich zu bekämpfen.
Hauptwidersprüche werden an die Seite geschoben
Meist handelte es sich bei linken Aktivisten nicht um genaue Kenner der Marxschen Theorie, sondern lediglich um Menschen, die von einer besseren Welt träumten und für ihr eigenes Leben nach Wirkungsmöglichkeiten suchten. Aus Sicht der CIA musste man diesen jungen Menschen lediglich eine Alternative zum herkömmlichen linken Weltbild bieten, um die Gefahr einer erstarkenden sozialistischen Internationale zu bannen. Dies könne man erreichen, indem man jene Linken stärker förderte, die enttäuscht vom Stalinismus seien und sich infolgedessen von der Sowjetunion abgewendet hätten. Es käme darauf an, eine nicht-kommunistische Linke zu unterstützen und die linke Identität selbst aufzugreifen und umzuinterpretieren.
Das Ziel müsste darin bestehen, eine nicht-kommunistische Linke zu schaffen, die zu einem produktiven Teil einer kapitalistischen Gesellschaft werden könnte. Dazu müsste der Fokus nicht mehr länger auf die Hauptwidersprüche des Kapitalismus, nämlich den Gegensatz von Kapital und Arbeit, Krieg und Frieden, Imperialismus versus Imperialismuskritik gelegt werden. Stattdessen käme es darauf an, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die Nebenwidersprüche des Kapitalismus zu lenken, also auf Widersprüche, die Symptome einer verschärften kapitalistischen Konkurrenz sind. Zu nennen sind hier zum Beispiel der Widerspruch der Rassendiskriminierung, der Unterdrückung der Frau, der Ausbeutung der Natur sowie überhaupt altmodische und repressive Traditionen, etwa die Haltung der katholischen Kirche zur Sexualität und ähnliche Widersprüche. Überhaupt müsste die Aufmerksamkeit der Linken vom Gemeinwohl auf individuelle Rechte umgelenkt werden. Ziel wäre, eine nicht-kommunistische und zugleich liberale Linke zu schaffen, die den Fokus von sozialen Rechten auf Bürgerrechte verlagert.
In der BRD machten Grüne die Drecksarbeit
Von allen Maßnahmen, die während des kulturellen Kalten Krieges ergriffen wurden, hatte diese Uminterpretation des linken Selbstverständnisses die größte Wirkung. Der Aufbau einer nicht-kommunistischen Linken vollzog sich über mehrere Stufen. Am Anfang stand in den 1950er Jahren zunächst die theoretische Beschäftigung mit der Möglichkeit einer nicht-kommunistischen Linken. In den 1960er Jahren zeigten sich erste Anwendungsmöglichkeiten, etwa die Kritik der neuen Linken an bestehenden Traditionen. In den 1970er Jahren eröffnete die Debatte um die Veröffentlichungen des Club of Rome ein ganz neues Feld linken Denkens, während die 1980er Jahre das Jahrzehnt waren, in dem die klassische Linke ihren Einfluss verlor, weil es zu einer nachhaltigen Verschiebung im politischen Spektrum kam. Mit der Gründung der Grünen Partei in Westdeutschland begann ein Prozess, im Zuge dessen der Gegensatz von Kapital und Arbeit allmählich durch den Antagonismus von Zivilisation und Natur ersetzt wurde. Nicht nur wurde die aus der Arbeiterbewegung hervorgegangene Linke auf diese Weise an den Rand gedrängt, darüber hinaus verlor die Sowjetunion ihre Ansprechpartner in den meisten westlichen Ländern.
Je mehr sich die Formen linker Identität im Westen veränderten, desto altmodischer wirkten die politischen Programme der sozialistischen Staaten im internationalen Kontext. Die Themen der nicht-kommunistischen Linken wurden im Westen zum neuen Denkhorizont der Linken, ja, sie wirkten sogar über die linken Gesellschaftsschichten hinaus und wurden mit der Zeit zum Identifikationspunkt der Mittelschicht. Von hier aus war es nur noch ein kleiner Schritt, die Inhalte der neuen Linken nach und nach offiziell anzuerkennen, staatlich zu fördern, zum Teil der offiziellen Kultur- und Bildungspolitik zu machen und sie schließlich sogar als Ideologie in der geopolitischen Konkurrenz einzusetzen.
Linksliberale sind schicker als Autoritäre
Doch die Entstehung einer neuen Linken bestand nicht nur darin, bisherige Randthemen in den Vordergrund zu stellen. Ein genauso wichtiger und nicht zu vernachlässigender Aspekt dieser politischen Bedeutungsverschiebung war die Kritik der alten Linken. In gewisser Weise konnte man hierbei zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich dann, wenn man der traditionellen Linken den Vorwurf des Kollektivismus und Autoritarismus machte und im Zuge dessen immer wieder auch die Sowjetunion oder die DDR als negative Beispiele anführte. Die ständig wiederholte Kritik der kollektiven und autoritären Strukturen sowohl der Sowjetunion als auch der traditionellen Linken ließ linken Organisationen keine andere Wahl, als sich selbst als linksliberal zu verstehen. Nur eine Linke, die fortan Freiheits- und Bürgerrechte in den Mittelpunkt rückte, statt die Herstellung einer umfassenden gesellschaftlichen Gerechtigkeit zum Bezugspunkt zu machen, konnte fortan vermeiden, mit dem vermeintlichen Autoritarismus assoziiert zu werden.
Tatsächlich konzentrierten sich die linken Diskurse im Laufe des Kalten Krieges immer stärker auf Freiheits- und Bürgerrechte. Damit einher ging eine Rehabilitierung des Liberalismus, der noch in den 1950er Jahren als eine der Ursachen mindestens des Ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise gegolten hatte. Theoretisch begleitet wurde diese Verschiebung von der Totalitarismusthese, durch die das Aufkommen des Faschismus nicht mehr auf die Exzesse eines deregulierten Liberalismus der 1920er und 1930er Jahre zurückgeführt wurde, sondern stattdessen Sozialismus und Faschismus als bloße Varianten eines Strebens nach totaler Macht neu verstanden wurden. Wirkten in den 1940er und 1950er Jahren noch der Sozialismus und Kommunismus als die natürlichen Gegenpole zu jedem extremen Nationalismus, wurden sie im Laufe des Kalten Krieges zunehmend mit dem Faschismus in eins gesetzt und stattdessen der Liberalismus als Antithese des Totalitarismus präsentiert.
Die Totalitarismusthese setzt sich durch
Bei der Entwicklung und Popularisierung der Totalitarismusthese spielten Hannah Arendt als Philosophin und George Orwell als Schriftsteller jeweils eine besondere Rolle. (…) Die Etablierung der Totalitarismusthese war allerdings noch aus anderen Gründen sehr wichtig. Wie bereits erwähnt, existierte vom Ersten Weltkrieg bis weit in die Mitte des Kalten Krieges hinein eine intellektuelle Hegemonie der Linken. Auf der Basis von Hegels dialektischer Geschichtsphilosophie und Marx’ kritischer Analyse des Kapitalismus und deren Verknüpfung mit der Psychoanalyse Freuds war eine beeindruckende theoretische Produktion zustande gekommen, die nicht nur verschiedene Schulen linker Theoriebildung hervorgebracht hatte, sondern auch die zahlreichen Erscheinungsformen der modernen Welt theoretisch zu deuten wusste. Linke Theoretiker hatten ein sehr differenziertes Verständnis gesellschaftlicher Prozesse hervorgebracht, vermochten Ideologie zu erkennen, formulierten komplexe geschichtsphilosophische Zeitbestimmungen, verfügten über eine beeindruckende Anthropologie und hatten schließlich auch Fortschritte in der Theorie der Ästhetik erreicht, die nicht einmal ansatzweise von konservativen oder liberalen Theoretikern eingeholt werden konnte. Noch in den 1970er Jahren waren praktisch alle Geisteswissenschaften von der Kunstgeschichte über die Literatur- bis zur Musik- und Religionswissenschaft von Theorien beeinflusst, die wiederum auf die hegelianisch-marxistisch-freudianische Traditionslinie zurückgingen. Zudem war die gesamte Tradition der Kulturkritik und der Essayistik von linken Theoretikern dominiert. Kurz, die von Hegel und Marx begründete philosophische Traditionslinie erwies sich einerseits aufgrund ihrer Dialektik und andererseits aufgrund ihrer geschichtsphilosophischen Dimension als eine Quelle schier unerschöpflicher Kreativität, der nichts Vergleichbares im rechten oder liberalen Spektrum gegenüberstand. (…)
Und so beschritt man den mühsamen Weg, mit der Etablierung einer neuen Generation von Philosophen zugleich die ideengeschichtlichen Traditionslinien neu zu knüpfen. Wie bereits in der eingangs zitierten Studie der CIA beschrieben, trat in Frankreich ab den 1970er Jahren eine neue Generation an Philosophen in Erscheinung, die vor allem durch eine Kritik des Marxismus, der Sowjetunion und der Geschichtsphilosophie hegelianischer Prägung aufhorchen ließ. Dabei rückte ein Denker des 19. Jahrhunderts ins Zentrum der Debatte, dem man das Potenzial zutraute, Hegel als dominanten Referenzpunkt der Philosophiegeschichte ersetzen zu können. Der Philosoph, dem man dies zutraute, hieß Friedrich Nietzsche.
Nietzsche als Drehscheibe postmoderner Philosophie
Nietzsche eignete sich als Alternative zu Marx und Hegel besonders gut, weil er bereits im späten 19. Jahrhundert ein Programm entworfen hatte, das sich explizit gegen die aus der französischen Revolution hervorgegangenen linken Gesellschaftsentwürfe und insbesondere gegen den Sozialismus richtete. Nietzsche identifizierte die geistesgeschichtlichen Quellen des Sozialismus im Christentum und verband daher seinen Einsatz für eine hierarchische Gesellschaftsstruktur mit einer umfassenden Kritik des Christentums. Dabei richtete er sich nicht nur gegen die Kirche, sondern auch gegen die Säkularisierung des Christentums, also die Übertragung christlicher Denkvorstellungen auf andere Bereiche, wie zum Beispiel die Philosophie, das Rechtsverständnis und die soziale Ordnung der Gesellschaft. So bestand Nietzsches Kritik an Hegel darin, dass dessen Philosophie noch zu viele christliche Vorstellungsmuster enthalte, weshalb er ihm vorwarf, den Sieg des Atheismus „verzögert zu haben“.
Damit hatte Nietzsche ein Konzept entworfen, das sich sehr gut auf die Situation des Kalten Krieges übertragen ließ. Und so kommt es ab der Mitte des Kalten Krieges zu einer unerwarteten Reaktualisierung der Philosophie Friedrich Nietzsches, mit der noch zehn Jahre zuvor kaum jemand gerechnet hätte. Denn eigentlich galt Nietzsche, nachdem der deutsche Faschismus sich auf ihn gestützt hatte, als diskreditiert. Doch mit Michel Foucault, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida in Frankreich und Gianni Vattimo in Italien traten gleich mehrere Philosophen auf, die Nietzsche zum Bezugspunkt ihres Denkens machten. Auch in Deutschland traten mit Odo Marquard und Hans Blumenberg ab den 1980er Jahren Philosophen in Erscheinung, die die Ablehnung der Geschichtsphilosophie und damit die Kritik der hegelianisch-marxistischen Tradition zu ihrer Kernaussage machten und sich ebenfalls auf Nietzsche stützten. Nietzsche wurde, wie Jürgen Habermas es ausdrückte, zur „Drehscheibe“ der postmodernen Philosophie. Die Ersetzung Hegels durch Nietzsche sollte gerade für die linke Theoriebildung dramatische Folgen haben. Dies wird allerdings erst anhand der Wechselwirkung zwischen Ideen- und Realgeschichte verständlich.
Hauke Ritz
Vom Niedergang des Westens zur Neuerfindung Europas
Promedia Verlag, 272 Seiten, 23 Euro