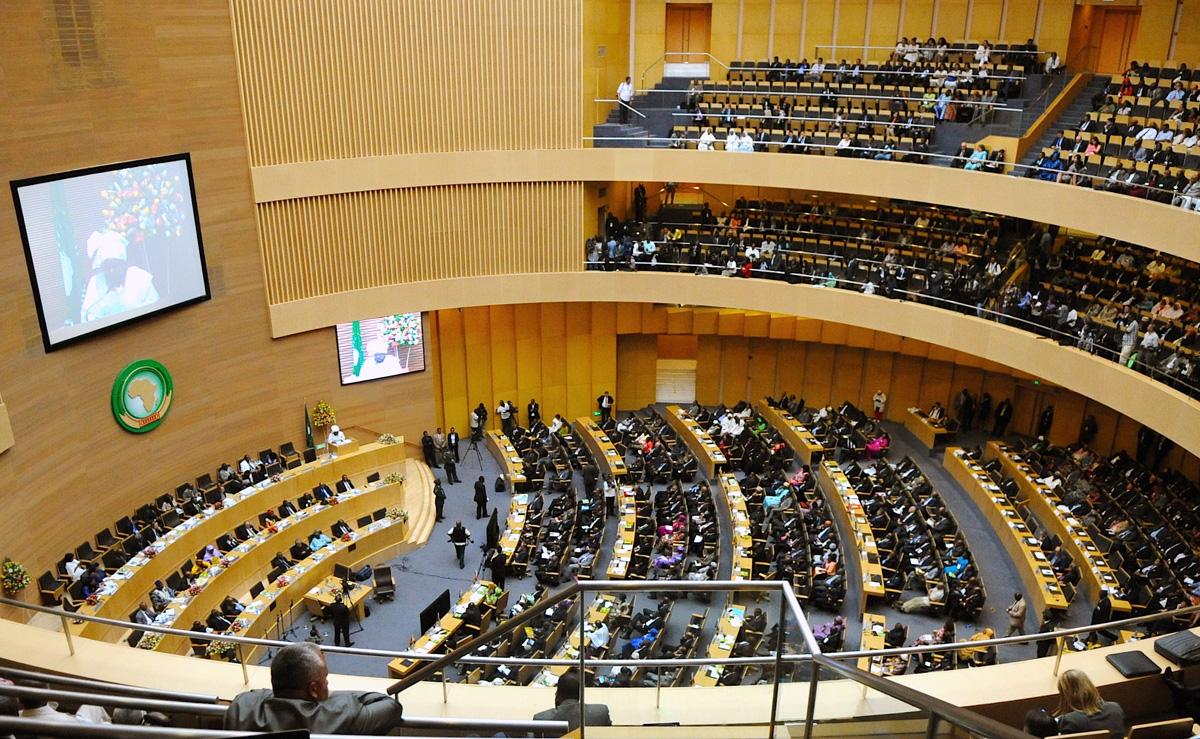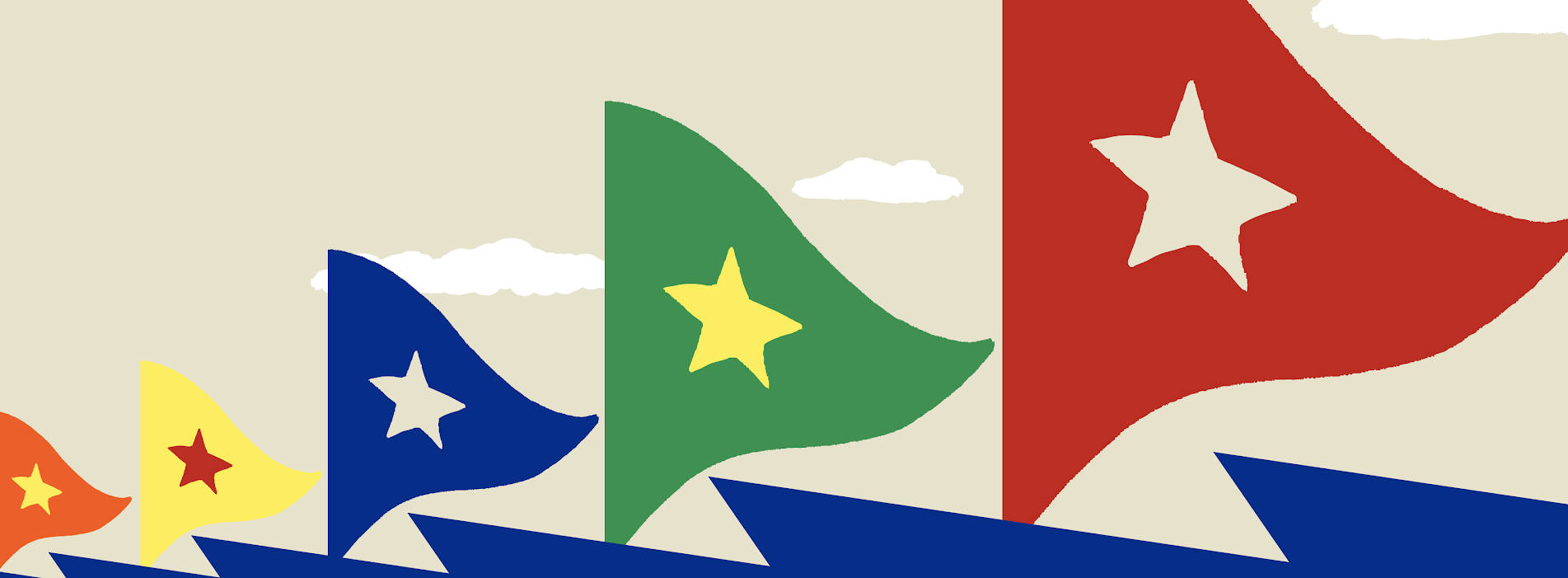Am Sonntag stellte er sein Kabinett vor, am Montag ist er zurückgetreten: Sébastien Lecornu geht als der am kürzesten amtierende Premierminister in die Geschichte des Frankreich der V. Republik ein. Staatspräsident Emmanuel Macron hat damit fünf Premiers in zwei Jahren verschlissen. Seine Versuche, die Interessen des Kapitals rücksichtslos und brutal gegen die große Mehrheit der Franzosen durchzusetzen, stoßen offenkundig an Grenzen. Seine Ignoranz für Wahlergebnisse, demokratische Mehrheiten und die Interessen der Beschäftigten haben Frankreich in die größte politische Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt.
Eine Lösung ist nicht in Sicht. Die Französische Kommunistische Partei (PCF) fordert, Macron möge endlich einen Premierminister aus den Reihen der Nouveau Front populaire (NFP) ernennen. Das Wahlbündnis hatte die vorgezogene Parlamentswahl im Sommer 2024 gewonnen. Die PCF ist Teil dieses Bündnisses, wie auch Les Écologistes, die ehemals sozialdemokratische PS und La France insoumise (LFi). Eine Einladung von LFi zum Gespräch an alle Parteien des Bündnisses schlug die PS aus.
LFi fordert den Rücktritt Macrons. Die Partei um Jean-Luc Mélenchon hat einen Antrag auf Amtsenthebung des Präsidenten eingereicht. Ob darüber abgestimmt wird, entscheidet das Präsidium der Nationalversammlung am Mittwoch, nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe von UZ. Macron kann nur mit den Stimmen des rechtsextremen RN abgewählt werden. Die Partei Marine Le Pens fordert den Rücktritt des Präsidenten und Neuwahlen.
Nichts spricht dafür, dass Macron plötzlich demokratischen Gepflogenheiten folgt und einen Premier aus den Reihen der NFP ernennt. Viel wahrscheinlicher ist, dass er einen weiteren Versuch unternimmt, mit einem Kandidaten aus seinen Reihen den Sparhaushalt durchzudrücken, gegen den mittlerweile zwei Millionen Franzosen an drei Aktionstagen gestreikt und demonstriert haben.
Gibt es Neuwahlen, prognostizieren Beobachter einen Sieg des RN. Mit dem RN dürfte Macron seine sozialen Kahlschlagspläne problemlos durch das Parlament bekommen. Um den Preis, dass der Widerstand auf der Straße erst recht befeuert wird.
Der hatte sich zuletzt etwas abgeschwächt: Am 2. Oktober, dem zweiten gewerkschaftlichen und insgesamt dritten Aktionstag gegen den Sparkurs, beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft CGT knapp 600.000 Menschen an 250 Demonstrationen. Am 18. September waren es über eine Million gewesen. Die sinkende Streikbeteiligung könnte daran liegen, dass Frankreichs Gewerkschaften keine effizienten Streikkassen führen. Ihre Mitglieder sind auf Spenden angewiesen oder müssen Lohneinbußen selbst abfedern. Zudem fehlt eine langfristige Strategie der Gewerkschaftsführungen. Sie haben zwar umfangreiche Forderungskataloge aufgestellt, sagen aber nicht, wie sie die konkret durchsetzen wollen. Sie beraten erst im Anschluss an einen Aktionstag, ob und wie es weitergeht.
Aus linker Sicht sind es diese Strategielosigkeit der Gewerkschaften und die Spaltung des Wahlbündnisses NFP, die einer Mobilisierung von Frankreichs Beschäftigten im Wege stehen – und damit einem fortschrittlichen Ausweg aus der Krise.